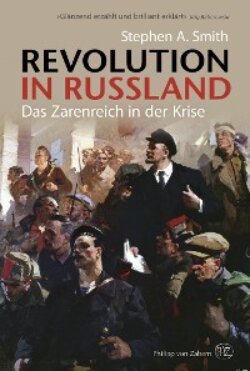Читать книгу Revolution in Russland - Stephen Smith - Страница 7
EINLEITUNG
Оглавление„Die Revolution war eine große Sache!“, fuhr Monsieur Pierre fort und verriet durch diese kühne und herausfordernde Behauptung sein äußerst jugendliches Alter.
„Wie? Revolution und Königsmord sind eine große Sache?“ „Ich rede nicht von Königsmord, ich rede von Ideen.“
„Ja: Ideen von Raub, Mord und Königsmord“, warf eine ironische Stimme erneut ein.
„Das waren zweifellos Auswüchse, aber nicht das eigentlich Wichtige. Wirklich wichtig sind die Menschenrechte, die Befreiung von Vorurteilen und die Gleichheit der Bürger.“
Tolstoi, Krieg und Frieden
Mit diesen wenigen Sätzen aus der Anfangsszene seines Meisterwerks zeigt Tolstoi auf glänzende Weise, wie stark umkämpft die historische Bedeutung der Französischen Revolution im ganzen 19. Jahrhundert und sogar noch im größten Teil des 20. Jahrhunderts war. 1978 erklärte der französische Historiker François Furet kühn: „Die Französische Revolution ist beendet.“ Zwar ist dieses Urteil fragwürdig, doch weist es darauf hin, dass ein geschichtliches Ereignis, welches einmal Leidenschaften auf Leben und Tod herausgefordert hatte, nun nicht mehr in der Lage war, die zeitgenössische Politik zu spalten oder zum Gegenstand tieferen gefühlsmäßigen Engagements zu werden. Ob sich dies auch von der Russischen Revolution anlässlich ihres einhundertsten Jahrestags sagen lässt, mag bezweifelt werden, selbst wenn die politische Gestalt, der sie zum Leben verhalf, vor mehr als einem Vierteljahrhundert aufhörte zu existieren. Noch ist das Echo der Herausforderung, mit dem die Machtergreifung der Bolschewiki im Oktober 1917 dem globalen Kapitalismus den Fehdehandschuh hinwarf, nicht verhallt (indes schwächer geworden), unüberhörbar aber werden die zeitgenössischen westlichen Konzeptionen einer durch die Idee von freien Märkten, Menschenrechten und Demokratie bestimmten Politik in Frage gestellt.
Furet wies darauf hin, dass es etwas anderes war, die Geschichte der Französischen Revolution zu schreiben, als die Geschichte der fränkischen Eroberungen des 5. Jahrhunderts. „Ein Historiker, dessen Studienobjekt die Französische Revolution ist, muss … Farbe bekennen. … Und die Ausrichtung seiner Arbeit steht fest, noch ehe er zu schreiben beginnt: Sie wird bestimmt durch seine Meinung, jene Form von Urteil, wie sie über die Merowinger nicht verlangt wird … Er muss diese Meinung nur aussprechen, und alles ist gesagt, schon ist er Royalist, Liberaler oder Jakobiner.“1 Natürlich gibt es keine Geschichtsschreibung ganz ohne politischen Widerhall: Die historische Interpretation schließt immer das Engagement mit ein. Zudem ist Historiographie selbst Teil der Geschichte und damit ständiger Revision ausgesetzt. Während nur wenige die Russische Revolution so beurteilen würden wie Pierre Besuchow es in Krieg und Frieden mit der Französischen Revolution tat, sollten wir uns daran erinnern, dass erstere 1945 von vielen auf vergleichbare Weise verteidigt worden wäre, nämlich als Grund und Gründung eines Staats, der, ungeachtet aller Fehler und Mängel, erheblich zur Niederringung des Faschismus beigetragen hatte. Furet kann also mit Fug und Recht behaupten, dass es bestimmte geschichtliche Ereignisse und Persönlichkeiten gibt, die besondere Leidenschaften hervorrufen und deren Geschichte zu schreiben ein spezifisch politisches Unternehmen ist. Auch einhundert Jahre danach ist die Russische Revolution noch solch ein Ereignis. Eben darum habe ich mich bemüht, über die Krise der zaristischen Autokratie, das Versagen der parlamentarischen Demokratie 1917 und den Aufstieg der Bolschewiki zur Macht so leidenschaftslos wie möglich zu berichten. Ich habe alles Moralisieren zu vermeiden und mit Sympathie über jene Persönlichkeiten zu schreiben versucht, gegen die ich Abneigung verspürte, während ich umgekehrt diejenigen kritisch beurteilte, zu denen ich positiv eingestellt war. Doch wer von den Lesern mich gleich zu Beginn mit einem Etikett versehen möchte – und ein Leser hat sicher das Recht zu wissen, wo der Autor steht –, sollte mit der Schlussbetrachtung beginnen.
Dieses Buch ist in erster Linie für all jene Leser geschrieben, denen die Thematik noch relativ unbekannt ist, doch hoffe ich, dass es auch für meine akademischen Kollegen einiges von Interesse enthält, da es neuere Forschungen russischer und westlicher Gelehrter zusammenführt und darüber hinaus einige tradierte Interpretationen hinterfragt. Das Buch bietet eine umfassende Darstellung der hauptsächlichen Ereignisse, Entwicklungen und Persönlichkeiten im ehemaligen russischen Imperium vom späten 19. Jahrhundert bis zum Beginn des ersten Fünfjahresplans und der Zwangskollektivierung von 1928/29, als Stalin die sowjetische Bevölkerung einer „Revolution von oben“ aussetzte. Ich möchte die drängenden Fragen beantworten, die Schüler, Studenten und all jene Leser interessieren, die etwas über die Vergangenheit lernen wollen. Warum versagte die zaristische Autokratie? Warum schlug der Versuch, nach der Februarrevolution von 1917 eine parlamentarische Demokratie zu errichten, fehl? Wie konnte es einer kleinen, radikalen sozialistischen Partei gelingen, an die Macht zu kommen und sich in einem grausamen Bürgerkrieg (1918–1921) zu behaupten? Wie kam Stalin an die Macht? Warum setzte er Ende der 1920er Jahre eine brutale Kollektivierungskampagne und die gewaltsame Industrialisierung in Gang? Zur Grundlegung dieser Ereignisse und Prozesse zielt das Buch darauf ab, Einsichten in das Wesen von Macht zu vermitteln, indem es zeigt, wie die Entschlossenheit, Herrschaft auf gewohnte Weise weiterzuführen, zum Zusammenbruch einer ganzen Gesellschaftsordnung führen kann, oder wie diejenigen, die eine bessere Gesellschaft schaffen wollen, durch ihren Willen, um jeden Preis an der Macht zu bleiben, korrumpiert werden.
All das sind in Ehren ergraute Themen, aber seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ist sehr viel Quellenmaterial verfügbar, das ein neues Licht auf die politische und soziale Geschichte dieser Periode wirft. Im Lauf der letzten 25 Jahre haben russische und westliche Historiker dieses Material genutzt, um alte Fragen einer Prüfung zu unterziehen, neue Fragen zu stellen und festgefügte Kategorien zu überdenken. Diese auf Archivmaterial beruhende Forschung will das Buch reflektieren und dem Leser einen Eindruck davon vermitteln, wie die geschichtswissenschaftlichen Interpretationen der Russischen Revolution sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt haben. Zugleich bedenkt es die Tatsache, dass diese Revolution weiterhin ein Thema ist, bei dem die Ansichten und Interpretationen der Historiker weit auseinandergehen. Sein Hauptzweck liegt jedoch darin, dem Leser eine weitgespannte Darstellung vom Zusammenbruch der zaristischen Autokratie und dem Aufstieg einer bolschewistischen Partei zu geben, wobei größere Aufmerksamkeit, als vor dem Zerfall der Sowjetunion möglich war, bestimmten Sachverhalten gewidmet wird: den imperialen und nationalen Dimensionen der Revolution, der Vielschichtigkeit der in den Bürgerkrieg verwickelten Kräfte, den Versuchen gemäßigter Sozialisten und anarchistischer Parteien, der von den Bolschewiki betriebenen Machtmonopolisierung Widerstand entgegenzusetzen, den von der Revolution bewirkten massiven wirtschaftlichen Leiden und Entbehrungen, dem Konflikt zwischen Kirche und Staat sowie den ökonomischen und sozialen Widersprüchen der Sowjetunion während der Phase der Neuen Ökonomischen Politik in den 1920er Jahren.
Bei Revolutionen geht es um den Zusammenbruch von Staaten, um den Wettstreit zwischen rivalisierenden Machtansprüchen und um den Aufbau einer neuen Staatsmacht. Von daher ist die Grundstruktur des Narrativs politischer Provenienz; sie reicht zurück bis zur Phase der Reformen Alexanders II. in den 1860er Jahren und vorwärts in die Zeit des Hochstalinismus der 1930er Jahre. Die Wahl dieses ausgedehnten Zeitrahmens ist dadurch bedingt, dass einige wichtige Entwicklungslinien beleuchtet werden sollen, die den revolutionären Bruch von 1917 überdauerten. Auf grundlegende Weise werden Entwicklungen im Hinblick auf das Zusammenspiel zwischen Zwängen äußerer (Geopolitik und Rivalitäten im internationalen Staatensystem) wie innerer Art (verursacht durch die Aushöhlung gesellschaftlicher Hierarchien mittels rapider wirtschaftlicher Modernisierung) analysiert. Nicht die Revolutionäre schaffen die Revolution – bestenfalls sind sie daran beteiligt, die Legitimität des bestehenden Regimes zu untergraben, indem sie die Vorstellung lancieren, eine bessere Welt sei möglich. Mithin widme ich den politischen Aktivitäten und Argumenten von Revolutionären vor 1917 weniger Aufmerksamkeit, als dies in manchen Standardgeschichtsschreibungen der Fall ist. Lenin selbst wusste genau, dass Revolutionäre erst dann aus der politischen Isolierung ausbrechen und den Versuch unternehmen können, breitere Massen für die Zerstörung der alten Ordnung zu mobilisieren, wenn die bestehende Ordnung von tiefen Krisen gebeutelt wird. Es gilt für praktisch alle sozialistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts, dass die alte Ordnung nicht durch eine Krise des kapitalistischen Systems ins Wanken geriet, sondern durch den imperialistischen Krieg, weshalb meine Darstellung den Krieg in besonderem Maße berücksichtigt.
Aus Gründen der Einfachheit habe ich bis jetzt die Bezeichnung „Russland“ verwendet, doch berücksichtigt das Buch neuere Forschungen, indem es die Revolution aus eurasischer Perspektive betrachtet und Zentralasien, dem Kaukasus, Sibirien und Fernost größere Aufmerksamkeit widmet als bislang üblich. Die jüngste Geschichtsschreibung der Revolution hat die Themen „Imperium“ und den Aufstieg des Nationalismus in den Fokus gerückt, die von mir entsprechend in die Darstellung einbezogen worden sind. Die Geschichte der Revolution ist der Dreh- und Angelpunkt der Desintegration und schließlichen Reintegration des Imperiums. In ihrem Kampf ums Überleben geriet den Bolschewiki zwischen 1918 und 1920 die Kontrolle über die meisten Gebiete außerhalb des russischen Kernlandes aus den Händen. Das betraf die Ukraine, den Kaukasus, das Baltikum und Zentralasien. Doch indem sie an nationalistische und antikolonialistische Gefühle appellierten, gelang es ihnen schließlich, das Imperium wieder zusammenzufügen. Ausnahmen waren Polen, Finnland, die baltische Küstenregion, die westlichen Gebiete der Ukraine und Weißrusslands sowie Bessarabien. Die politische Macht war in Russland immer in den Hauptstädten konzentriert – alle wichtigen Ereignisse, von denen in diesem Buch die Rede ist, fanden in St. Petersburg oder, nach der Verlagerung der Hauptstadt 1918, in Moskau statt. Die neuere Forschung hat sich aber auch mit den russischen Provinzen beschäftigt und dabei herausgefunden, auf welche Weise die Revolution von lokalen ökologischen, sozioökonomischen und ethnischen Strukturen geprägt wurde, und wie Konflikte in den ländlichen Bezirken und Provinzstädten ihren Ausgang beeinflussten. Um die Vielfalt der revolutionären Geschehnisse zu skizzieren, habe ich Beispiele aus peripheren Provinzen gewählt; damit wollte ich einer Interpretation der Revolution entgegentreten, die sich allzu sehr auf die Geschehnisse in den Hauptstädten konzentriert. Zudem ist seit den 1970er Jahren viel höchst innovative Forschung über die Geschichte der spätimperialen und revolutionären Epoche von Sozial- und, in neuester Zeit, Kulturhistorikern geleistet worden. Auch diese Erkenntnisse haben Eingang in das Buch gefunden.
Durch Revolutionen soll nicht nur ein neuer Staat geschaffen, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse von Grund auf transformiert werden. Anders als bei einem Militärputsch oder der Machtergreifung durch Diktatoren und Verschwörer schafft der völlige Zusammenbruch staatlicher Organisationsmacht in einer Revolution Raum für die Mobilisierung der Massen. Die Politik wird, mit anderen Worten, den Eliten und staatlichen Institutionen entwunden und zur Sache der Massen in Stadt und Land. So handelt dieses Buch von den Aktivitäten und Zielvorstellungen all jener Bauern, Arbeiter, Soldaten, nicht-russischer ethnischer Gruppen, Frauen und Jugendlichen, die die alte Ordnung stürzten, um eine neue zu errichten. 1905 und 1917 organisierten sich Millionen, um gegen die Unterdrückung vorzugehen. Sie wollten Gerechtigkeit, Gleichheit, politische Rechte erlangen und dem Krieg ein Ende bereiten. Eine Geschichte der Revolution muss also die Geschichte einer ganzen Gesellschaft im Aufruhr sein. Gewiss bilden politische Ereignisse das Fundament dieser Geschichte, doch widme ich sehr viel Aufmerksamkeit den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Veränderungen, die die politische Entwicklung formten, und ebenso geht es mir um die Art und Weise, auf die unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen von diesen Entwicklungen beeinflusst wurden und darauf reagierten.
Viel zu häufig noch findet die Bauernschaft, die große Mehrheit der Bevölkerung, in Darstellungen der Revolution nur marginale Beachtung, obwohl Bauern ihre vorrangigen Triebkräfte und Opfer waren. Sie litten unter der Zarenherrschaft, sie erhoben sich 1905 und 1917 gegen die alte ländliche Ordnung, sie schienen 1917/18 ihre uralten Träume verwirklichen zu können – und mussten dann doch die hauptsächlichen Kosten der sozioökonomischen Modernisierung tragen. Dennoch legten sie im Widerstand gegen die Pläne der Regierung auch eine beträchtliche Gewitztheit an den Tag, bis Stalin Ende der 1920er Jahre die gewaltsame Kollektivierung der Landwirtschaft durchführte. Eine Darstellung der Revolution in sozialgeschichtlicher Perspektive setzt einen Maßstab, anhand dessen die Aktivitäten der Reformer und Revolutionäre beurteilt werden können. Es lässt sich abschätzen, in welchem Maße sie auf drückende wirtschaftliche und soziale Probleme eingingen und wie angemessen und wirksam ihre diesbezüglichen politischen Aktivitäten waren. Letztlich lässt sich die Transformationskraft der Revolution, deren Auswirkungen höchst ungleichmäßig waren, nur an der Tiefe der Umgestaltung der sozialen und ökonomischen Ordnung bemessen.
Im letzten Vierteljahrhundert ist die Kulturgeschichte beträchtlich aufgeblüht, und dieses Buch ist bestrebt, einige ihrer Forschungsergebnisse einzubeziehen, indem es den Einfluss ökonomischer Veränderungen auf eingeschliffene kulturelle Strukturen, die entscheidende Bedeutung von Generationenkonflikten in der Revolution und die Bemühungen der Bolschewiki um die Durchsetzung der von ihnen so genannten „Kulturrevolution“ berücksichtigt. Als (illegitime) Kinder der Aufklärung verstanden sie die Revolution als Element des zivilisatorischen Fortschritts. In diesem Sinne glaubten sie an die Fähigkeit der Wissenschaft, für die Beseitigung des Mangels zu sorgen, und an die Fähigkeit vernünftiger sozialer Organisations- und Denkformen, die „zurückgebliebenen Massen“ von Religion und Aberglauben zu befreien. Die Bolschewiki schufen den ersten Staat in der Geschichte, der eine atheistische Gesellschaft einrichten sollte, und ihr Angriff auf die Kirche war ein Vorhaben, über das wir mittlerweile sehr viel mehr wissen. Insofern widmet sich das Buch dem Zusammenstoß zwischen radikaler kultureller Erneuerung und den überkommenen Glaubensformen und Einstellungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen besonders im religiösen Bereich. Paradoxerweise konnte sich das Regime nur festigen, indem es mit Glaubensformen und Praktiken, die es anfänglich heftig angegriffen hatte, den Kompromiss suchte oder gar manches davon sich aneignete.
Die Zentenarfeier der beiden Revolutionen von 1917 ereignet sich zu einer Zeit, in der weder die fortgeschrittenen kapitalistischen noch die Schwellenländer viel Sympathie für die Revolution zeigen. Zwar ist hier und da noch von „Revolution“ die Rede, doch handelt es sich dabei, wie Arno Mayer sagt, um „die Feier von ihrem Wesen nach unblutigen Revolutionen für Menschenrechte, Privateigentum und Marktkapitalismus“.2 Man könnte jetzt hinzufügen, dass selbst Revolutionen dieser Art – die „orange“ Revolution in der Ukraine, die Revolutionen in Osteuropa und im Kaukasus oder die „Arabellion“ – all jenen, die radikalen politischen und sozialen Wandel durch den Einsatz von Gewalt und die Mobilisierung von Massen bewirken wollen, nichts gebracht haben. Davon ist die Art und Weise, in der Historiker über vergangene Revolutionen schreiben, nicht unberührt geblieben.3 Im Westen sind Historiker stärker geneigt, 1917 als Initiation einer Gewaltspirale zu sehen, die zu den Schrecken des Stalinismus führte, statt als gescheiterten Versuch, eine bessere Welt zu schaffen. Für sie ist die Mobilisierung von Bauern, Soldaten und Arbeitern eher der Irrationalität und Aggression geschuldet, als der Empörung über Ungerechtigkeit oder dem Verlangen nach Freiheit. Betrachtet man die Oktoberrevolution vor dem Hintergrund des in den letzten hundert Jahren massiv angewachsenen Kapitalismus, scheint sie Russland in eine geschichtliche Sackgasse geführt zu haben: vom Kapitalismus zum Sozialismus und wieder zum Kapitalismus zurück. Betrachtet man sie aus der Perspektive von Wladimir Putins Russland, scheint sie in der politischen Kultur keine große Spur hinterlassen zu haben. Warum also sollte man sich nach einem Jahrhundert noch mit der Revolution beschäftigen?
Zum einen hat sie für die bestehende Ordnung die bis dato radikalste Herausforderung dargestellt, denn die Bolschewiki sahen sich verpfichtet, eine ihrer Anschauung nach auf Ausbeutung, Ungleichheit und Krieg beruhende Gesellschaft durch eine klassen- und staatslose zu ersetzen, die sie „Kommunismus“ nannten. Dieser Kommunismus à la Bolschewiki besitzt zwar im 21. Jahrhundert wenig Anziehungskraft, doch muss das nicht heißen, dass sich seine Reize für alle Zukunft erschöpft haben. So wie die Englische Revolution Schluss machte mit dem gottgegebenen Recht der Könige und die Französische Revolution die Idee eines durch Geburt privilegierten Adels beseitigte, könnte die Auffassung, soziale Hierarchie und sozioökonomische Ungleichheit seien keine Naturgegebenheiten, sich als Erbteil der Russischen Revolution erweisen. Der Kapitalismus hat den Staatssozialismus beerdigt, doch jene Herausforderung bleibt bestehen. Zum anderen ist Russland auch heute noch eine nicht zu vernachlässigende politische Macht, und wenn wir die Kombination aus Angst und Ehrgeiz verstehen wollen, aus der die russische Außenpolitik häufig sich speist, müssen wir ihre Geschichte kennen. Aus langfristiger Geschichtsperspektive gesehen währte der Staatssozialismus nur kurze Zeit, doch hatte die Sowjetunion enormen Einfluss auf die so wechselhafte Geschichte des 20. Jahrhunderts, was sich besonders deutlich im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg zeigt. Zum dritten schließlich können wir aus der Geschichte lernen, und die Geschichte der Russischen Revolution zeigt uns mit großem Nachdruck, wie Machtdurst, Gewaltverherrlichung und die Verachtung von Gesetz und Moral Projekte zugrunde richten können, die mit den hehrsten Idealen begannen.
***
Da sich dieses Buch an eine breitere Leserschaft richtet, habe ich mich bemüht, die Anmerkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Ich verweise auf die Quellen von Zitaten und Statistiken und ansonsten kurzgefasst auf die relevanten Texte zu einem bestimmten Thema. Hauptsächlich verweisen die Anmerkungen auf die von mir benutzte Literatur und auf einige der spezielleren Werke für den stärker am Detail interessierten Leser.
Wenn ich mich auf innerrussische Ereignisse beziehe, verwende ich bis zum 31. Januar 1918 den Kalender alten Stils, der dann von den Bolschewiki durch den Gregorianischen Kalender ersetzt wurde. Nun verschoben sich die Daten um 13 Tage auf den 14. Februar 1918, wodurch der russische Kalender Anschluss an die moderne Welt fand. Internationale Ereignisse sind jedoch (hauptsächlich in Bezug auf den Ersten Weltkrieg) gemäß dem Gregorianischen Kalender datiert. Die russischen Maße wurden ausnahmslos in metrische Einheiten umgewandelt.4
Karte 1: Der europäische Teil Russlands 1917/18
Karte 2: Die Weiße Armee 1919
Karte 3: Die Sowjetunion 1924