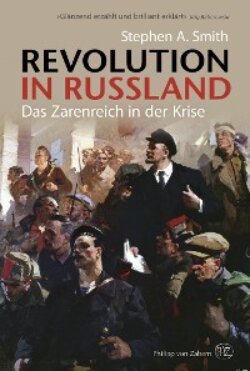Читать книгу Revolution in Russland - Stephen Smith - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Autokratie und Orthodoxie
ОглавлениеNikolaus II. bestieg 1894 den Thron. Er war ein zurückhaltender, ruhiger Mann, dessen Leben um Frau und Familie kreiste. Seine Tagebücher enthalten kaum etwas über Staatsangelegenheiten; man liest lakonische Bemerkungen über das Familienleben, seinen gesundheitlichen Zustand, die Jagd oder das Wetter.17 Nikolaus war davon überzeugt, dass Gott persönlich ihm die autokratische Macht verliehen habe, und er widerstand mit Nachdruck allen Versuchen, diese Macht durch Gesetzgebung oder Verfassung einzuschränken. Selbst nach der Verkündung des Oktobermanifests hieß es im Artikel eins des Grundgesetzes von 1906: „Der Kaiser von ganz Russland ist ein autokratischer und uneingeschränkter Monarch. Seiner obersten Autorität nicht nur aus Furcht, sondern dem Gewissen folgend zu gehorchen, ist Gottes eigenstes Gebot.“18 Nikolaus sah sich selbst als Vater, dessen Pflicht es war, sein Volk zu schützen. Einer gebildeten, aufgeklärten Gesellschaft stand er ablehnend gegenüber; stattdessen suchte er die Monarchie erneut zu sakralisieren. In seiner Vorstellung war er mit dem russischen Volk auf mystische Weise durch den Glauben und eine gemeinsame Geschichte verbunden. Immer stärker wurde sein Verlangen nach spiritueller Führung durch heilige Männer wie Grigori Rasputin, einen von der Bevölkerung verehrten Geistheiler, der ab 1906 am Zarenhof außerordentlichen Einfluss genoss. Die Regierungsbürokratie lehnte Nikolaus aus prinzipiellen Gründen ab, und seine Minister, die nicht mehr dem Adel oder dem Militär entstammten, hatten es schwer, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ganze System benötigte als Koordinator eine starke Führungspersönlichkeit, doch hatte Nikolaus nicht einmal ein eigenes Sekretariat zur Gewichtung der Probleme, die zu bewältigen waren.
Nikolaus II., Alexandra und Familie
Ungeachtet seiner vielfältig demonstrierten militärischen und administrativen Macht war der zaristische Staat strukturell schwach, wenngleich nicht ineffektiv. Die zentralistische Regierung verfügte über begrenzte Ressourcen an Material und Menschen, die Steuererträge waren gering, die Verwaltung nicht ausreichend besetzt und durch unklare Rechtsverhältnisse und Kompetenzbereiche sowie durch Korruption und Streit über Weisungsbefugnisse beeinträchtigt. Insbesondere unter Alexander II. (aber auch sonst im 19. Jahrhundert) hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass eine durchgreifende Verwaltungsreform notwendig sei, um die ständig wachsenden Anforderungen an die Regierung bewältigen und im Wettlauf mit konkurrierenden Mächten mithalten zu können. Es wurden Sonderkommissionen eingerichtet, die verwaltungstechnische Unfähigkeit, Korruption und fehlende Koordination zwischen Ministerien untersuchten. Berge von bedrucktem Papier wurden erzeugt, Projekte ins Leben gerufen und Gesetze verabschiedet. Alles verlief im Sande. Die zwei herausragendsten Minister unter Nikolaus II., Finanzminister Sergej Witte und Innenminister Pjotr Stolypin, waren von der Notwendigkeit einer Verwaltungsreform überzeugt. Witte glaubte, dass eine von Gesetzesherrschaft und rationaler Verwaltung geleitete Autokratie in der Lage sei, die Wirtschaft zu modernisieren und die soziale Stabilität zu gewährleisten. Stolypin wiederum hoffte nach der Revolution von 1905, dass der Monarch seine Autorität wiedererlangen und zugleich mit der neuen Duma zusammenarbeiten könne. Die „alte, polizeilich geregelte Ordnung“ sei, so erklärte er zuversichtlich, vorbei.19
Bisweilen ist die Autokratie einem Polizeistaat gleichgesetzt worden.20 Sicherlich war die Polizei rastlos damit beschäftigt, organisierte politische Opposition und öffentlichen Dissens zu unterdrücken. Wer in den Verdacht geriet, „aufrührerisch“ zu sein, hatte Gefängnishaft oder Verbannung nach Sibirien zu erwarten. Die Geheimpolizei des Zaren (die „Ochrana“) fing Briefe ab und schleuste Agenten in öffentliche Institutionen und Fabriken ein, wo sie regelmäßig Berichte über ungewöhnliche Aktivitäten und abweichende Meinungen verfassten. Auch die revolutionären Parteien waren mit Geheimagenten durchsetzt, während Hausmeister, Droschkenkutscher und andere geeignete Personen das Tun und Treiben der Bürger ausspionierten. Es gab ein straffes Zensurwesen (das jedoch nach der Revolution von 1905 verfiel) und energische, wenngleich nicht besonders wirkungsvolle Versuche, die Verbreitung radikaler Schriften zu verhindern. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Autokratie ein Polizeistaat war, ließe sich in der Tatsache erblicken, dass große Gebiete des Reichs per Notstandsverordnung regiert wurden: Am Vorabend der Revolution von 1905 galt in 70 Prozent der Regionen der Ausnahmezustand, und obwohl es während der Jahre der Reaktion einen Rückgang gab, befanden sich 1912 noch 2,3 Millionen Einwohner unter Kriegsrecht und 63,3 Millionen waren irgendeiner Form von „verstärkten Schutzmaßnahmen“ ausgesetzt.21
Mit Hilfe der Notstandsgesetze konnten Provinzgouverneure zur Aufrechterhaltung der Ordnung ihnen geeignet erscheinende Maßnahmen ergreifen. Allerdings will, wie der Historiker Peter Waldron bemerkt, die Delegierung solcher Machtbefugnis an die Gouverneure nicht recht zum Zentralismus passen, den man mit einem Polizeistaat in Verbindung bringt.22 Überdies ist augenfällig, wie schwach die Polizeikräfte tatsächlich waren: Bis in die 1890er Jahre waren sie unterhalb der Ebene der Verwaltungsbezirke die einzigen Repräsentanten der Regierung, doch musste um 1900 ein einzelner Landkonstabler mit der Unterstützung von ein paar Polizeibeamten niederen Ranges bis zu 2,6 Quadratkilometer und zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner überwachen.23 Da Polizisten sehr viel kostenträchtiger waren als Soldaten, ließ das Regime gefährlichere Aufruhrversuche durch die Armee niederschlagen. Insofern war die Regierungsgewalt im zaristischen Russland zu wenig durchschlagskräftig und die Bürokratie zu schwächlich, als dass von einem Polizeistaat à la Stalin gesprochen werden könnte.24
Mithin war der Einfluss des Zentralstaats in den Provinzen eher begrenzt. Ein Viertel der Regierungsausgaben kam der Verwaltung zugute (aber mehr als ein Drittel dem Militär), doch reichte die Macht des Zentrums nur bis zu den Toren der 89 Provinzhauptstädte, in denen die Gouverneure ihren Amtssitz hatten. Sie waren persönliche Repräsentanten des Zaren, unterstanden dem Innenministerium und genossen umfangreiche Machtbefugnisse.25 Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 sollte der Adel in den ländlichen Gebieten mit Hilfe der neuen Institution „Semstwo“ die Ordnung aufrechterhalten, doch hatte die Zentralregierung nur wenig Möglichkeiten zu garantieren, dass dies auch auf eine ihr genehme Weise geschah. Obwohl die Semstwos von Vertretern der verschiedenen Stände gewählt wurden, besaß der Adel die Vorherrschaft (74 Prozent der Mitglieder der Semstwos waren Adlige, obwohl der Adel nur 1,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte).26 Die Semstwos übernahmen einen weitgefassten Aufgabenbereich lokaler Regierungsfunktionen, so z.B. Erziehung und Bildung, Gesundheitsfürsorge, Landwirtschaft, tierärztliche Versorgung, Straßenbau usw. Allerdings gab es sie nur auf der Ebene der Provinzen und Bezirke, nicht aber auf der untersten Ebene städtischer Verwaltung. Ihre Blütezeit erfuhren sie in den Jahren bis zur Revolution von 1905, als sie auf politische Reformen drängten, doch erweiterten und professionalisierten sie ihre Funktionen bis 1918, wobei zwischen 1905 und 1914 ihr Haushalt um das Doppelte und die Anzahl der Beschäftigten um 150 Prozent zunahm. Nun war die Selbstverwaltung unterhalb der Provinzebene auch in Städten und Dörfern aktiv.
Auf der dörflichen Ebene hatte die Versammlung der Haushaltsvorstände, der sogenannte skod, dafür zu sorgen, dass die Dorfbewohner Steuern zahlten und die lokale Infrastruktur in Ordnung hielten. Dorfälteste sollten einen Vorsitzenden und Hilfskräfte wählen, um die Angelegenheiten der Ortschaft – u.a. Besteuerung, Erziehung und Bildung, karitative Maßnahmen – zu regeln und als Richter am Ortsgericht zu wirken, wo sie gemäß dem Gewohnheitsrecht die Hauptmasse der bäuerlichen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden hatten. 1889 rief Alexander III. die Institution des Landhauptmanns ins Leben, der die Aktivitäten der Orts- und Dorfversammlungen kontrollieren sollte. Dieser Beamte hatte die Befugnis, in bestimmten Zivil- und geringeren Kriminalprozessen, die zuvor von den gewählten Repräsentanten der Bauern entschieden worden waren, als Richter zu wirken. Er galt als personifizierter Vertreter der Autokratie und wurde deshalb häufig geschmäht.27
Eine unverzichtbare Säule des zaristischen Staats war die Russisch-Orthodoxe Kirche. Peter der Große hatte sie dem Staat unterstellt, und sie wurde vom Heiligen Synod, einer Abteilung der Bürokratie, verwaltet, von dem sie auch ihr Jahresbudget empfing. Von 1880 bis 1905 war Konstantin Pobedoszew, ein berüchtigter Reaktionär, Prokurator des Heiligen Synod. Mutmaßlich gehörten 70 Prozent der Reichsbevölkerung der Orthodoxen Kirche an, und 1914 gab es im gesamten Reich in den überwiegend russischen Diözesen 40.437 Pfarrkirchen mit 50.105 Dekanen und Priestern, 21.330 Mönchen und Novizen sowie 73.299 Nonnen und Novizinnen.28 Die Kirche besaß mehr als drei Millionen Hektar Land und ein Drittel aller Grundschulen. Ferner gab es noch zahlenmäßig umfangreiche religiöse Minderheiten, wie etwa Angehörige der römisch-katholischen Kirche in Polen und Litauen, Protestanten in Lettland und Estland, Moslems im Kaukasus und in Zentralasien sowie Juden in den westlichen Provinzen. In der Ukraine gehörten die Bewohner überwiegend der Orthodoxen Kirche an, aber es gab eine größere Gemeinde von Uniaten, die orthodoxe Riten praktizierte, aber den Papst als religiöse Autorität anerkannte. Nur der Orthodoxen Kirche war es gestattet, zu missionieren, und wer sie verlassen wollte, um zu konvertieren, konnte wegen Apostasie strafrechtlich belangt werden.
Mithin war die Orthodoxe Kirche nicht einfach nur ein Organ des Staats; auch war sie nicht so unnachgiebig und unbeweglich, wie bisweilen angenommen.29 Die theologische Ausbildung des Klerus verbesserte sich im 19. Jahrhundert, das Mönchtum erfuhr eine Neubelebung, ebenso die Institution der Starzen, der „Spirituellen Ältesten“. In den größer werdenden Städten wurden Missionen für die arbeitende Bevölkerung geschaffen, während es sich als schwierig erwies, zahlenmäßig starke Pfarrgemeinden einzurichten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Kirche erfolgreich bei der Förderung einer Temperenzbewegung für die Stadtbevölkerung, und einige jüngere Priester, die bei den Armen tätig waren, äußerten immer vernehmlicher ihre Kritik am Status quo.30 Dennoch sah die Kirche den Säkularismus der Intellektuellen, die wachsende Bürgerrechtsbewegung, den Aufstieg des Sozialismus und die aus den ländlichen Gemeinden stammende Beobachtung, dass das Landleben durch Arbeitsmigranten, die in ihre Dörfer zurückkehrten, korrumpiert wurde, mit großem Unbehagen. Die Revolution von 1905 trieb die innerkirchlichen Spannungen auf ihren Höhepunkt, und die Beziehung zwischen Kirche und Staat geriet unter großen Druck.