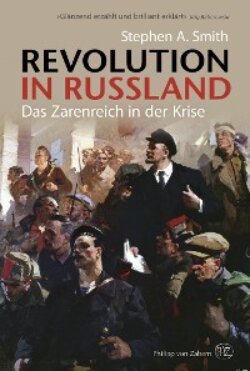Читать книгу Revolution in Russland - Stephen Smith - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Erste Weltkrieg
ОглавлениеAm 28. Juni 1914 wurde der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajewo von einem bosnischen Serben erschossen, und das war der Funke, der das Pulverfass namens Balkan zur Explosion brachte.63 In Angst vor den Gefahren eines slawischen Nationalismus erblickte Österreich in der Ermordung des Thronfolgers die Möglichkeit, die serbischen Ambitionen ein für alle Mal auszumerzen. Da Österreich nicht mehr in der ersten Reihe der Großmächte mitspielte, rechnete es damit, dass es das Risiko eines umfassenden Kriegs eingehen könnte, solange Deutschland an seiner Seite blieb. Deutschland wiederum wollte Österreich unterstützen, damit Russland nicht noch weiter aufrüsten und deutsche Expansionsgelüste bezüglich Osteuropa durchkreuzen könnte. Als Russland drohte, gegen Österreich die Mobilmachung auszurufen, erklärte Deutschland dies zu einem hinreichenden Kriegsgrund.
Am 26. Juli befahl Nikolaus den Militärdistrikten im europäischen Russland die Teilmobilmachung, und zwei Tage später erklärte Österreich Serbien den Krieg. Die russische Mobilisierung wiederum veranlasste Deutschland dazu, am 1. August den Krieg zu erklären. Da man deutscherseits eine Einkreisung fürchtete und den Plan verfolgte, zuerst Frankreich, den Verbündeten Russlands, zu besiegen, ehe Russland selbst aufs Korn genommen wurde, schickte die deutsche Regierung noch am selben Tag Belgien ein Ultimatum, in dem es den Durchmarsch durch das Land forderte, um Frankreich angreifen zu können. Als am 4. August deutsche Truppen die Grenze nach Belgien überschritten und damit die Neutralität des Landes verletzten, erklärte Großbritannien am 4. August (als Bündnispartner Frankreichs mit leichter Verspätung) den Krieg. Alle Beteiligten behaupteten, nur aus Verteidigungsgründen zu handeln, waren aber de facto darauf aus, den Krieg zur Verfolgung weiterer imperialer Zwecke zu nutzen. Nachdem auch das Osmanische Reich in den Krieg eingetreten war, setzte Russland darauf, sich den Bosporus als Kriegsgewinn zu sichern, und 1915 erhoben die Kadetten und Oktobristen in der Duma zusätzlich Ansprüche auf das von Österreich regierte Galizien und auf größere Gebiete Anatoliens.
Diese Manöver waren das Vorspiel zu einer Kriegführung bislang unbekannten Ausmaßes. Die Fähigkeit der Staaten, massenhaft Menschen und Material mobilisieren zu können, war dabei ebenso entscheidend wie Erfolge auf dem Schlachtfeld. Der Krieg entfesselte Vernichtungskräfte und forderte Opfer ohnegleichen; in seinen Blutbädern ertrank der Glaube des 19. Jahrhunderts an Fortschritt und Zivilisation. Von ungefähr 65 Millionen Kombattanten starben zwischen 8 und 10 Millionen, 21 Millionen wurden verwundet und 5 bis 6 Millionen Zivilisten verloren ihr Leben.64 Russland trug einen ernormen Teil der militärischen Lasten. Bei Kriegsende waren seine Streitkräfte achteinhalbmal größer als vor dem Krieg (die deutschen waren um das Neunfache, die österreichischen um das Achtfache und die französischen um das Fünffache gestiegen). Im Juni 1917 waren von 531 Divisionen der Alliierten 288 russisch.65
Trotz der Petersburger Barrikaden wurden die Arbeiteraufstände durch die Kriegserklärung ausgebremst. Eine Welle von Patriotismus erfasste die russische Gesellschaft. Am 20. Juli versammelte sich eine riesige Menge an den Ufern der Newa in St. Petersburg. Alle warteten auf die Ankunft der Jacht des Zaren, die Nikolaus, Alexandra und ihre Töchter herbringen sollte (der Zarewitsch war krank). Die beiden in der Flussmündung ankernden Dreadnoughts (Schlachtschiffe) Gangut und Sewastopol feuerten Salven ab, als die Jacht in Sicht kam. Die kaiserliche Familie stieg um in eine Dampfbarkasse, die sie unter dem Kanonendonner, der von der Festung Peter und Paul herüberdröhnte, zum Winterpalais brachte. Die Menge geriet in Verzückung, viele fielen auf die Knie, brachen in Hurrarufe aus und sangen die Nationalhymne „Gott schütze den Zaren“. Im Malachitsaal des Winterpalais unterzeichnete der Zar die Kriegserklärung, die verkündete: „In dieser schrecklichen Stunde der Prüfung sei aller innere Zwist vergessen. Möge die Einheit zwischen Zar und Volk noch stärker werden, und möge Russland, zur Einheit erhoben, den unverschämten Angriff des Feindes zurückweisen.“66 Es war ein Augenblick von so intensivem wie kurzlebigem Patriotismus.
In der dritten Augustwoche 1914 stießen die Erste und Zweite Armee nach Ostpreußen vor. Sie waren schlecht organisiert, behindert durch fehlende Nachschublinien und mangelhafte Kommunikation mit dem Hauptquartier, der Stawka. Die Deutschen siegten in der Schlacht von Tannenberg (26.–30. August) und an den Masurischen Seen (7.–14. September), wobei sie über 250.000 russische Kriegsgefangene machten. Im weiteren Verlauf des Jahres erlitten die Russen bei einer Reihe blutiger Schlachten in Polen weitere Verluste, doch zeigte sich auch, dass die deutschen Heere nicht in der Lage waren, sehr weit über die Endbahnhöfe hinaus vorzustoßen.67 An der Südwest-Front, wo Russland den Krieg gegen Österreich-Ungarn mit der Invasion von Galizien am 20. August begann, liefen die Dinge besser. Anfänglich war Österreich im Vorteil, aber die Russen konnten schon bald Galiziens Hauptstadt Lemberg (Lwiw/Lwów) erobern und die große Festung bei Przemy´sl belagern. Österreichische Versuche vom Januar und Februar, die Festung zu entsetzen, schlugen fehl; es gab Verluste in Höhe von 800.000 Mann, hauptsächlich durch Krankheiten. Am 22. März 1915 ergab sich die Besatzung (120.000 Mann) der russischen Armee. Diese richtete rasch eine Verwaltung in Galizien ein, die ein Programm gewaltsamer Russifizierung und antisemitischer Tätigkeiten durchführte. N. A. Wassili, der Leiter des diplomatischen Stabes bei der Stawka, erklärte, dass „russische Bauern“ die „Befreiung von jüdischer Unterdrückung“ begrüßen würden.68
An allen Fronten wurden militärisch besetzte Zonen mitsamt weiten Territorien hinter der Front unter Kriegsrecht gestellt. Befehlshaber auf unterschiedlichen Ebenen erließen Verordnungen zur Stärkung der Sicherheit, Festsetzung von Preisen, Handelsverboten und Requirierung von Arbeitskräften. Außerdem stachelten sie zu Pogromen gegen Juden auf, da diese ihrer Meinung nach sich vor dem Kriegsdienst drückten und nicht die russischen Werte besäßen.69 Anfang Mai jedoch unternahmen Deutschland und Österreich mit vereinten Kräften den Versuch, Galizien zurückzuerobern. In nur sechs Tagen gerieten 140.000 russische Soldaten in Gefangenschaft, sodass die Stawka sich am 20. Juni gezwungen sah, die Räumung der Region anzuordnen. Dann führten die Zentralmächte einen Angriff mit drei Heeressäulen durch, indem sie zum Narew, einem Fluss in Nordostpolen, und nach Kurland in Westlettland vorstießen. Bis zum September dauerte die Offensive, in deren Verlauf die Deutschen Polen, Litauen und große Teile Weißrusslands besetzten.
Der Rückzug der russischen Armee geriet zur Flucht. Frontkommandeure befahlen die Verbrennung von Feldfrüchten und anderem Besitz in den Tausenden von Quadratkilometern, die evakuiert werden mussten; hinzu kam die Zwangsaussiedlung von mindestens einer Million Zivilisten, damit sie nicht von den Deutschen eingezogen werden konnten. An die 67 Millionen lebten nun in vom Feind besetzten Gebieten. Als auch das Baltikum an die Deutschen fiel, wurde etwa eine Million Zivilisten nach Mittelrussland deportiert, und die russische Armee zog ungefähr 300.000 Litauer, Letten und Esten ein.70 1917 gab es etwa sechs Millionen Flüchtlinge, darunter eine halbe Million Juden, die aus den Frontgebieten vertrieben worden waren.71 Mindestens eine Million Mann gerieten in Gefangenschaft, eine weitere Million wurden getötet oder verwundet, doch die Verteidigungsfähigkeit der russischen Armee war ungebrochen.
Nachdem die russische Schwarzmeerflotte bei Odessa angegriffen worden war, erklärte Russland am 1. November 1914 dem Osmanischen Reich den Krieg. Für Russland war die Kaukasus-Front immer von zweitrangiger Bedeutung gegenüber der Ostfront, und der zermürbende Feldzug gegen die osmanischen Streitkräfte zeigte nur geringe Entschlossenheit. Dagegen war Ismail Enver Pascha entschieden darauf aus, Batum und Kars zurückzuerobern, die im Krieg von 1877/78 an Russland gefallen waren. Außerdem wollte er Georgien erobern und den an Ölfeldern reichen Nordwesten Persiens besetzen. Die Osmanen wollten die panislamische Karte spielen und lieferten den Russen im Kaukasus und in Persien, wo diese sich abmühten, um den Zusammenschluss mit britischen Streitkräften zu erreichen, erbitterte Schlachten.
Während des grausam kalten Winters 1914/15 wurden Enver Paschas Streitkräfte zu weit auseinandergezogen und erlitten in der Schlacht von Sarikamisch eine vernichtende Niederlage. Die geschlagenen Türken machten dafür den Verrat von Armeniern verantwortlich, denn die Russen hatten Anfang 1915 armenische Freiwilligenkorps zu Sabotageakten gegen die türkische Armee motiviert, und der armenische Widerstand weitete sich im April 1915 bei Van zu einem veritablen Aufstand aus. Das Komitee für Einheit und Fortschritt [eine Partei der Bewegung der Jungtürken; d. Ü.] ordnete daraufhin die massenhafte Deportation der gesamten armenischen Bevölkerung an. Wahrscheinlich mehr als eine Million Armenier wurden umgebracht oder starben auf dem Marsch nach Syrien und dem Irak.72 Im späteren Kriegsverlauf fanden die Kämpfe zumeist in einem großen Gebiet um den Vansee in Ostanatolien statt, wo sich General N. N. Judenitsch, der später die antibolschewistischen Streitkräfte in Nordwest-Russland befehligte, als fähiger Kommandeur erwies. Allmählich gewannen die russischen Truppen die Oberhand über tapfer kämpfende Osmanen, die besonders im Winter 1916/17 schreckliche Verluste erlitten, aber unbesiegt blieben. Noch im November 1918 stand das osmanische Heer im Kampf.73
Wie viel Mann die Streitkräfte im Juli 1914 umfassten, ist nicht gewiss – vielleicht 1,4 Millionen, und die Mobilisierung von Reservisten ließ die Zahl bald auf mehr als das Doppelte anschwellen. 1917 waren es, inklusive Reservisten, Garnisonsbesatzungen in der Etappe und Verwaltungsstäben, an die 9 Millionen (von denen nur 27 Prozent Kampftruppen waren).74 Insgesamt wurden an die 16 Millionen Russen für die Streitkräfte mobilisiert. Frauen waren vom Militärdienst ausgeschlossen, doch gelang es möglicherweise etwa 5000 Frauen, als Männer verkleidet an Kriegsoperationen teilzunehmen. Ein Beispiel dafür ist A. A. Krassilnikowa, die 20-jährige Tochter eines Minenarbeiters, die für ihre Tapferkeit das Georgskreuz erhielt. Ansonsten dienten Frauen an der Front vorwiegend als Krankenschwestern und -pflegerinnen. In der Etappe organisierten das Rote Kreuz, Semstwos und ärztliche Verbände Ausbildungskurse für Krankenschwestern, deren Entlohnung übrigens recht attraktiv war. Die Zarentöchter dienten als Verwalterinnen von Militärkrankenhäusern und waren auf Pressefotos in der Tracht von Krankenschwestern zu sehen. Insgesamt waren 2255 Einrichtungen des russischen Roten Kreuzes an den Fronten tätig; dazu gehörten 149 Krankenhäuser mit 46.000 Betten, für die 2450 Ärzte und 20.000 Krankenschwestern zuständig waren. Hinter den Frontlinien gab es 736 lokale Komitees, 112 Krankenschwesternverbände und 80 Krankenhäuser – eine viel zu geringe Anzahl für eine so große Armee.75
Von allen kriegstoten russischen Soldaten war die Hälfte bereits im ersten Kriegsjahr gefallen. Wie weit dies auf mangelnde Führungsqualitäten der Kommandeure oder auf die Unfähigkeit der Regierung, die Wirtschaft in den Dienst der Kriegsanstrengungen zu stellen, zurückzuführen ist, bleibt umstritten. Auf jeden Fall litten im Verlauf der deutschen Offensive vom Sommer 1915 die russischen Truppen akuten Mangel an Granaten, und bisweilen fehlten den Soldaten sogar Gewehre und Uniformen. Die Generäle machten dafür die Inkompetenz der Zivilverwaltung verantwortlich, aber auch in anderen Ländern gab es vergleichbare Knappheiten, weil die mögliche Dauer des Krieges weit unterschätzt worden war. Zweifellos lagen die Ursachen für die grauenhaft hohen Verluste im ersten Kriegsjahr in schlechter militärischer Führung sowie der mangelnder Fähigkeit des Kriegsministeriums, vor allem, wenn man diese Minderleistungen mit den überlegenen Qualitäten der Heeresleitung und Verwaltung der deutschen Streitkräfte vergleicht. Die Stawka war durch uneindeutige Rechtsprechungsverhältnisse gelähmt, und der Oberkommandierende, Großherzog Nikolai Nikolajewitsch, ein 58 Jahre alter Kavalleriegeneral und entfernter Vetter von Nikolaus II., hatte zwar bewundernswerte vergangene Erfolge zu verzeichnen, erwies sich jetzt jedoch als keineswegs brillanter Stratege. Im August 1915 wurde er abberufen, und nun übernahm der Zar selbst das Kommando, wobei die Befehlsgewalt de facto in den Händen von General Michail Alexejew lag. Allerdings sollte man die verheerenden Niederlagen der russischen Armee im ersten Kriegsjahr nicht überbewerten. Sicher hatten die Deutschen mit ihr in operativer wie taktischer Hinsicht leichtes Spiel, doch kämpfte sie mit großer Tapferkeit gegen die Osmanen und die Österreicher.76
1916 war der Mangel an Granaten behoben, und am 4. Juni startete General Alexei Brussilow entlang einer fast 500 Kilometer langen Front im Südwesten eine brillante Offensive. Sie war Teil einer koordinierten Strategie der Alliierten und erbrachte den Beweis, dass Russland immer noch ein geschätzter Bündnispartner war. Im Gegensatz zu den verlustreichen Schlachten der Alliierten an der Somme und bei Verdun konnte die Brussilow-Offensive der österreichisch-ungarischen Armee gravierende Verluste beibringen. Sie verlor ein Drittel ihrer Streitkräfte und stand kurz vor dem Zusammenbruch. Als russische Truppen Galizien zum zweiten Mal besetzten, wurden Militärs und Beamte ermahnt, nichts gegen die ukrainische Sprache oder die Kirche der Uniaten zu unternehmen, wie es bei der ersten Besatzung geschehen war. Doch schon bald brachten deutsche Verstärkungstruppen Brussilows Offensive zum Halt, so dass die russischen Bemühungen, so umfangreich und kostspielig sie auch gewesen waren, ohne greifbare Erfolge blieben. Brussilows anfängliche Siege hatten Ende August Rumänien dazu bewegen können, sich den Alliierten anzuschließen, doch brach die rumänische Armee sehr bald zusammen, wodurch es den Zentralmächten gelang, den größten Teil des Landes zu besetzen. Damit wurden die Probleme der russischen Armee nicht geringer, denn nun mussten sie eine weitere Front eröffnen und im November und Dezember 47 Divisionen an die rumänische Grenze im Süden verlegen. Bei Verlusten von mehr als einer halben Million Soldaten fiel die Kampfmoral in den Keller.77
Die Notwendigkeit, Tote, Verwundete und Gefangene zu ersetzen, löste in Zentralasien einen umfassenden Aufstand aus. Die unter Witte und Stolypin geförderte Ansiedlung von Russen führte zu wachsenden Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung, zu Auseinandersetzungen über Land- und Wasserrechte, da der intensive Baumwollanbau die Bewässerung aus dem Ferghana-Tal benötigte. 1914 blieb den Männern von Turkestan die Einberufung zur Armee noch erspart, doch am 25. Juni 1916 verkündete die Regierung, dass 390.000 Kasachen und Kirgisen eingezogen würden, um Verteidigungsanlagen in Frontgebieten zu bauen. Muslimische Geistliche reagierten mit großer Empörung und wiesen warnend darauf hin, dass die Wehrdienstverpflichteten zum Kampf gegen ihre muslimischen Glaubensbrüder an der Kaukasusfront ins Feld geschickt würden. Und während sie so fern der Heimat wären, könnte man ihr Land konfiszieren und russischen Siedlern übereignen. Der einheimische Widerstand verübte Anschläge auf Eisenbahnlinien und Telegrafenverbindungen, brannte Garnisonen nieder und verwüstete Regierungsgebäude. Oberst P. P. Iwanow, später Befehlshaber der antibolschewistischen Streitkräfte in Sibirien, ging unnachsichtig gegen die Aufständischen vor: Russische Soldaten und Siedler massakrierten die einheimische Bevölkerung und vergewaltigten die Frauen. Mindestens 88.000 Rebellen fanden den Tod, während 250.000 aus Semiretschje (dem Siebenstromland) nach China flohen.78
Gegen Ende 1916 ging es mit der Kampfmoral der russischen Streitkräfte bergab. Während des Kriegs schickten die Soldaten Millionen von Briefen an ihre Familien daheim, Briefe, die von den Zensoren genutzt wurden, um Berichte über die Stimmung an diversen Fronten und in unterschiedlichen Divisionen zu verfassen. Im Allgemeinen hieß es noch in der zweiten Hälfte des Jahres 1916, als die Brussilow-Offensive zu einem Halt gekommen war, die Soldaten seien „frohgestimmt“.79 Mehr als 80 Prozent der Soldaten waren bäuerlicher Herkunft, doch schätzungsweise 70 Prozent konnten einigermaßen lesen und schreiben.80 Eine Untersuchung ihrer Briefe zeigt, dass ihr Patriotismus – in dessen Mittelpunkt die Liebe zu ihrem „grünen und glücklichen“ Dorf stand – von Herzen kam, aber sicher nichts mit dem Zaren zu tun hatte oder mit dem Gefühl, dass Russland für eine gerechte Sache kämpfe. Die widersprüchlichen Elemente dieses Patriotismus verdeutlicht ein Brief vom 25. August 1916, dessen Verfasser dem 210. Infanterieregiment angehörte, das aus Bronnizy in der Provinz Moskau stammte.
„[Die Deutschen] haben mit einer ganzen Wolke aus Kanonenschüssen ein Höllenfeuer entfacht und die Schützengräben in Schutt gelegt. Auf dem Boden kann man nirgendwo mehr stehen. Sie haben uns alle getroffen. Aber wir erfüllten unsere Pflicht und ließen sie nicht nach Wilna durchkommen. Ich glaube, wenn alle Truppen so standhaft wären wie wir, also wie es unsere Division tat, wäre keine Befestigung aufgegeben worden, und das wäre für den Feind eine echte Prüfung gewesen. Aber unsere Verstärkungen haben fast kampflos aufgegeben. Was können wir denn noch tun? Unsere Hüte abnehmen und dem Kaiser sagen: Bitte hier entlang? … Wir haben einen Offizier, zehn Deutsche und zwei Maschinengewehre in unsere Gewalt gebracht, und sie haben uns gesagt: ‚Ihr Russen tut uns leid. Warum haltet ihr noch den Kopf hin, wenn ihr sowieso schon uns gehört?‘ Das haben die Gefangenen uns direkt ins Gesicht gesagt. ‚Ihr seid schon vor langer Zeit verkauft worden. Wir haben Russland mit dem Geld der deutschen Banken gekauft.‘ Die Moral unserer Streitkräfte ist tief gesunken, und ganze Bataillone mitsamt ihren Offizieren haben sich den Deutschen ergeben. Sie werfen ihre Gewehre weg, heben die Hände und laufen zu den Deutschen hinüber, um Kaffee zu trinken.“81
Solche Gefühle waren vermutlich weit verbreitet: Stolz auf das eigene Regiment, das seine Pflicht ehrenvoll erfüllt, Abscheu vor der (wirklichen oder phantasierten) Feigheit anderer Einheiten der eigenen Truppen, widerwillige Bewunderung für die Deutschen, und der Verdacht, dass Russlands Herrscher bei deutschen Bankiers tief in der Kreide stehen. Derart vielschichtige Haltungen mit ihrer Mischung aus hartleibigem Realismus und einem Hauch von Klassenbewusstsein sprachen nicht für ein völliges Fehlen nationaler Identität.82 Aber der Patriotismus konzentrierte sich auf Familie, Heimat und den bäuerlichen Hof – jenen Mikrokosmos der Nation, den sie ihrem Gefühl nach gegen den Feind verteidigten.83
Es war weit verbreitet, die militärischen Qualitäten der russischen und deutschen Soldaten miteinander zu vergleichen, was immer zuungunsten ersterer ausfiel. L. N. Woitolowski, Sozialdemokrat, Psychiater und Redakteur der Literaturseiten der liberalen Zeitung Kiewer Ansichten, äußerte sich, bevor er seinen militärischen Dienst antrat, entsprechend:
„Bei den Deutschen gibt es militärische Festigkeit, Disziplin und Feldlager; bei uns Sorglosigkeit, Lagerfeuer und die Trägheit, die man auf tschumakischen Zeltplätzen findet [Tschumaken waren reisende Händler in der Südukraine; d. Ü.]. Die Deutschen sind kampfentschlossen, bei uns dagegen herrschen Tagträumerei, Gesinge und Sehnsucht.“84
Solche Ansichten sind mit Vorsicht zu genießen. Sie bieten die übliche Begründung dafür, dass mehr als 3,3 Millionen russischer Soldaten in deutsche und österreichische Kriegsgefangenschaft gerieten, also jeder fünfte, und das war ein viel höherer Prozentsatz als bei den Streitkräften anderer Nationen.85 Doch gab es viele Schlachten, in denen sich russische Soldaten tapfer schlugen, und zu Beginn des Kriegs 1914 und dann wieder 1916, als die Kämpfe an der Westfront (Somme und Verdun) tobten, zwangen russische Erfolge Deutschland zur Verlegung von Truppen in den Osten, die in Frankreich dringend gebraucht worden wären. Die hohen Verluste und die große Zahl an Kriegsgefangenen lassen sich wohl eher darauf zurückführen, dass der Krieg im Osten viel mobiler war als an der Westfront. Im Osten setzten die Generäle auf kostspielige Feldzüge, Kavallerie- und Großangriffe.86
Im Winter 1916 wuchs die Kriegsmüdigkeit in Heer und Marine, und der Wunsch nach Beendigung der Kämpfe wurde übermächtig. Immer häufiger beschwerten sich die Soldaten in ihren Briefen über mangelhafte Nahrungsversorgung, unzureichende Fußbekleidung und zu wenig Fronturlaub. Ebenso häuften sich anklagende Hinweise auf die Schrecken des Kriegs wie etwa Artillerieangriffe („der Körper erstarrt und die Seele stirbt“), Gasangriffe und die skandalöse Behandlung der Verwundeten. Ferner mehrte sich die Kritik an der Zivilbevölkerung, die besonders (wenn auch nicht ausschließlich) die privilegierten Klassen betraf und den Zivilisten zum Vorwurf machte, das Leiden der Soldaten an den Schrecken des Kriegs nicht nachvollziehen zu können.87 Zweifellos mussten die Streitkräfte enorme Opfer bringen. Die Angaben über die Anzahl der Gefallenen variieren außerordentlich, aber gut untermauerte Schätzungen sprechen von 1,89 Millionen Kriegstoten, und wenn man durch Gefangenschaft, Krankheit und Unfall verursachte Todesfälle hinzurechnet, kommt man auf die überwältigende Zahl von 2,25 Millionen.88
Zwar gab es Mutmaßungen, dass die russischen Streitkräfte relativ zur Anzahl der mobilisierten Soldaten, des Umfangs der männlichen Arbeiterschaft und der Bevölkerung insgesamt geringere Verluste erlitten haben könnten als andere kriegführende Länder.89 Wenn man jedoch die Gesamtzahl der Kriegstoten zusammen mit den Zahlen für Verwundete, Kranke, Gastote und schließlich Kriegsgefangene berechnet, kommt man auf 60,3 Prozent der Gesamtzahl an Kombattanten in der Armee, verglichen mit 59,3 Prozent für Deutschland, 55,9 Prozent für Frankreich, 54,2 Prozent für Österreich-Ungarn und 53,3 Prozent für die Türkei.90 Lässt man diese entsetzlichen Zahlen einmal beiseite, ist entscheidend, dass nicht der Zusammenbruch der Kampfmoral bei den Streitkräften das Ende des Zarentums herbeiführte – trotz wachsender Kriegsmüdigkeit blieb die Disziplin noch im Winter 1916/17 bemerkenswert hoch –, sondern akuter Unmut an der Heimatfront.