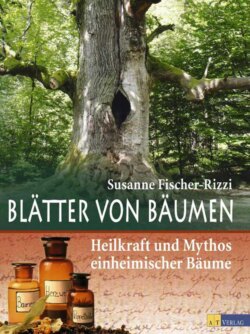Читать книгу Blätter von Bäumen - Susanne Fischer-Rizzi - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Apfelbaum
ОглавлениеMalus communis
Familie der Rosengewächse, Rosaceae
»Der Apffelbaum ist allenthalben jederman wohl bekandt / es seyn aber desselbigen so viel und mancherley Geschlecht / dass es unmuglich ist / dieselbige alle zu erzehlen und zu beschreiben / wie dann unser Author derselbigen sehr viel hat abreissen lassen / welche allzumal mit ihrem Namen beschrieben seyn / davon in gemein soll gehandelt werden.«
So stöhnt schon 1731 Tabernaemontanus in seinem Kräuterbuch über die Vielzahl der Apfelbaumsorten, die er beschreiben soll. Heute würde er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn die Aufzählung könnte ein ganzes Buch füllen. Es gibt inzwischen über tausend Sorten, die aus vielen Kreuz- und Querzüchtungen entstanden sind.
Der gemeinsame Stammvater aller Apfelbäume ist der wilde Holzapfelbaum. Er ist ein Bestandteil der Laub- und Kiefernwälder Europas und Asiens. Hauptsächlich ist er jedoch in Südosteuropa verbreitet. Wie alle wilden Arten unserer Obstbäume besiedelt er die lichte Waldrandzone, denn seine Blüten benötigen genügend Licht zu ihrer Entfaltung.
Noch heute, als Obstbaum im Garten, bildet er nicht gern einen hoch gewachsenen Stamm, sondern es liegt ihm mehr an der Ausbildung einer dicht verzweigten Krone. Diese rundliche Gestalt der Apfelbaumkrone spiegelt sich in der Form der kugeligen Äpfel. Das Gleiche kann man übrigens auch beim Birnbaum beobachten: Die längliche Form der Krone entspricht der tropfenförmigen Birnenfrucht. So folgen beide, Baum und Frucht, derselben formenden Schwingung.
Die wilde Form des Apfelbaums ähnelt noch sehr einem zerzausten Strauch, der sich deshalb auch gut zur Heckenbepflanzung eignet. Im Frühjahr, wenn die schönen Blüten an den Zweigen stehen, wirkt der Wildling gezähmt. Seiner Äpfelchen wegen wird er wieder vermehrt in den Wäldern angepflanzt, denn sie sind ein willkommenes Wildfutter. Die Menschen aber kann er nicht so leicht zum Hineinbeißen verführen, denn ihr Geschmack ist sehr sauer und zusammenziehend. Die drei bis fünf Zentimeter großen Holzäpfel scheinen auch eher in eine Puppenstube als in die Hand eines ausgewachsenen Menschen zu passen.
Die Germanen kannten nur diese kleinen Holzäpfel, bevor sie zum ersten Mal in einen »richtigen« Apfel beißen konnten. Diesen brachten ihnen die Römer, die in ihren Gärten in den germanischen Provinzen auf nichts verzichten wollten. Diese veredelten Apfelbäume waren vor langer Zeit irgendwo in Asien gezogen worden. Erste Kulturformen gibt es seit der Antike. Wann und wer diese kunstvolle Arbeit getan hatte, ist nicht mehr herauszufinden.
Die Germanen übertrugen den Namen ihres Holzapfels auf den neuen Apfel der Römer. Das war bei ihnen sonst nicht üblich; meist germanisierten sie das lateinische Wort, das die neue Obstart bezeichnete. So ist die Bezeichnung Apfel ein sehr altes Wort, das sich weit zurückverfolgen lässt. Neben den tausenderlei Apfelsorten gibt es noch so manchen »Apfel«, der nicht unbedingt genießbar ist: Augapfel, Zankapfel, Adamsapfel, Streitapfel, Reichsapfel, Apfelschimmel. Im Mittelalter wurde der Apfel auch »Affalter« genannt. Diese alte Bezeichnung hat sich bis heute in Ortsnamen erhalten: Affalterbach, Afholderbach, Affaltrach. Sicher wurden an diesen Orten schon im Mittelalter Äpfel angebaut.
Den herb schmeckenden Holzapfel scheinen unsere Vorfahren nicht verschmäht zu haben. In menschlichen Behausungen der Jungsteinzeit wurden viele Kerne des Holzapfels gefunden. Was im Mittelalter alles aus den kleinen Holzäpfelchen hergestellt wurde, lässt sich aus den Rezepten in alten Kochbüchern erkennen: Sie gaben Salaten und Speisen einen säuerlichen Geschmack, und auch Essig wusste man daraus zu bereiten. Ebenso bediente man sich der kleinen Äpfel zum Konservieren von Speisen. Da sie einen sehr hohen Pektingehalt haben und deshalb leicht gelieren, bereitete man aus ihnen meistens ein würziges Gelee.
Uralt ist die magische und mythische Geschichte, die sich mit dem Apfel verbindet. In allen euroasiatischen Kulturen war er ein Symbol des Lebens, der Liebe und der Fruchtbarkeit. Seiner Kugelform wegen war er das Sinnbild für die Vollkommenheit der Erde und des Kosmos. In der Form des Reichsapfels sollte er die Herrschaft des Geistesauch auf der Erde durch den gottgewollten Herrscher zeigen.
Der Apfel war immer ein Symbol der Erde und des Weiblichen, und so galt er als Attribut der Göttin, die oft in Dreiergestalt erschien. In jeder Kultur war sie es, die mit ihrem Apfel dem Menschen den Weg zur Vollkommenheit zeigte. Ischtar, Hathor, Demeter, Aphrodite, Venus, Iduna – die Namen wechselten, doch das Symbol der Göttin, der Apfel des Lebens, blieb. In vielen Märchen und Mythen wird vom Paradiesbaum erzählt, dessen Früchte ewiges Leben bringen sollen. Der Held der Geschichte zieht jeweils aus, um einen dieser Äpfel zu brechen. Schreckliche Abenteuer hat er zu bestehen, bis er am Ziel ist. Sie stehen symbolisch für die Hindernisse, die der Mensch auf dem Weg zu sich selbst zu überwinden hat. Oft sind es auch verschlüsselte Einweihungsriten des alten Kultes der Göttin.
In der nordischen Sage war es die Göttin Iduna, die im Besitz der goldenen Äpfel war. Sie gab davon den Asen zu essen, die darauf ewige Jugend erhielten. Die griechische Sage erzählt von den Hesperiden, den Töchtern des Atlas und der Hesperis. Zu ihnen wurde Herkules geschickt, um drei goldene Äpfel zu pflücken. In keltischen Märchen wird ebenfalls von einem wunderschönen Baum berichtet, der, schwer bewacht, goldene Lebensäpfel trägt. Und auch hier werden die abenteuerlichen Reisen des Helden beschrieben, die ihn zu dem Apfelbaum führen.
Auch in unserem Sprachraum sind viele Apfelmärchen erhalten geblieben. Das bekannteste ist wohl das von FrauHolle, das die Gebrüder Grimm aufgezeichnet haben. Das Mädchen trifft darin auf seinem Weg durch die Unterwelt auf einen Apfelbaum. »Ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif«, so bitten die Äpfel das Mädchen. Das Mädchen schüttelt den Baum recht kräftig, bis keiner der Äpfel mehr am Baum hängt. Und es wird dafür königlich belohnt.
Eine besondere »Apfelgöttin« beschreibt E.T.A. Hoffmann in seinem Märchen vom goldenen Topf. Darin verfolgt ein böses Apfelweib den Helden der Geschichte, den Studenten Anselmus, mit ihrem Fluch. Schließlich erblickt er ihr Gesicht sogar in einem bronzenen Türklopfer, der sich langsam und unheimlich zu einem grinsenden Apfelgesicht verzieht.
Auch Maria hält als Himmelsfürstin einen Apfel in ihrer Hand. In der christlichen Symbolik hat der Apfel jedoch eine zwiespältige Bedeutung. Nach der Umwandlung der frühen matriarchalen Mutterreligionen bekam das alte Apfelsymbol die Bedeutung der Sünde und des Verderbens zugesprochen. Die patriarchalen Kirchenväter wandelten den Leben spendenden Apfel in ein Objekt der Sünde und der Verführung. Die frühere weise Göttin war jetzt zur neugierigen, schwachen Eva geworden, die eine schwere Sünde beging, indem sie den Apfel vom Baum der Erkenntnis kostete. Nicht mehr das Leben und die Erneuerung nach dem Tod waren jetzt die Symbolik des Apfels, sondern die Vergänglichkeit des Lebens. Deshalb findet sich auf vielen Darstellungen von Apfelbäumen, die im Mittelalter entstanden sind, auch ein Totenschädel oder der Tod selbst mit im Bild.
Die Griechen, die in ihrer Mythologie den Göttern menschliche Eigenschaften zusprachen, haben in folgender Erzählung vom Apfel des Paris die Symbolik der Göttin mit dem Apfel etwas unterhaltsamer dargestellt, als es sonst üblich war: Zur Hochzeit der Thetis mit Peleus hatte man alle Götter eingeladen; nur Eris, die Schwester des Kriegsgottes Ares, hatte man vergessen. Sie sann auf Rache, und es fiel ihr etwas Besonderes ein. Sie ließ in den Festsaal einen Apfel rollen, den sie zuvor mit der Aufschrift »der Schönsten« versehen hatte. Natürlich verursachte dies unter den anwesenden Göttinnen einen Streit, denn jede nahm doch an, dass sie die Schönste sei. Endlich wurde dem nicht minder schönen Jüngling Paris die Aufgabe zuteil, der schönsten der Göttinnen den Apfel zu überreichen. Zur Auswahl standen in der Endentscheidung Juno, Minerva und Venus. Paris entschied sich für Venus, da diese ihm heimlich Helena, die schönste Frau der Erde, zur Ehefrau versprochen hatte. Wie diese Geschichte schließlich endete, kann man im Bericht über die Zerstörung Trojas nachlesen. Paris war der Sohn des trojanischen Königs Priamus. Die gekränkten Göttinnen Juno und Minerva trugen alles dazu bei, damit Troja zerstört werde, um sich so an Paris zu rächen.