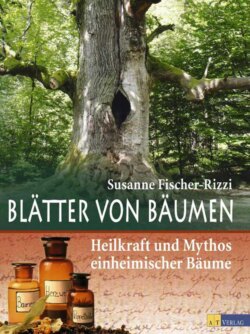Читать книгу Blätter von Bäumen - Susanne Fischer-Rizzi - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Ahorn
ОглавлениеAcer platanoides, Spitzahorn
Acer pseudoplatanus, Bergahorn
Acer campeste, Feldahorn
Familie der Ahorngewächse, Aceraceae
Keine ernsthafte Mythologie, keine symbolträchtige Geschichte, kein weiser Zauberspruch beschäftigt sich mit dem Ahorn. Denn er ist ein Luftikus. Er liebt den Wind, das Licht, die Farben und die Formen. Und damit spielt er, hoch oben in seiner Krone. Manchmal winkt er jemandem zu, mit einem oder mit tausend Blättern zugleich. Diese Blätter sind meist fünflappig und einer gespreizten Hand sehr ähnlich.
Da es dem Ahorn an Ernsthaftigkeit mangelt, hat man ihn mit weisen Sprüchen verschont. So kann eine große Schar seiner Verehrer, die Kinder, ungehindert unter ihm spielen. Sie kleben sich die Samensegel, die »Ahörner«, auf die Nase und werden zu Nashörnern. Ältere »Narren« freuen sich zuweilen über den Schatten, den der Ahorn als lebendigen Teppich unter seine Krone legt. »Es wird dieser Baum in Ehren gehalten wegen seines lustigen Schattens«, schreibt Jacobus Theodorus Tabernaemontanus in seinem 1731 erschienenen Kräuterbuch.
Als »mild« und »lustig« wurde der Ahorn zu allen Zeiten empfunden. Zusammen mit Lärche, Birke und Eberesche gehört er zu den heiteren Bäumen unserer Breiten. Es wäre auch gar zu düster, gäbe es nur Eichen und Fichten. Der Ahorn tröstet die traurigen und schweren Gemüter mit seiner Heiterkeit: »Halt, bleib stehen, nur einen Augenblick, und schau mir zu«, winkt er herüber. Und halten wir wirklich inne in unserer Geschäftigkeit, verzaubert er uns mit einem schnell erdachten Formen- und Farbenschauspiel: goldgelb, safrangelb, zitronengelb, purpurrot, weinrot, blutrot; gesprenkelt, getupft, gestreift. Die vielfältigen Formen seiner Blätter sind in ständiger Bewegung: sie sind gesägt, gewinkelt, gespreizt, gebuchtet, gespitzt ... Und ab und zu segelt eine seltsame Flügelfruchtnase herunter.
In über 150 Arten schlagen sich die Farben und Formen der Gattung Ahorn nieder. Das Schauspiel der Farben hat sie in den Osten Amerikas verlegt. Die dort vorherrschenden kalten Nächte und warmen Tage begünstigen die Verfärbung der Blätter, und nirgendwo anders leuchtet der Ahorn bunter. Der dort heimische Zuckerahorn, Acer saccharum, führt in seinen Adern so viel Zuckersaft, dass er regelrecht »gemolken« werden kann. Die Bäume werden angebohrt, der austretende Saft wird aufgefangen und zu Sirup, Paste oder Zucker verarbeitet. Aus vierzig Litern Blutungssaft erhält man durch Eindampfen einen Liter Ahornsirup. Die von den Hüllen befreiten Ahornsamen rösten die Indianer Nordamerikas und essen sie so wie wir zum Beispiel geröstete Sonnenblumenkerne. Die innere Rinde des Ahornbaums diente, getrocknet und gemahlen, nicht nur bei den Indianern, sondern auch in Europa in Notzeiten als Mehlersatz und zum Andicken von Suppen. Und was für uns die Bratäpfel an einem kalten Winterabend sind, das ist für Kanadier und Amerikaner der Pfannkuchen mit Ahornsirup.
Das Schauspiel der Formen der Ahornblätter wird im fernen Osten, besonders im westlichen China und Japan, aufgeführt. Hier ist nicht die Größe der Blätter Trumpf, sondern die Feinheit der Formen. Chinesen und Japaner mit ihrer Liebe zum Kleinen und fein Ausgestalteten sind darüber entzückt. Keiner der dort ansässigen Ahorne wird höher als fünfzehn Meter. Was zählt, sind die ausgefallenen und eleganten Formen der Blätter. Bis zu fünfzehnfach sind sie gelappt, gefächert, in spitzen, runden und filigranen Formen. Einer davon, der Fächerahorn, Acer palmatum, hat es bei uns inzwischen zu großer Beliebtheit gebracht und bereichert viele Vorgärten mit seiner östlichen Eleganz. In Japan teilen sich die zahlreichen Variationen der Ahornbäume den Platz in den Gärten zusammen mit Kiefern und Zierkirschen.
Nach diesem Ausflug in den äußersten Osten und Westen schauen wir unseren einheimischen Ahornarten etwas auf die Finger bzw. auf die ausgestreckten Blätterhände. Neben dem Zauber Amerikas und Japans bleiben uns nicht viele Ahornarten übrig. Wenn wir hier einen Ahornbaum entdecken, haben wir es mit Sicherheit mit einer der folgenden drei Arten zu tun: Der Spitzahorn, Acer platanoides, macht dem Namen Ahorn große Ehre: Ahorn leitet sich vom lateinischen acer = scharf, spitz ab. Das im germanischen Sprachbereich verwendete Wort Ahorn hat seine Wurzel in der indogermanischen Silbe ak, was ebenfalls scharf und spitz bedeutet. Scharf und spitz sind denn auch die Blätter des Spitzahorns. Seine fünf bis sieben Blattzähne enden in einer langen Spitze. Die Blattbucht zwischen den einzelnen Zähnen ist rundlich geformt.
Ahornwespe
Doch bevor der Spitzahorn seine Blätter entfaltet, überrascht er mit seinem Blütenzauber. Über sein duftendes Unterkleid aus gelbgrünen Blüten streift er später sein Blattgewand. Diese zeitigen Blüten sind wie die der anderen Ahornarten eine wichtige Weide für die eben aus dem Winter erwachten Bienen.
Schließlich erscheinen die geflügelten Früchte, die wir als Kinder spalteten und deren klebrige Samenhülle wir uns auf die Nase hefteten. Auf die schöne, schwarze, von feinen Rissen durchzogene Rinde haben wir damals kaum geachtet. Auch nicht darauf, dass dieser elegante Baum rund 20 Meter hoch wird.
Die zweite Ahornart, der Bergahorn, Acer pseudoplatanus, liebt mehr die Höhen. In kalter, feuchter Luft gedeiht er am besten. Als »Rübezahl« unter den dreien erreicht er eine Höhe von bis zu vierzig Metern. Er wirkt stämmig, seine Krone ist tief und dicht. Bis 600 Jahre kann dieser Baumriese alt werden. Während der Spitzahorn gern als Alleebaum in die Stadt geholt wird, lässt man den Bergahorn lieber in seinem angestammten Gebiet. Er wird vermehrt wieder gepflanzt, um die anfälligen Fichtenwälder zu beleben. In seinen ursprünglichen Verbreitungsgebieten Mittelgebirge, Alpen, Pyrenäen und Karpaten hat man ihn oft als beschützenden Hausbaum in die Nähe der Gehöfte gepflanzt. Er ist sehr anspruchslos und ein Pionier in der Bodenerschließung. Er durchpflügt mit seinen Wurzeln den Boden und befestigt ihn.
Weißbaum nannte man den Bergahorn wegen seines auffallend weißen Holzes, das gern zu schönen Tischlerund Drechslerarbeiten und auch zum Instrumentenbau verwendet wird. Spitz- und Bergahorn liefern das beste Klangholz für Geige, Zither, Laute und Flöte. Das Holz des Spitzahorns ist im Gegensatz zu dem des Bergahorns gelblich-weiß.
Wie alle Ahornarten ist auch der Bergahorn sehr saftreich. Im Elsass nennt man ihn deshalb auch Milchbaum, denn nach Abreißen der Blätter fließt aus den Stielen eine milchartige Flüssigkeit. Von allen drei Ahornarten kann der Bergahorn Verletzungen am wenigsten gut selbst wieder schließen. So ist schon mancher Bergahorn regelrecht verblutet, besonders im Frühjahr, wenn er am meisten Saft führt.
Wie sein amerikanischer Bruder, der Zuckerahorn, wurde auch der Bergahorn zur Zuckerherstellung verwendet, wobei man sehr sorgsam vorgehen musste, um ein Verbluten des Baumes zu verhindern. Nur zu ganz bestimmten Zeiten war das Anzapfen des Baumes möglich. Besonders zwischen November und Johannistag hielt man das Anzapfen des Baumes für schädigend. Aus dem gewonnenen Saft hat man früher Sirup, Zucker und Essig hergestellt, und sogar ein alkoholisches Getränk scheint man daraus gebraut zu haben. In einem alten Kräuterbuch fand ich die Angabe, dass man aus fünfzig Litern Saft ein halbes Kilo Zucker erhält. Zu diesem Zweck wird der Saft langsam eingekocht.
Im Unterschied zu den Spitzahornblättern sind die Zähne der Bergahornblätter an der Spitze gebuchtet, und zwischen den einzelnen Lappen sitzen kleine Spitzen. Der Blattstiel hat eine deutliche Rinne. Der Bergahorn hält sich in der Farbauswahl etwas zurück; die großen Blätter werden zum Herbst hin immer dunkler und fallen früh nach dem ersten Frost ab. Auch bei der Blütenbildung ist er zaghaft. Die schönen gelb-grünen Blütentrauben erscheinen erst nach der Blattentfaltung. Bei der Betrachtung der Rinde erschließt sich die Bedeutung seines lateinischen Namens pseudoplatanus: Die braungraue, glatte Rinde hat sich bei älteren Bäumen in eine hellbraune Borke verwandelt, die in flachen Schuppen, genau wie bei der Platane, abblättert.
Der Kleinste von den dreien ist der Feldahorn, Acer campestre. Er wirkt fast strauchartig und wird höchstens fünfzehn Meter hoch. Unsere Vorfahren fühlten sich ihm besonders verbunden, er war der »deutsche Ahorn« oder der »Maßholder«. Der althochdeutsche Name, mazzaltra, der sich aus dem germanischen mat(i), Speise ableitet, verrät uns, wofür der Feldahorn gebraucht wurde. Er war ein Speisebaum. Zuerst einmal sollte er Nahrung für das Vieh liefern: Man pflanzte ihn als Laubfütterbaum auf die Weiden und in die Nähe der Gehöfte und verfütterte seine Blätter an Schafe, Ziegen und Pferde. Das Holz hat einen gelblichen bis rötlich-weißen Schimmer, ist zäh und gleichzeitig elastisch. Es eignet sich für Schnitz- und Drechselarbeiten, für Möbelfronten, Holzblasinstrumente, Furniere, Flügel, Walzen, Gleithölzer und Waggons und liefert nicht zuletzt auch ein gutes Brennholz. Nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen war er ein Speisebaum. Aus den jungen Blättern bereitete man eine Art Mus, in dem man sie wie Sauerkraut vergären ließ.
Die Krone des Feldahorns ist nicht so regelmäßig ausgebildet wie die der beiden anderen Arten. Sie wirkt etwas zerzaust. Die Zweige sind dicht belaubt mit kleinen drei- bis fünflappigen Blättchen. Sie sind auf der Oberseite dunkelgrün und in der »Handinnenfläche« behaart.
Wenn es um unliebsame Konkurrenten geht, ist der Ahorn radikal. Die rote Farbe seiner herbstlichen Blätter ist kein Pigment, sondern ein chemischer Stoff, den der Baum nur im Herbst produziert. Damit »vergiftet« er den Boden unter seiner Krone; er steckt sein Revier ab, damit sich kein anderer Baum hier ansiedeln kann. Dieser Vorgang wird in der Botanik Allelophatie genannt.
Wenn sich im Herbst die Flügelfrüchte langsam durch die Luft zu Boden schrauben, gibt es noch eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit zwischen den drei Ahornarten: Der Winkel, den die beiden Flügelhälften bilden, ist bei allen dreien verschieden: Beim Feldahorn ist es ein rechter Winkel, beim Spitzahorn ist dieser stumpf, und beim Bergahorn eng spitzwinklig.