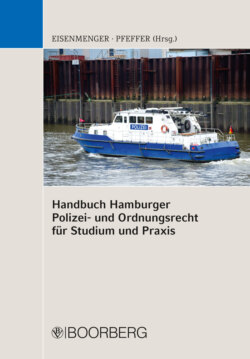Читать книгу Handbuch Hamburger Polizei- und Ordnungsrecht für Studium und Praxis - Sven Eisenmenger - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Funktionen der Grundrechte
Оглавление87
Die Funktionen von Grundrechten sind seit Unterzeichnung des GG vor rund 70 Jahren nachfolgend durch die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung und durch die Literatur konkretisiert worden. Die Systematisierung dieser Grundrechtsfunktionen erfolgt in der Literatur keineswegs einheitlich. So wird etwa zwischen „Grundfunktionen“, „Funktionsausweitung durch objektive Wertentscheidungsgehalte“ und „querliegenden Funktionen“ unterschieden170, wiederum von anderen zwischen „subjektiv-rechtlichen“ und „objektiv-rechtlichen Dimensionen“171. Entsprechend der Auflistung von Sodan und Ziekow172 lassen sich im Überblick folgende Funktionen herauspräparieren:
– Abwehrfunktion
Hier geht es letztlich um die Abwehr von eingreifenden staatlichen Maßnahmen, z. B. mit Blick auf polizeiliche Maßnahmen, wenn diese verfassungswidrig sind. Geschützt wird damit die Freiheitssphäre der Bürger. Das BVerfG führt hierzu aus: „Die Grundrechte sind dazu bestimmt, die Freiheitssphäre des Einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt zu sichern; sie sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat.“173
– Originäre Leistungsrechte
In diesen Fällen enthalten Grundrechte ausdrückliche Ansprüche gegenüber dem Staat (z. B. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG mit der Rechtsschutzgarantie oder Art. 103 Abs. 1 GG mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör bei Gericht). Ausnahmsweise abgeleitet aus Art. 1 Abs. 1 GG i. V. m. dem Sozialstaatsprinzip wird auch das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums.174
– Gleichbehandlungsfunktion
Einige Grundrechte – insbesondere Art. 3 Abs. 1 GG – erfüllen ebenfalls eine Gleichbehandlungsfunktion, an die sich auch derivative Leistungs- und Teilhaberechte anschließen können.175 Hier geht es vor allem um die gleiche Vergabe von Studienplätzen.176
– Mittelbare Drittwirkung
Ausnahmsweise können Grundrechte auch im Verhältnis zwischen Privaten Wirkkraft entfalten, wenn es im Privatrecht etwa um die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe wie „Treu und Glauben“ (§ 242 BGB) oder die „guten Sitten“ (§ 138 Abs. 1 BGB) geht, die mithilfe der grundrechtlichen Aussagen konkretisiert werden können. Man spricht insoweit von der mittelbaren Drittwirkung. Ausnahmsweise gelten die Grundrechte auch direkt im Privatrechtsverhältnis im Zusammenhang mit der Koalitionsfreiheit kraft grundgesetzlicher Anordnung (Art. 9 Abs. 3 GG).
– Schutzpflichten
Der Staat hat sich auch schützend vor die Grundrechte zu stellen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.177 Aus dem Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG kann man z. B. die Einrichtung einer Polizei zur Gefahrenabwehr herleiten. Zum Teil ist hier auch von Gewährleistungsschutzpflichten178 die Rede. Hierbei besteht ein Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers, wobei der Staat indes ein Mindestmaß an Schutz nicht unterschreiten darf (sog. Untermaßverbot). Dies wäre dann der Fall, wenn kein oder gänzlich ungeeigneter Schutz besteht.179
– Institutionelle Gewährleistungsfunktion
Auch schützen die Grundrechte einzelne Institute dadurch, dass letztere explizit im GG verankert sind. Zu nennen sind z. B. die Eigentumsgarantie und das Erbrecht in Art. 14 Abs. 1 GG, ferner auch das Berufsbeamtentum in Art. 33 Abs. 5 GG.180
– Organisations- und Verfahrensrechtsfunktion
Grundrechte beinhalten als „querliegende Funktion“181 schließlich auch die Pflicht, den organisatorischen Rahmen so zu determinieren, dass Grundrechte adäquat wahrgenommen werden können. Ebenso erwächst aus dieser Funktion die Verpflichtung, Verfahren optimal, z. B. möglichst zügig, durchzuführen.182