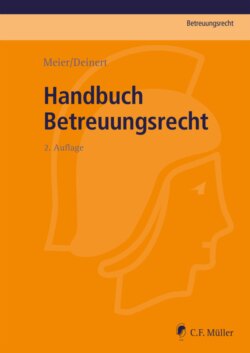Читать книгу Handbuch Betreuungsrecht - Sybille M. Meier - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеA. Die materiellen und verfahrensrechtlichen Vorschriften des Betreuungsrechts und der Unterbringung › II. Das 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz 1999
II. Das 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz 1999
7
Am 1.1.1999 trat mit dem 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG) die Reform der Reform in Kraft. Vor allem die Bundesländer wurden aktiv, um das Betreuungsrechtsänderungsgesetz auf den Weg zu bringen. Grund bildete der Umstand, dass die Ausgaben für Betreuungskosten nach einer unvollständigen Statistik der Bundesländer um ein Vielfaches nach 1992 gewachsen waren. So gab beispielsweise das Land Baden-Württemberg 1992 652.000 DM an Betreuungskosten aus, im Jahre 1995 waren es bereits über 7.000 000 DM. In Thüringen wuchs der Ausgabenbetrag im Jahr 1992 von 6.000 DM auf 4.022.000 DM im Jahre 1995. Auch die Landeszuschüsse für die Betreuungsvereine mussten von 9.099.000 DM im Jahre 1992 auf 23.945.000 DM 1995 angehoben werden.
8
Streitigkeiten über die Höhe der zu bewilligenden Vergütungen bildeten ab 1992 den Schwerpunkt der gerichtlichen Tätigkeit im Betreuungsrecht. Das 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz verfolgte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. folgende Reformziele:
| 1. | im materiellen Betreuungsrecht Verbesserung des Schutzes des Betroffenen bei Erteilung einer Vorsorgevollmacht und damit Stärkung dieses Rechtsinstituts als Alternative zur Betreuung,[1] |
| 2. | Betonung des Prinzips der rechtlichen Vertretung des Betroffenen in den gerichtlich zugewiesenen Aufgabenkreisen, |
| 3. | Vorrang der ehrenamtlich geführten Betreuung vor einer Berufsbetreuung, |
| 4. | Präzisierung der Vorschriften über die Vergütung, um so die Probleme, die es in der Vergangenheit mit dem Vergütungsrecht gab, zu lösen,[2] |
| 5. | Beteiligung des Betroffenen an den Betreuungskosten im Falle der Mittellosigkeit durch Rückgriffsmöglichkeit der Staatskasse, |
| 6. | Heranziehung unterhaltspflichtiger Familienangehöriger zur Zahlung von Betreuungskosten. |
9
Ein wesentliches Ziel des 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes war es, den einem Betreuer im Falle einer Liquidation aus der Staatskasse zu bewilligenden Stundensatz verbindlich nach der Art seiner Ausbildung in einer dreistufigen Skala zu typisieren.[3] Zudem sollte auf Grund einer standardisierten Vergütungsfestsetzung die Notwendigkeit entfallen, die Schwierigkeit der einzelnen Betreuung nachzuweisen.
10
Ansonsten ließ die stärkere Betonung der rechtlichen Betreuung durch das 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz den Grundsatz der persönlichen Betreuung unberührt. Der Betreuer muss die Angelegenheiten des Betreuten so besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Der Betreuer hat insbesondere den Wünschen des Betreuten zu entsprechen und wichtige Angelegenheiten vor der Erledigung mit dem Betreuten zu besprechen, § 1901 Abs. 2 und 3 BGB.
11
Bei Mittellosigkeit des Betreuten richtete sich der Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse, § 1836a BGB a.F., wobei die Höhe der Vergütungssätze in einem eigenständigen, nur zwei Paragrafen umfassenden Gesetz geregelt war, dem Gesetz über die Vergütung von Berufsvormündern (Berufsvormündervergütungsgesetz – BVormVG).
12
Bis zu dem Inkrafttreten des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes belief sich der Vergütungsrahmen zwischen 25,00 DM und 125 DM, bei einem Mittelwert von 75,00 DM. Das 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz reduzierte diesen Vergütungsrahmen um circa 37 % und legte eine Spanne zwischen 35,00 DM bis 60,00 DM fest, was einem Mittelwert von 47,50 DM entsprach.
13
Die Reform führte u.a. zu einer Verschlechterung der Vergütung für Berufsbetreuer und beinhaltete weiterhin auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht einen Abbau von Rechten der Betroffenen. So kann beispielsweise nach der Neufassung des § 67 FGG (jetzt § 276 FamFG), wenn Gegenstand des Verfahrens die Bestellung eines Betreuers zur Besorgung aller Angelegenheiten des Betroffenen oder die Erweiterung des Aufgabenkreises hierauf ist, von der Bestellung eines Verfahrenspflegers abgesehen werden, wenn „ein Interesse des Betroffenen“ hieran „offensichtlich nicht besteht.“ Begründet wurde diese Neuregelung damit, die Bestellung eines Verfahrenspflegers in derartigen Fällen habe in der Vergangenheit ohnehin nur formalen Charakter gehabt und im Übrigen könne die Betreuungsbehörde zu der Frage der Betreuerauswahl Stellung nehmen.[4] Diese Regelung ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich mit Hinblick auf Art. 103 Abs. 1 GG, dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs.[5] Im Falle einer nicht verfassungskonformen Auslegung ist die Gefahr zu thematisieren, dass der Betroffene zu einem bloßen Verfahrensgegenstand verkommt – ein Ergebnis, das der Reformgesetzgeber gerade vermeiden wollte. § 67 Abs. 1 S. 3 FGG (jetzt § 276 Abs. 2 FamFG) ist demgemäß eng auszulegen dahingehend, dass niemals von einem Desinteresse des Betroffenen an einer Verfahrenspflegerbestellung auszugehen ist. Wird beispielsweise eine Betreuung mit allen Angelegenheiten angeordnet, verliert die betroffene Person ihr aktives und passives Wahlrecht, vgl. §§ 13 Nr. 2, 15 Abs. 2 Nr. 1 BWahlG. Wieso der Verlust eines so wesentlichen bürgerlichen Rechtes im offensichtlichen Desinteresse eines Betroffenen liegen soll, ist nicht nachvollziehbar und wird im Jahre 2014 unter den Vorzeichen der vor einigen Jahren in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention wieder in Politik und Gesellschaft diskutiert.[6]
14
Bei der richterlichen Genehmigung gefährlicher Heilbehandlungen nach § 1904 BGB ist durch das Gericht ein Sachverständigengutachten einzuholen. § 69 Abs. 2 Bst. d FGG a.F. sah zwingend vor, dass Sachverständiger und ausführender Arzt nicht personengleich sein dürfen. Das Betreuungsrechtsänderungsgesetz hat diese Mussregelung in eine Sollregelung umgewandelt (jetzt § 298 Abs. 4 S. 2 FamFG). Diese Gesetzesänderung ließ die Regelung zum Schutze des Betroffenen zu einer Farce verkommen. Ein größerer Interessenkonflikt bei der Erstellung eines Gutachtens ist kaum denkbar. Der behandelnde und die lebensgefährliche Maßnahme befürwortende Arzt soll im gleichen Atemzug neutral und sachlich hierüber ein Sachverständigengutachten erstellen! Eine greifbare Interessenkollision liegt auf der offenen Hand.
15
Trotz erheblicher Bedenken verschiedener Berufsverbände und Vereinigungen von Betroffenen trat das Gesetz am 1.1.1999 in Kraft. Leider waren die Gesetzesänderungen ausschließlich dem Ziel verschrieben, Einsparungen in den Justizhaushalten bei gleichzeitiger Verminderung des Arbeitsaufwandes der Gerichte zu erreichen. Die Reformbemühungen waren mitnichten daran orientiert, das Wohl der Betroffenen zu verbessern. In der Fachwelt war man sich unisono über die Notwendigkeit weiterer Reformbemühungen einig.