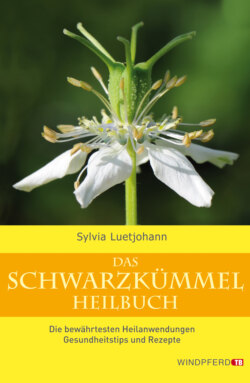Читать книгу Das Schwarzkümmel-Heilbuch - Sylvia Luetjohann - Страница 11
Die europäische Überlieferung (1. Teil)
ОглавлениеSchwarzkümmel ist nicht nur in der Bibel, wo er Ketzah heißt, als vielseitig verwendbares Gewürz für Brot und Kuchen erwähnt, sondern auch allen naturheilkundlichen Autoren der griechischen und römischen Antike bekannt. Der griechische Arzt Hippokrates (5. Jh. v. Chr.) verwendet die Namen melánthion („Schwarzblatt“) oder meláspermon („Schwarzsame“) dafür. Die schwarzen Samen haben der Pflanze auch ihren botanischen Namen gegeben, nämlich Nigella (von lat. niger = „schwarz“ bzw. nigellus = „schwärzlich“). Im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wird er von Plinius Secundus d. Ä. in seiner umfangreichen Naturalis historia („Naturgeschichte“) ausführlich behandelt. Hier taucht als Name übrigens Git oder Gith auf, eine in den antiken lateinischen Schriften oft verwendete Bezeichnung, die sich wahrscheinlich aus dem Arabischen ableitet und der wir später auch in den alten deutschen Quellen noch mehrmals begegnen werden. Eine offenkundig ebenfalls arabisierte Namensform des Schwarzkümmels, nämlich „Salusandriam“, verwendet nur wenig später als Plinius der griechische Arzt Dioskurides in seiner fünfbändigen Arzneimittellehre De materia medica, die weit über das Mittelalter hinaus die Pflanzenheilkunde beeinflussen sollte.
Plinius nennt eine Reihe von Heilanwendungen, von denen uns viele aus der arabischen Welt bereits bekannt sind, so natürlich die verdauungsfördernde Wirkung als Brotgewürz; ferner die schon erwähnte Behandlung von Schlangenbissen und Skorpionstichen, außerdem von Verhärtungen, alten Geschwulsten, Eiterwunden, Hautausschlägen und sogar von Sommersprossen. Eine ganze Reihe von Rezepturen mit Schwarzkümmel gegen Erkältungen und Entzündungen im Kopfbereich werden empfohlen, die noch viele hundert Jahre später fast unverändert in den großen deutschen Heilpflanzen-Enzyklopädien des 16.–18. Jahrhunderts auftauchen werden. Hier einige Kostproben aus der „Naturalis Historia“:
Zerstoßen und zum Riechen in ein leinenes Tüchlein gebunden, vertreibt er Nasenkatarrh, mit Essig aufgestrichen Kopfschmerzen, mit Irisöl in die Nase gestrichen Augenkatarrh und Geschwülste, mit Essig gekocht Zahnschmerzen, zerrieben und gekaut Mundgeschwüre, mit einem Zusatz von Natron getrunken Atembeschwerden …
Der Gebrauch des Schwarzkümmels als wohlschmeckendes und gleichzeitig heilkräftiges Brotgewürz hat sich in der Folgezeit offenbar auch in Deutschland durchsetzen können. Um das Jahr 794 wird sein Anbau im „Capitulare de vilis“ von Karl dem Großen für diesen Verwendungszweck empfohlen. Er wird hier mit den Namen „Römischer Kümmel“ oder „Schwarzer Koriander“ bezeichnet und erhält auch die arabischen und von Plinius überlieferten Heilwirkungen zugeschrieben. Im Jahre 816 wird Schwarzkümmel, der hier Gitto heißt, im „Hortus“ des St. Gallener Klosterplanes aufgeführt. In altdeutschen Glossen wird er als protvurz oder brotchrut bezeichnet. Die Einbürgerung des botanischen Namens Nigella im Mittelalter scheint vor allem auf die Schriften des Albertus Magnus zurückzugehen, er hat sich auch in der Pharmakologie eingebürgert.
Hildegard von Bingen, die im 12. Jahrhundert ihr berühmtes Doppelwerk über Natur- und Heilkunde verfaßt hat, scheint dem Schwarzkümmel dagegen eher mißtrauisch gegenübergestanden zu haben. Sie stuft ihn zwar sehr treffend als „Pflanze von warmer und trockener Qualität“ ein, handelt ihn aber dann auffallend kurz ab. Zu erwähnen ist vor allem die Verwendung von zerstoßenem Schwarzkümmelsamen mit gebratenem Speck als Heilsalbe gegen Kopfgeschwüre. Der Samen, mit Honig vermischt und an die Wand gestrichen, wird außerdem als todsicherer Fliegenfänger empfohlen! Was die Einnahme durch den Menschen betrifft, warnt Hildegard allerdings vor seiner möglicherweise giftigen Wirkung. Dies trifft auf manche Mitglieder dieser recht verzweigten Hahnenfußfamilie sogar zu. Da Hildegard aber den Ackerschwarzkümmel in ihrer „Physica“ mit dem botanischen Namen Githerum ratde benennt, liegt eher die Vermutung nahe, daß bereits hier die später sprichwörtliche Verwechslung mit der Kornrade (Agrostémma githago) passiert ist. Die Samen dieses von den Bauern gefürchteten Getreideunkrauts sind durch Saponine tatsächlich giftig und machen Mehl, Brot und Getreidekaffee nicht nur bitter, sondern sogar gesundheitsschädlich.
Trotzdem muß sich der Ruf des Schwarzkümmels als Heilmittel in der Volksmedizin im Laufe der nächsten Jahrhunderte stabilisiert und auch weiter verbreitet haben, denn als 1539 das „New Kreutterbuch“ des Hieronymus Bock erscheint, wird bereits eine beachtliche Wissensfülle über Nigella oder auch den „Schwartzen Coriander“ ausgebreitet, wie er nun allgemein genannt wird. Da sich unserer Spurensuche aber spätestens ab hier ein oft nur mühsam zu durchdringender Wildwuchs aus unterschiedlichen Pflanzen mit abweichenden Beschreibungen und immer phantasievolleren Namen in den Weg zu stellen scheint, muß an dieser Stelle ein Abstecher in die Welt der Botanik eingeschoben werden.