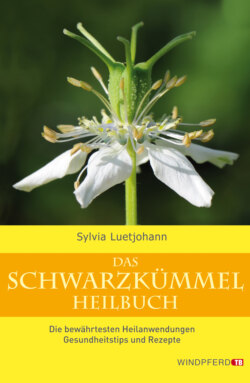Читать книгу Das Schwarzkümmel-Heilbuch - Sylvia Luetjohann - Страница 14
Die europäische Überlieferung (2. Teil)
ОглавлениеMit diesem botanischen Rüstzeug versehen, können wir die Spurensuche des Schwarzkümmels seit der Neuzeit und bis in die Gegenwart hinein wieder aufnehmen. Dabei soll an dieser Stelle nur ein allgemeiner Überblick über die Geschichte und Verbreitung dieser Pflanze gegeben werden. Einzelne Rezepturen aus der deutschen Volksmedizin werden später mit den Erfahrungen aus der arabischen und indischen Tradition sowie neueren Einnahmeempfehlungen in das Kapitel über spezielle Heilanwendungen aufgenommen.
Das „New Kreutterbuch“ des Hieronymus Bock aus dem Jahre 1539 und auch die sich rasch anschließenden Kompendien seiner Nachfolger und Epigonen können sich sowohl auf die antiken Quellen, denen wir bereits begegnet sind, als auch auf die inzwischen schon recht verzweigte mündliche Volksüberlieferung stützen.
Nigella sativa, die sich nach und nach zu immer mehr verschiedenen Arten ausmultipliziert, findet sich nun auch als „schwartzer zahmer Coriander“ wieder, so daß wir konstatieren können: Bei den Nigella-Arten wird nun botanisch zwischen „zahmen“ (d. h. kultivierten) und „wilden“ Sorten unterschieden; außerdem hat eine dieser zahmen Sorten aufgrund ihrer offenkundigen Ähnlichkeit mit den schmalen oberen Blättern des Korianders bei dieser Gewürzpflanze eine Anleihe gemacht, und womöglich hat auch der Volksmund berechtigten Einfluß auf die geschmackliche Zuordnung genommen.
Erstmals wird bei Hieronymus Bock erwähnt, daß die „schönst Nigella“, als die wir unschwer die Nigella damascena erkennen, „in die Lustgärten gepflanzet“ wird, wo sich der Geruch und Geschmack der Samen abzuschwächen beginnt, da sie auch zunehmend verwildert. Nigella arvensis dagegen, der eigentlich wilde schwarze Kümmel bzw. Koriander, wird botanisch zwar als „Pseudomelanthium“ entlarvt, in seiner Heilwirkung dem „Melanthium sativum“ jedoch an die Seite gestellt – bis die bereits erwähnte Verwechslung mit der Kornrade ihm zum Verhängnis werden sollte …
Etwa 200 Jahre nach Hieronymus Bock erscheint 1731 mit dem „Neu vollkommen Kräuter-Buch“ von Jacobus Theodorus Tabernaemontanus die letzte große Heilpflanzen-Enzyklopädie. Sie bietet den umfassendsten Wissensstand dieser Zeit auch über das Heil- und Unkraut Nigella, das hier zwar noch Namen mit den Zusätzen „Koriander“ oder „Melanthium“ trägt, vor allem aber „Nardenkraut“ oder „Nardensamen“ genannt wird – als „Narden“ werden von altersher besonders wohlriechende Pflanzen bezeichnet. Auch von einer Nigella hispanica oder Nigella cretica als lokalen Pflanzen ist nun nicht mehr die Rede, sondern man hat die Vorzüge des böhmischen Nardus bohemica erkannt.
Die verschiedenen Varietäten werden nur unter botanischen Gesichtspunkten, nicht aber nach ihrer offizinellen Wirksamkeit unterschieden. Alle kräuterkundigen Autoren erkennen diese Heilkraft an und stimmen auch darin überein, daß die Samen weder grün noch zu viel oder unnötig eingenommen werden sollen, da sie sich sonst sogar schädlich auswirken können. Bisweilen findet sich sogar die Empfehlung, die „hitzigen und trockenen“ Samen nicht trocken einzunehmen, sondern nur in Brot zu backen, wodurch sie eine Wirkung wie Koriander entfalten.
Etwas seltener wird auch Melanthium Oleum erwähnt, also das aus den Schwarzkümmelsamen gepreßte Öl, sowie Oleum Nigellae, das durch die klassische Wasserdampfdestillation gewonnene ätherische Öl; beide sind allerdings noch um einiges vorsichtiger als der Samen zu dosieren. Die Fülle der beschriebenen Anwendungen und Rezepturen entspricht im wesentlichen dem traditionell überlieferten Wissen von der „echten Nigella der Alten“. Zu Beginn seines Kapitels über die „Nardensamen“ schreibt Tabernaemontanus:
Die Alten haben davon nur ein Geschlecht beschrieben; wir kennen sechs unterschiedliche. Sie haben jedoch fast einerlei Kraft und Wirkung, das eine übertrifft das andere höchstens in der Stärke und Güte …
Allerdings ist ihm die Verwechslung zwischen dem wilden Schwarzkümmel und der Kornrade durchaus bekannt, denn er schreibt sogar über die Samen der Nigella sativa:
Anstelle dieses Nardensamens ist von vielen Medicis und Apothekern der Samen der Kornrade gebraucht worden, und obwohl dieser Irrtum durch gelehrte Männer offenbar wurde und nunmehr „so klar wie die helle Sonne um den Mittag“, so sind doch noch viel Unerfahrene in der Erkenntnis der Kräuter so in diesem Irrtum verstockt, daß man sie nicht davon abbringen kann.
Ob dieser verhängnisvolle Irrtum mit dazu beigetragen hat, daß eine derart populäre Heil- und Gewürzpflanze wie der Schwarzkümmel etwa ab dem 18. Jahrhundert bis vor kurzem bei uns fast völlig in Vergessenheit geraten konnte? Diese Entwicklung wird interessanterweise auch mit dem sogenannten „Schabab-Brauch“ in Verbindung gebracht, der ein Sinnbild für verschmähte Liebe ist. Dieser alte Brauch, bei dem der ungeliebte oder verschmähte Verehrer in aller Öffentlichkeit einen Korb mit Schabab-Blumen überreicht bekommt, ist bis heute in den bekannten Redewendungen „etwas durch die Blume sagen“ und „jemandem einen Korb geben“ überliefert. Bei den Schabab-Kräutern spielen die Ranunkeln eine wesentliche Rolle, die Schabab-Blume schlechthin ist die Jungfer im Grünen; andere Pflanzen, die ebenfalls dazugezählt werden, sind beispielsweise Schafgarbe, Kornblume, Augentrost sowie auch die Kornrade, also der Ackerschwarzkümmel. Wie wir schon erfahren haben, wird die dekorativ blau blühende Garten-Nigella nur allzugern mit der optisch weniger spektakulären, dafür aber heilkräftigen Echten Nigella verwechselt.
Es ist auch noch eine weitere interessante Erklärung für die einstmals geringere Popularität des Schwarzkümmels im christlichen Abendland geliefert worden: In der Pflanzensignatur ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Nigella- und Mohngewächsen festzustellen. Von daher wird ihnen unterschiedslos eine leicht narkotisierende Wirkung angehängt, weshalb die Samen in unserem Kulturkreis nicht ins Brot gelangen sollten und vielleicht sogar ein wenig als giftig „verteufelt“ wurden. Übrigens hat selbst das ausgesprochen populäre Bier zumindest zeitweise ein ähnliches Schicksal gehabt: Die Bezeichnung Pils leitet sich offiziell zwar von der Stadt Pilsen ab, wurde aber auch mit dem „Bilsenkraut“ assoziiert.
Wie dem auch sei – im Osten, von Ägypten über Syrien und die Türkei bis nach Indien und China, hat der Schwarzkümmel dagegen nichts von seinem sagenhaften Ruhm eingebüßt. Für diese offensichtlichen Unterschiede gibt es vielleicht aber auch noch eine weitere Erklärung, der wir im folgenden Kapitel nachgehen wollen.