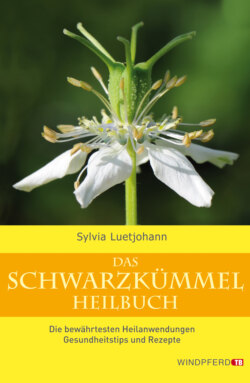Читать книгу Das Schwarzkümmel-Heilbuch - Sylvia Luetjohann - Страница 13
ОглавлениеDie verschiedenen Schwarzkümmel-Arten
Nigella sativa, der echte Schwarzkümmel
Nigella damascena, der Gartenschwarzkümmel
Nigella arvensis, der Ackerschwarzkümmel
Die schwarzen Samen der Nigella sind dreikantig und querrunzlig, sie sehen Zwiebelsamen zum Verwechseln ähnlich. Die Ähnlichkeit der Fruchtkapsel mit der Mohnpflanze hat wohl zu dem botanischen Namen Papaver nigrum, also „Schwarzmohn“ beigetragen, und die Samen sind früher sogar mit denen des Stechapfels (Datura) vermischt worden, die im Volk „Schwarzkümmel“ hießen.
Nur die Samen und das aus ihnen gepreßte Öl werden als medizinisch wichtige Bestandteile der Pflanze angesehen; diese Einschätzung schlägt sich beispielsweise auch in dem alten Namen „Nardensamen“ nieder. Sie riechen beim Zerreiben sehr aromatisch – allerdings nicht nach Kümmel, sondern eher nach Fenchel oder Anis und erinnern auch an Muskat. Die englischen Namensformen „Fennel Flower“ oder „Nutmeg Flower“ sind davon inspiriert worden. Der Geruch hat auch schon Assoziationen an Kampfer oder sogar Kajeput geweckt. Vom Geschmack her sind die Samen würzig, leicht bitter und von angenehmer Schärfe, so daß sie früher gerne anstelle von gewöhnlichem Kümmel verwendet wurden und auch als Pfefferersatz dienten. Poivrette (etwa mit „kleiner Pfeffer“ zu übersetzen) heißt in Frankreich denn auch das zu Pulver zerstoßene arabische Gewürz Abésodé.
Aus den Samen läßt sich durch Extraktion, aber auch durch Kaltpressung das fette Öl mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen gewinnen, aus dem die Samen zu ca. 35–45 % bestehen. Dem Schwarzkümmelöl wird eine konzentriertere Wirkung als dem unverarbeiteten Samen nachgesagt. Mittels Destillation kann aus den Samen auch ätherisches Öl gewonnen werden, von dem in Nigella sativa ca. 0,5–1,5 % enthalten sind. Es ist von gelblicher bis brauner Farbe, hat einen etwas strengen Geruch und ist auch daran zu erkennen, daß es nicht fluoreszierend ist.
Die ihr zugeschriebenen Heilwirkungen verdankt die Nigella sativa wohl der Tatsache, daß ihr ein Inhaltsstoff fehlt – nämlich das Alkaloid Damascenin, das beispielsweise in den beiden nachfolgend beschriebenen Arten Nigella damascena und Nigella arvensis enthalten ist, aber nur in hochkonzentrierter Form genossen schädlich sein soll.
Mindestens 20 verschiedene Varietäten und Kreuzungen des Schwarzkümmels sind in den Küstenländern des Mittelmeers und in den angrenzenden Gebieten sowohl wildwachsend als auch kultiviert verbreitet, darunter Nigella aristata und Nigella orientalis, die sich durch auffallend hellgrüne Blätter und rotgepunktete gelbe Blüten hervortut und auch gelbliche Samen hat. Überhaupt können sich die verschiedenen Nigella-Arten in ihrem Aussehen ziemlich voneinander unterscheiden: So hat der syrische Schwarzkümmel gegenüber dem ägyptischen recht große, hellblaue Blüten und längere, feinere Blätter. Wir wollen damit zur nächsten Verwandten der Nigella sativa übergehen – der Nigella damascena.
Nigella damascena
Der Damaszener oder Türkische Schwarzkümmel (engl. „Damask Fennel“), auch als Gartenschwarzkümmel bekannt, ist ebenfalls in den Mittelmeerländern und im Vorderen Orient heimisch. Die Namensgebung verweist hier besonders auf die Türkei und Syrien mit seiner Hauptstadt Damaskus. Diese Nigella-Art wurde aus ihrer ursprünglichen Heimat verpflanzt, wobei sich verschiedene Schmuckformen entwickelten. Sie ist etwa seit dem 16. Jahrhundert zu einer beliebten mitteleuropäischen Gartenzierpflanze geworden. Auch in den Beschreibungen, die man in den alten Kräuterbüchern findet, genießt sie wegen ihrer Attraktivität größere Beliebtheit als die Nigella sativa: Sie wird nicht nur häufiger abgebildet als diese, sondern durch das Himmelsblau ihrer rosenähnlichen Blüten und die auffallende Fülle ihrer haarfein wirkenden Blättchen als „hübscher und lustiger“ beschrieben. Vor allem aber weckt sie die Assoziation an zarte Mädchen, weshalb sie in der Volksbotanik viele poetische Namen erhalten hat und von Sagen und Legenden umrankt ist. „Lieb Kind hat viele Namen“ lautet eine alte Volksweisheit über die Vorzüge der Pflanzenwelt, und gewiß hat die schöne Damaszenerin entscheidend zu den rund 80 Bezeichnungen beigetragen, die es für die Schwarzkümmelarten gibt.
Der Damaszener Schwarzkümmel wird bis zu 75 cm hoch und hat einen aufrechten Stengel mit dunkelgrünen, sehr fein zerschlitzten Blättern mit langen Zipfeln. Diese erinnern nicht nur an Dillkraut, sondern auch an ein zartes Wurzel- oder Haargeflecht. Außerdem werden die Blüten von einem sogenannten Involukrum, einer Hochblatthülle aus fünf ähnlich zerschlitzten Blättern, umgeben, dessen Ähnlichkeit mit einer Spinne in der Schweiz zu der Bezeichnung „Spinnblume“ oder „Spillmugge“ geführt hat. Die Kelchblätter haben einen milchigweißen Grund, sind aber zur Spitze hin lichtblau gefärbt. Auf den ersten Blick könnte man sie für Blütenblätter halten, doch an ihrer etwas derberen adrigen Beschaffenheit und der ins Grünliche gehenden Farbe sind sie als Kelchblätter zu erkennen.
Vor allem ihrem feinen Blattwerk, das Schlüsse auf ihre empfindsame Natur zuläßt, hat die Nigella damascena viele ihrer sehr weiblichen Namen zu verdanken. So ist sie in Deutschland vor allem als die Gartenpflanze „Jungfer im Grünen“ bekannt. Damit verknüpft ist die Sage um den Tod des deutschen Kaisers Friedrich I. durch Ertrinken während eines Feldzugs in Kleinasien:
Auf einem Heereszug in das Heilige Land hatte Kaiser Friedrich Barbarossa sein Lager am Ufer des Flusses Kalikaduus aufgeschlagen. Dort ging er des Nachts spazieren und erfreute sich am Gesang einer verführerischen Nixe. Als er ihrer ansichtigwurde – grüne Locken umwallten ihr wunderschönes Gesicht, und sie trug ein blaues Gewand – und nach ihr griff, um ihren Schleier zu lüften, wurde er von ihr mit in die Tiefe gerissen. An der Stelle, wo er verschwunden war, fand König Richard Löwenherz eine Blume, lieblich wie eine Undine – mit feinem grünem Haar und blauem Blütenkleid.
Der Ursprung des Namens „Gretel im Busch“ (auch „Gretchen im Grünen“ oder „Gretchen in der Heck“) wird durch eine alte österreichische Sage erhellt:
In einem Dorfe lebte einmal ein reicher, aber sehr geiziger Bauer, der eine schöne Tochter namens Grete hatte. Gegenüber wohnte ein leider sehr armer Bauer, der einen Sohn namens Hans hatte. Die beiden jungen Leute liebten sich, doch Gretes Vater wachte streng darüber, daß sie sich nicht näherkamen. Da blickte Grete so lange aus ihrem Garten nach dem Burschen und Hans vom Weg aus so lange nach dem Mädel, bis beide in Blumen verwandelt wurden: nämlich zu „Gretel im Busch“ und zu „Hansel am Weg“ – dies ist der volkstümliche Name für den Vogelknöterich (Polygonum aviculare).
Vielleicht ist auch das englische „Love in a Mist“ eine Reminiszenz an diese traurig-schöne Geschichte?
Ein weiterer, sehr bildhafter Name, „Braut in Haaren“ (frz. auch cheveux de Vénus = „Venushaar“), zeugt davon, daß früher der Übergang vom ledigen zum ehelichen Stand für die Frau mit einem Wechsel der Haartracht verbunden war, z. B. durch eine andere Art des Einflechtens oder der Kopfbedeckung. Bis ins 18. Jahrhundert hinein galt für vornehme Bräute der Brauch, bei der Hochzeit als Zeichen der Jungfräulichkeit „in Haaren“ zu gehen, d. h. in aufgelöst herabwallendem Haarschmuck, wie es die folgende Gedichtstrophe beschreibt:
Zur Zeit, als es die Sitte war,
Daß Jungfrauen gingen mit losem Haar,
Da nannte man das „in Haaren gehen“;
Daraus der Name ist leicht zu verstehen
Der Blume „Braut in Haaren“ …
Aus den recht großen, einfachen oder gefüllten, manchmal weißen, meistens aber hellblauen Blüten, die von ihrer Gestalt her mit Rosenarten wie der „Persian Rose“, „Miss Jekyll“ oder „Double Blue“ Ähnlichkeit haben, entwickelt sich die stark aufgeblasene, bis taubeneigroß werdende Samenkapsel, die durch die bis zur Spitze verwachsenen Fruchtknoten mit waagrecht abstehenden Griffeln fünf Hörner aufgesetzt bekommt. Von dieser auffallenden kapuzenähnlichen Form leitet sich wahrscheinlich die Bezeichnung „Kapuzinerkraut“ ab, und es ließe sich weiter spekulieren, ob sich der volkstümliche englische Name „Devil in the Bush“ aus Angst vor diesen vielen Hörnern erklären läßt …
Die in der Balgfrucht enthaltenen Samen sind ebenfalls schwarz, dreikantig und querrunzlig, sie könnten daher von ihrem Aussehen her leicht mit den Samen der Nigella sativa verwechselt werden. Beim Zerreiben riechen sie jedoch weniger streng wie bei der Nigella sativa nach Muskat oder Kampfer, sondern angenehm nach Erdbeeren oder Ananas, was der Pflanze auch den Namen Erdbeer- oder Ananaskümmel und den Samen die Verwendung als Gewürz in der Konditorei sowie in der Fruchtäther- und Schnupftabakfabrikation eingebracht hat.
Auch das ätherische Öl, dessen Anteil bei 0,37–0,55 liegt, besitzt einen angenehmen Geruch und Geschmack nach Walderdbeeren und erinnert zudem ein wenig an Moschuskörneröl. Das Öl ist gelb und fluoresziert zu einem prachtvollen Blau. Dieses Kennzeichen kann auch zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Schwarzkümmelsamen herangezogen werden, die oft miteinander verwechselt und auch vermischt werden: Bei Untersuchung unter gefiltertem UV-Licht fluoresziert nur das Samenpulver von Nigella damascena stark bläulich.
In späteren Kapiteln, die sich mit den Anbaugebieten sowie den Qualitätsmerkmalen beschäftigen, wird auf die Unterschiede bei den Schwarzkümmelsamen noch näher eingegangen.
Nigella arvensis
Der Acker- oder Feldschwarzkümmel, auch Wilder Schwarzkümmel, Haber- oder Roßkümmel genannt, soll hier als eine dritte botanische Sorte etwas ausführlicher erwähnt werden. Diese Varietät erreicht nur eine Größe bis zu 20 cm. Der aufrechte, haarlose Stengel ist von unten an verästelt, so daß sich ein kleiner Busch bildet. Er hat wechselständige gezipfelte Blätter und endständige Blüten mit einem fünfblättrigen Kelch, die hellblau und auf der Außenseite grünlich gestreift sind. Die Verwachsung der 3–5 Fruchtblätter bei der Samenkapsel reicht nur bis zur halben Höhe. Diese ist – im Unterschied zu den beiden anderen Arten – weder rauh noch kugelig aufgebläht, sondern eher länglich mit den schon bekannten Hörnchen, die ihr auch den wissenschaftlichen Namen „Nigella arvensis cornuta“ eingebracht haben.
Die Samen des Ackerschwarzkümmels sind ebenfalls schwarz, etwas rauh und dreikantig. Sie haben beim Zerreiben nicht den lieblichen Geruch der reizvolleren „Jungfer im Grünen“, sondern erinnern mehr an den würzig herben Charakter der Nigella-sativa-Samen. Vermutlich handelt es sich hierbei auch am ehesten um diejenigen Schwarzkümmelsamen, die von den Landleuten zum Räuchern gegen kriechendes Ungeziefer und giftige Tiere eingesetzt wurden – vorzugsweise gegen Spinnen, Skorpione und Schlangen, doch in diesem Zusammenhang werden sogar Hexen erwähnt. Die Blüten überreichten die jungen Mädchen einem ungeliebten Freier, um ihm „durch die Blume“ verstehen zu geben, er könne „abschieben“ – daher der drastische Volksname „Schabab“!
Wir kommen hiermit auch in den Grenzbereich, wo der Ackerschwarzkümmel als „Unkraut“ in den Getreidefeldern wuchert und entsprechend bekämpft wird. Seine Samen galten als bitter- und seifenstoff- sowie alkaloidhaltig und wurden aus dem Getreide ausgesiebt, damit sie nicht ins Mehl gelangten. Der volkstümliche deutsche Name „Radel“, in Zedlers Universallexikon mit dem lateinischen Namen Nigella arvensis gleichgesetzt, führt jedoch auf eine andere Spur: Als Kornnäglein, Nägleinrose oder Marienrose noch anmutig umschrieben, ist die Kornrade ein echtes Ackerunkraut auf Roggen- und Weizenfeldern, das durch die darin enthaltenen Saponine tatsächlich giftig ist und das Mehl bitter macht. Der schon bei Hildegard von Bingen erwähnte Namen Githerum ratde für den Ackerschwarzkümmel ist ein Hinweis auf eine solche Verwechslung mit der Kornrade, deren botanischer Name in tückischer Verwirrung Agrostémma githago lautet. Dieser Name setzt sich aus agros, „Acker“ für den Standort, stemma, „Kranz“ wegen der runden Blütenform, und gith, also dem alten arabischen und antiken Namen für „Nigella“ zusammen. Auch in anderen Sprachen zeigt sich diese Namensverschiebung vom Schwarzen Ackerkümmel zur Kornrade: Der italienische Name für die Kornrade lautet gitto, und im Französischen wird nigelle zu nielle – ein echtes Getreideunkraut, das nielle du blé, die „Gicht des Weizens“, verursacht.
Durch flächendeckende Bekämpfung ist der Ackerschwarzkümmel heutzutage, jedenfalls bei uns, inzwischen fast völlig verschwunden.