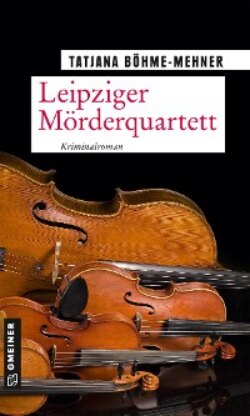Читать книгу Leipziger Mörderquartett - Tatjana Böhme-Mehner - Страница 7
3
ОглавлениеNein, ein Kind der Club-Szene war Anna in der Tat nicht, auch wenn ihre Dachgeschosswohnung nicht weit entfernt lag von der »Karli«, der Szenemeile, die eigentlich Karl-Liebknecht-Straße hieß. Sprachaffin, wie sie von Berufs wegen sein musste, aber auch von jeher gewesen war, mochte sie die Marotte der Leipziger, bestimmte Orte mit dem Vornamen anzusprechen. Darin äußerte sich eine gewisse Zuneigung. Als sie vor 18 Jahren zum Studium hierhergekommen war, war ihr das schnell klar geworden. Man traf sich im Clara-Park zum Picknick. Damit bekam der Ort gleich etwas Vertrautes, Gemütliches wie das Picknick selbst. Manchmal fragte sie sich, ob es Ur-Leipziger gab, die gar nicht wussten, dass diese innerstädtische Grünoase Clara-Zetkin-Park hieß, geschweige denn, wer Clara Zetkin war. Anna hatte eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass diese Verkürzung offenbar keine politische Dimension hatte; denn zur August-Bebel-Straße gleich um die Ecke sagten sie artig »Bebelstraße«. Irgendwann war Anna klar geworden: Die Bebelstraße war einfach keine Kultstätte.
Jedenfalls schlängelte sie sich jetzt den Bürgersteig der »Karli« entlang und blickte etwas neidvoll auf die Menschen, die mit erfrischenden Getränken die Freisitze bevölkerten, während Anna gleich im stickigen Dunkel des In-and-Out verschwinden musste.
Unweigerlich spürte sie dem Widerhall des Bebens des Hochdruckreinigers in ihrem Körper nach, als sie in dem – ihrer Meinung nach – für ein seriöses Kammerkonzert unpassenden Clubsessel versank, damit unbewusst auf der Suche nach dem eben errungenen Gefühl von Sauberkeit auf der eigenen Terrasse. In letzter Minute vom Einlasspersonal in den erstaunlich gut gefüllten Club geschoben, war es dieser überdimensionierte Sessel in Türnähe, der ihr als Sitzgelegenheit blieb und der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit quietschte, wenn sie die kleinste Bewegung machte. Das gaben die lockeren Federn unter dem abgenutzten Samtbezug unweigerlich zu verstehen, die sich sofort mit Vehemenz in ihr Sitzfleisch bohrten. Keinesfalls die beste Voraussetzung für ungetrübten Musikgenuss.
Das Saal-, besser Clublicht war schon erloschen und ein paar wenige Spots richteten sich auf das Podium. Die vier Notenpulte nahmen sich absurd aus in diesem Club-Setting. Anna wäre gern dazu übergegangen, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Sie wollte als Kritikerin nicht als die Mäkeltante vom »Täglichen Anzeiger« rüberkommen und noch viel mehr wollte sie Spaß an ihrem Job haben. Doch heute war das wie verhext.
Während sie versuchte, sich möglichst geräuscharm auf dem viel zu tiefen Sessel zurechtzurücken, was voraussetzte, dass sie sich wenigstens in Ansätzen aus dem archaischen Sitzmöbel heraushievte, fasste sie in einer Mischung aus Zwangsläufigkeit und Ungeschick mit der Hand auf die hölzerne Armlehne. Ein kapitaler Fehler. Sie klebte … Nicht in dem Sinne, dass Anna – untrennbar mit der Lehne verbunden – im In-and-Out gefangen war, aber immerhin so, dass die Kontaktfläche ihrer Hand nun ebenfalls klebte. Anna wollte nicht darüber nachdenken, welcher Art die klebrige Substanz war, mit der sie kontaminiert war. Eines stand fest: Sie bräuchte ein Waschbecken und viel Seife, um das Problem zu lösen. Wenigstens garantierte ihr die Türnähe des Platzes, dass sie zur Pause als eine der Ersten in Richtung Toilette stürmen konnte. Bis dahin dauerte es aber noch rund eine Dreiviertelstunde.
Obschon das Konzert gerade begann, konnte Anna den Gedanken nicht aus ihrem Kopf vertreiben, was das Schmuddel-Sitzmonster mit dem – sie hatte es ja gewusst – unpassenden beigen Leinenkleid anrichten würde. Wenn sie sich jetzt nicht langsam konzentrierte, konnte sie genauso gut gleich gehen. Was sie natürlich nicht tat. Während sie sich sammelte und konsequent die Berührungsfläche zwischen sich und dem Sessel auf ein notwendiges Minimum beschränkt hielt, ging der erste Brahms an ihr vorüber.
Gar nicht so übel, zumindest das, was sie davon wahrgenommen hatte. Anständig. Das subjektive Unbehagen ob der Location würde sie routiniert aus ihrer Kritik heraushalten. Diese würde kein Meisterwerk sein, aber wer erwartete das schon bei einer solchen Veranstaltung. Das Ambiente war ohnehin nicht geeignet für die vollkommene musikalische Kontemplation.
Wenigstens hatte man die Bar im Saal geschlossen, was den Vorteil hatte, dass das Brummen der Bierkühlung wegfiel. Auf die schwerfällige Klimaanlage, die das fensterlose Gemäuer bestenfalls mit einem Mindestmaß an so etwas wie Frischluft versorgte, hatte man nicht verzichtet. Wahrscheinlich gingen die Veranstalter davon aus, dass man sich an das Summen mit der Zeit gewöhnte.
Jetzt Mozart. Mit ein bisschen Glück konnte Anna in der aktuellen Position bis zur Pause durchhalten und weiteren Kleberkontakt vermeiden. Einen Satz der »Kleinen Nachtmusik« hatte sie schon überstanden. Das Kleistenes-Quartett machte seine Sache immer noch ordentlich. Sie würde sich in ihrem Text mit Goethe und den vier vernünftigen Leuten, die ein Gespräch führen, aus der Affäre ziehen. Das funktionierte bei Streichquartetten beinahe immer.
Was war das? Anna traute ihren Ohren nicht. Ein Fauxpas, und das in diesem Stück, das jeder mitpfeifen konnte. Ein Fehler, den die Kritikerin nicht ignorieren konnte, falls sie am Montag noch ernst genommen werden wollte. Was genau tat der Bratscher Thorsten Steinmüller da? Solide – für Annas Geschmack etwas zu solide für ein relativ junges Ensemble – hatte sich das Kleistenes-Quartett durch den unvermeidlichen ersten Satz gearbeitet. Na ja, bei dieser Musik störte es niemanden, wenn die Darbietung allenfalls nett war. Aber das hier hatte mit nett nichts zu tun. Die wunderschöne Themenexposition des zweiten Satzes war durchgestanden. Doch in der Themenwiederholung, gerade da, wo die Bratsche inmitten des bis dahin dreistimmigen Satzes die seltene Chance zu sinnlicher Virtuosität erhält, setzte Steinmüller zwar korrekt ein und trillerte im richtigen Moment los, schien aber aus seinem Triller nicht mehr herauszufinden. Er trillerte noch in aller Gemütlichkeit, als die anderen gefühlt Takte voraus waren … Das war keine selbstverliebte Virtuosität … Es war absurd. Als würde der Bratscher in einer völlig anderen Zeitebene und Musiktradition verfangen sein, als steckte dieser in seinem Triller fest. Die »Kleine Nachtmusik« war schließlich kein spätes Beethoven-Quartett, sondern irgendwo im Übergang zwischen dem Streichquartett als Hausmusikform, die von versierten Amateuren zu bewältigen war, zum hoch expressiven, Professionalität fordernden Quartett der Romantik anzusiedeln. Für einen halbwegs routinierten Musiker kein Hexenwerk.
Anna war hellwach.
Steinmüller war kein Anfänger und erst recht kein Amateur. Er hatte bis vor Kurzem einen Lehrauftrag an der Musikhochschule innegehabt. Warum er den nicht mehr hatte? Weiß der Geier. Anna hatte sich darüber bisher keine Gedanken gemacht. Wohl kaum, weil er die Bratschenstimme der »Kleinen Nachtmusik« nicht mehr auf die Reihe bekam!
Die Spannung in der Luft des Clubs, die man ohnehin hätte schneiden können, war förmlich zu greifen. So empfand das zumindest Anna, die der latente Kneipengeruch seit Betreten des Raumes nervte.
Peinlich berührt starrte der Cellist Christoph Weinmann den Kollegen an und spielte dabei ostentativ die eigene Stimme, als wäre es ein Reinigungsritual. Der zweite Geiger Sebastian Mönkeberg hingegen war das personifizierte Entsetzen. Anna war fasziniert, wie angesichts der Mischung aus Verwirrung und Verzweiflung die Finger des Musikers dennoch jene Stellen auf den Saiten fanden, die Mozart sich vorgestellt hatte. Unweigerlich fragte sich die Kritikerin, wie weit man diese Abläufe mechanisieren konnte. Dass die Primaria des Quartetts, Theresa Steinmüller, Schwester des Übeltäters, mit einer stoischen Ruhe nicht nur das zusammenhielt, was noch zusammenzuhalten war, sondern ihrem Mienenspiel nichts anmerken ließ, hatte etwas Erschreckendes.
Anna hatte in einer Mischung aus Faszination, Resignation und Entsetzen die Abwehrhaltung gegen den Sessel aufgegeben und war, während die vier sich ein wenig angestrengt, aber in einem geordneten Miteinander dem Ende des Werkes und damit der Konzertpause näherten, tief in den Sessel hineingerutscht. Inzwischen war sie der Überzeugung, dass sie neben Seife auch unbedingt eine Erfrischung benötigte, und schwankte gedanklich zwischen Wasser, Wein und dem für sie dekadentesten aller Getränke – Cola. Bei ihrem heutigen Glück konnte sie fast sicher sein, dass der Wein in diesem In-and-Out wahlweise von minderer Qualität oder schlecht temperiert sein würde, höchstwahrscheinlich beides. Außerdem brauchte sie einen klaren Kopf, gerade in diesem absurden Konzert. Cola war der Inbegriff der Verführung, dem sie sich angewöhnt hatte zu widerstehen, weil das die Vernunft gebot. Angesichts des Zuckergehalts. Und überhaupt … Die Vernunft war auch jetzt noch auf dem Vormarsch. Also: Wasser.
Gemäßigter Applaus. Die Kleistenes-Musiker retteten sich von der Bühne. Der Beifall rechtfertigte nicht die Rückkehr für eine weitere Verbeugung. Anna verschwand zielstrebig Richtung Wasser und Seife. Das Erste, was ihr an diesem Tag auf Anhieb gelang.
Wahrscheinlich wäre es ratsam gewesen, eine Brise Luft vor der Club-Tür zu schnappen. Doch die gab es dort ohnehin nicht, weil sich die gefühlt 90 Prozent Raucher um die drei Aschenbecher scharten. Ein Blick zum Ausgang bestätigte das.
Oben im zweiten Saal begann eine andere Veranstaltung, wie die dröhnenden Bässe aus der noch offenen Tür vermuten ließen. Hoffentlich untermalten die nicht den verbleibenden Brahms …
Eine Person im dunklen Kapuzenpulli drängte sich an Anna vorbei – unhöflich, rempelte sie beinahe an, schwang sich die kleine Wendeltreppe empor und verschwand in der Tür, die vermutlich zur Regie führte. Wahrscheinlich ein Techniker, denn nun schloss sich die obere Saaltür. Anna beeilte sich, um an der Theke noch ein Wasser zu ergattern. Sie hatte den festen Vorsatz, aus diesem Abend das Beste zu machen. Schließlich war es nicht allzu spät, draußen schien noch immer die Sonne. Die Terrasse wartete; und bisher sah es nicht so aus, als würde jemand gesteigertes Interesse daran haben, den Kleistenes-Abend mit unnötigen Zugaben zu verlängern.
Die Schlange vor Anna wurde kürzer. Der Barmann kam in Sicht, eigentlich eher ein Barjunge, aber das sagte man wohl nicht. Zuversicht auf der ganzen Linie. Da spürte sie es – zunächst am Hals, dann auf dem Dekolleté. In der Tat spürte sie zuerst die Flüssigkeit an sich herunterlaufen, bevor sie das Unglück sah geschweige denn realisierte, was genau passiert war.
Vor ihr stand ein entsetzt dreinblickender Mensch – gar nicht so unattraktiv, abgesehen von dem schreiend bunten Oberhemd, das er in die schwarze Jeans gesteckt hatte. Äußerst akkurat, dennoch verbarg es die athletische Statur keinesfalls. Trotzdem wirkte der Lockenkopf unbeholfen – charmant unbeholfen, aber unbeholfen. Und er hatte ein leeres Weinglas in der Hand. Die Bar im Rücken … Das Weinglas in der Hand leer … Er redete schnell und intensiv auf Anna ein.
Als er bei »Natürlich werde ich für die Reinigung aufkommen« angelangt war, wurde Anna allmählich klar, dass dieses maskuline Riesenbaby ihr von oben nach unten ein komplettes Rotweinglas aufs beige Leinenkleid gegossen hatte. Hätte es noch irgendeinen Zweifel daran gegeben, dass dies nicht Anna Schneiders Tag war, jetzt wäre er ausgeräumt.
»Darf ich mich zunächst mit einem Drink revanchieren?«
Er hatte wirklich »Drink« gesagt – wahrscheinlich einer von der ganz coolen Sorte. Anna hatte ihre Sprache noch nicht wiedergefunden, zumal ihr der Rotwein vom Hals bis mindestens zum Nabel triefte. Was in ein einziges Glas hineinpasste … Anna trat hinter dem sehr bemühten Mann an die Theke. Als dieser sie freundlich einlud, zu bestellen, »was immer sie möge«, sagte sie ausgerechnet: »Eine Cola, bitte!« Das hatte sie sich verdient.
Beide hielten sie nun ein Cola-Glas in der Hand, als Mister Tollpatsch ihr freudig – weil sie die Einladung angenommen und nicht um Hilfe geschrien hatte – die Hand entgegenstreckte und sagte: »Habakuk, Habakuk C. Brausewind.«
Wie bitte, wollte Anna fragen, musste aber derart an sich halten, um nicht loszusprudeln, dass sie wieder keinen Ton herausbrachte. Wie müssen dich deine Eltern gehasst haben, schoss es ihr durch den Kopf.
Da fügte er strahlend hinzu: »Sie können aber Heinz sagen.«
Das war endgültig zu viel für Anna Schneider an diesem Tag. Sie brach in schallendes Gelächter aus, streckte ihm die Hand entgegen und erwiderte: »Anna, Anna Schneider.«
Ihr Gegenüber starrte sie ungläubig an. »Die Anna Schneider? Anna Schneider vom ›Täglichen Anzeiger‹?«, stotterte er.
Um Gottes Willen, was war das denn? Es passierte Anna nicht allzu oft, dass sie als die Kritikerin enttarnt wurde. In der Hoffnung, dass sich alles ordnen würde, nippte sie verlegen an der Cola, während dieser Habakuk-Heinz-wer-auch-immer seiner Bewunderung für ihr kritisches Ohr und ihren Scharfsinn und Wortwitz Ausdruck verlieh. Ob sie heute etwa auch beruflich hier sei?
Eigentlich war ihr Gesprächspartner ganz witzig. Wäre Anna ihm in einer anderen Situation begegnet, hätte sie ihn wahrscheinlich unterhaltsam gefunden, Spaß an der Konversation gehabt. Warum sollte sie also das Offensichtliche verneinen? Am Montag würde es sich eh aufklären, falls sie jemals eine Konzertkritik über diesen vermaledeiten Abend zustande brachte.
Er sei in gewisser Weise ebenfalls beruflich hier. Nicht, dass sie Kollegen wären, aber heute sei auch sein kritisches Ohr gefragt.
Was sollte das jetzt werden? Habakuk nervte, dabei hatte er einen Unterhaltungswert, der der verwirrten Anna guttat.
Sie habe auch über ihn schon häufiger geschrieben. Nicht namentlich natürlich. Nein, in Form des Gewandhausorchesters. Er sei dort Bratscher.
Dass sie nicht erneut in schallendes Gelächter ausbrach, grenzte an ein Wunder. Ein Bratscher hatte ihr gerade das schönste und empfindlichste Kleid, das sie besaß, komplett mit Rotwein versaut; ausgerechnet ein Mitglied jener Instrumentengruppe, über deren Tollpatschigkeit und Unvermögen es die mit Abstand meisten Witze gab. Diese Witze musste man sich nicht einmal hinter vorgehaltener Hand erzählen. Ein Bratscher, der von sich behauptete, Habakuk C. Brausewind zu heißen. Sie würde morgen überprüfen, ob das Jahresprogramm des Gewandhausorchesters in der Bratschengruppe tatsächlich diesen Namen auswies. Was es bedeutete, wenn das nicht der Fall war, wollte sie dann entscheiden. Für den Moment taten ihr Habakuks warme Augen und sein arglos leidenschaftliches Geplapper über Musik einfach gut.
Was seine berufliche Aufgabe heute war, konnte er nicht mehr erklären, denn die Konzertpause war, zwar reichlich spät, aber nun endgültig beendet. Trotz des an sich kurzen Programms wurde es außerdem langsam knapp für den Wein auf der Terrasse. So warm waren die Nächte noch nicht. Und sie müsste sich erst einmal vollständig umziehen, was sie am allerliebsten auf der Stelle täte.
Wieder überstürzt, aber dieses Mal selbst komplett verschmutzt, sank Anna in ihren Club-Sessel. Saal dunkel, Spot auf die kleine Bühne. Das Licht flackerte ein wenig. Hoffentlich würde ab jetzt alles gut gehen; schließlich wollte sie nicht die ganze Nacht im In-and-Out verbringen.