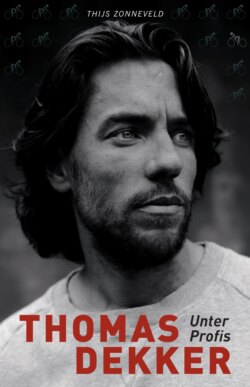Читать книгу Thomas Dekker - Thomas Dekker - Страница 11
Оглавление8.
Sein Händedruck ist fest. Sein Haar ist so schwarz, dass es aussieht, als wäre es gefärbt, und er trägt es streng nach hinten gekämmt. Er redet viel und schnell. Jacques Hanegraaf sitzt bei uns im Wohnzimmer, auf der Bank gegenüber. Er ist nach Dirkshorn gekommen, in einem dunklen Volvo, um sich mir und meinen Eltern vorzustellen. Er vertritt Radrennfahrer. Er verhandelt für sie, er berät sie in finanziellen Fragen, er regelt die Steuerangelegenheiten. Aber er ist auch Manager mehrerer Radsport-Teams gewesen – unter anderen bei Farm Frites und beim Team Coast. Er kennt jeden im Radsport, und jeder kennt ihn.
Den Kontakt zu ihm hat Gerrie Knetemann hergestellt, der Nationaltrainer. Ich könnte gut einen Manager gebrauchen, meinte Gerrie, für die Verträge und das Finanzielle – dann könnte ich mich voll und ganz auf die sportliche Seite meiner Karriere konzentrieren. Mit den besten Absichten empfahl er mir Hanegraaf. Er sagte: »Der Mann ist aalglatt, aber gut.«
Es ist November 2004, als Jacques bei uns zu Hause im Wohnzimmer sitzt. Wir sitzen am Esstisch. Ich trinke eine Limo, er und meine Eltern Kaffee. Ich bin nervös, irgendetwas an ihm macht mir ein ungutes Gefühl. Er redet den ganzen Abend. Er hat eine gute Geschichte zu erzählen. Er sagt, dass ich extrem viel Talent habe und es nur eine Frage der Zeit sei, ehe ich die größten Rennen der Welt gewinnen würde. Aber es würden nun mal auch eine Menge andere Dinge dazugehören. Profi zu sein, bedeute nicht nur trainieren, essen, schlafen und Rennen fahren – es gebe auch viele Nebenschauplätze zu beackern. Die Verhandlungen mit Teammanagern, Verträge mit Sponsoren, der Umgang mit den Medien – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ich bräuchte Menschen, die mich unterstützen. Ich bräuchte jemand, auf den ich jederzeit zurückgreifen könnte. Mit diesem »jemand« meint er sich selbst.
Er umgarnt mich und meine Eltern. Er macht große Versprechungen. Er appelliert an meinen Verstand, sagt mir, dass ich jetzt schon einer der gefragten Männer im Peloton sei. Alle Teams wollten mich unbedingt haben. Die Zukunft, das sei ich. Bei Rabobank sollten sie lieber Gott auf ihren nackten Knien danken, dass ich für sie fahren wolle. Und diese Dankbarkeit sollte sich Jacques zufolge auch in barer Münze ausdrücken. Ich müsste in meinem ersten Jahr als Profi mindestens zweihunderttausend Euro verdienen. Er erwischt mich an einem wunden Punkt; es ist genau das, was ich hören will. Er macht mich groß, er macht mich wichtig. Ich beschließe, mich mit ihm zusammenzutun. Wir sind uns einig, dass er versuchen wird, zweihunderttausend Euro für mich herauszuschlagen.
Es gibt nur ein Problem: Ich habe im Mai bereits einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Rabobank unterschrieben, für die Saisons 2005 und 2006 – und zwar für hunderttausend Euro im Jahr. Jacques findet das viel zu wenig. Er redet auf mich ein, dass ich mich damit nicht zufriedengeben darf. Dass wir versuchen sollten, den Vertrag aufzulösen. Und es funktioniert. Ich bin empfänglich für seine Worte. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, fand ich hunderttausend Euro eine Menge Geld; aber Jacques schürt Unzufriedenheit in mir. Seine Worte wirken auf mich wie ein rotes Tuch auf einen Stier. Ein Schalter legt sich um. Ich habe das Gefühl, dass die Dinge endlich die nötige Schärfe erhalten. Dies ist etwas anderes, als mit meinem Vater nach Breda zu fahren und mit pochendem Herzen und schlotternden Knien um ein paar tausend Euro mehr zu bitten. Jetzt geht es um richtiges Geld. Hunderttausend sind nicht genug. Meine Eltern können es nicht verstehen. Für sie sind hunderttausend Euro sehr viel Geld. Erst recht für einen so jungen Kerl wie mich. Aber sie haben ihren Einfluss auf mich schon verloren. Ich bin nicht so wie sie. Ich will mehr. Als Jacques am Ende des Abends in seinen Volvo steigt, hat er einen Keil zwischen mich und Rabobank getrieben.
Mehr, mehr, mehr – in meinem Inneren hauste ein Gefühl der chronischen Unzufriedenheit, aber es war bisher nicht mehr als ein Funke gewesen, der hin und wieder kurz aufloderte. Mit Jacques als Manager wird aus dem Funken ein Flächenbrand. Er und ich, das ist 1 + 1 = 3. Ich will Geld, er will Geld. Von allem, was ich verdiene – Gehälter, Boni, Startgelder – bekommt er zehn Prozent zuzüglich Mehrwertsteuer. Und Geduld kennen wir nicht. Mit Jacques mache ich keine langfristigen Pläne, wir schauen nicht in die Zukunft, wir reden nicht darüber, wo ich vielleicht in fünf oder zehn Jahren stehe. Keine Geduld. Bloß nicht warten. Nicht erst mal ein paar Jahre Profi sein. Wir wollen es jetzt.
Auf Anraten von Jacques ziehe ich kurz darauf nach Belgien. Nach Lanaken, kurz hinter der Grenze bei Maastricht. Dort leben mehrere niederländische Radprofis. Ich kann dort besser trainieren als in Nordholland und außerdem ist es steuertechnisch erheblich interessanter.
Jacques macht sich daran, meinen Vertrag mit Rabobank aufzulösen, bevor dieser offiziell überhaupt in Kraft getreten ist. Er schlägt vor, dass sie mein Gehalt verdoppeln: von hunderttausend auf zweihunderttausend Euro. Aber Theo de Rooij, der inzwischen Jan Raas als Teammanager abgelöst hat, geht nicht darauf ein. Er sagt, ich hätte einen gültigen Vertrag unterschrieben und dass hunderttausend Euro für einen Jungen von zwanzig Jahren doch sehr viel Geld seien. Ich solle erst mal eine komplette Saison als Profi fahren. Hanegraaf ist wütend. Und ich mithin auch. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich empfinde sie als geizig, die Leute von Rabobank. Was glauben die eigentlich, wer sie sind?
Ich bin immer noch ein Kind. Ich habe eine komplette Packung Kekse aufgegessen, aber ich will noch mehr. Und wenn ich nicht bekomme, was ich will, fange ich an zu quengeln. Es ist nicht genug, es ist nie genug. Das Gefühl, immer mehr zu wollen: Es frisst sich in meinen Körper hinein. Ich bin infiziert. Infiziert mit chronischer Unzufriedenheit.