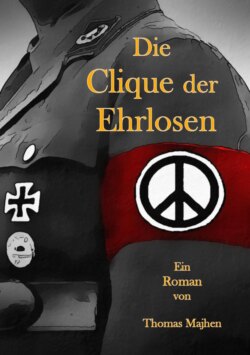Читать книгу Die Clique der Ehrlosen - Thomas Majhen - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 7
Mehr Aufregung als der Monat März mit sich brachte, wäre kaum zu ertragen gewesen. Viele der Schüler an der Augsburger Kreisoberrealschule hatten Brüder, Väter oder Onkel, die in der Armee dienten, und so sprach sich schon vor den Verlautbarungen in der Presse schnell herum, was sich an der Grenze zu Österreich abspielte. Man wusste zudem vom politischen Druck, den das Deutsche Reich seit einiger Zeit auf das Nachbarland ausübte, wie ernst sich die Lage tatsächlich ausnahm, das war hingegen kaum jemandem wirklich bewusst. Als sich die Gerüchte in Augsburg verbreiteten, wurde erstmals deutlich, dass die Gefahr einer gewaltsamen Auseinandersetzung nicht ausgeschlossen werden konnte. Bis zum 12. des Monats wurden im Grenzbereich rund 65.000 Soldaten zusammengezogen.
Christophs älterer Bruder Klaus leistete seinen Wehrdienst als Luftwaffensoldat auf dem Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg und versorgte seine Familie zuverlässig mit den neuesten, oft widersprüchlichen Gerüchten, die unter den Soldaten kursierten. Die Italiener würden einer Annexion Österreichs niemals ohne Entschädigung zustimmen, hieß es da zunächst. Dann glaubte man zu wissen, Mussolini sei außenpolitisch isoliert und daher gezwungen, eine Annäherung an Deutschland zu suchen. Ein anderes Mal war man sich sicher, Frankreich würde militärisch intervenieren, um einen Zusammenschluss mit allen Mitteln zu verhindern. Schließlich wurden österreichische Kommunisten verdächtigt, einen Aufstand zum Sturz der eigenen Regierung zu planen.
Nun war ein einfacher Wehrpflichtiger als Quelle verlässlicher diesbezüglicher Informationen denkbar ungeeignet. Am Ende war man sich doch wieder völlig im Unklaren darüber, was nun eigentlich tatsächlich vor sich ging und welche Positionen die europäischen Mächte dabei bezogen. Fest stand lediglich, und das bewiesen schon die Truppenverlegungen, die sich nicht geheim halten ließen, dass irgendetwas im Busche lag und die Gefahr eines Krieges nicht vollkommen von der Hand zu weisen war. Angst und Unsicherheit machten sich nicht nur bei der Familie Goeben, sondern in der gesamten Bevölkerung breit und man hoffte inständig, der Führer möge wissen, was er tue. Christophs Bruder Klaus hingegen gehörte zu jenen, die die Krise begrüßten und nicht den geringsten Zweifel an Hitlers politischem Genie hegten. Wie viele seiner Kameraden hätte er außerdem nur zu gerne gesehen, wie sich die junge deutsche Luftwaffe, deren hochmoderne Maschinen er Tag für Tag zu Gesicht bekam, im Kampf schlagen würde. Daraus allerdings wurde bis auf weiteres nichts.
Gegen Ende des Winters war die Regierung Österreichs bereits stark mit Nationalsozialisten durchsetzt, wenngleich die NSDAP zu dieser Zeit noch immer einem offiziellen Verbot unterlag. Es folgte die von Hitler durchgesetzte Legalisierung der österreichischen Nazi-Partei sowie die Vereinbarung über den Austausch von Offizieren, wodurch die Regierung weiter geschwächt wurde. Bald erschien es immer wahrscheinlicher, dass weder Italien, das sich an Deutschland annäherte, noch die Westmächte im Zuge ihrer Appeasement-Politik einschreiten würden. Hilflos und alleingelassen, gab Bundeskanzler Kurt Schuschnigg unter dem immensen Druck letztlich nach. Die an der Grenze stationierten deutschen Armee- und Polizeieinheiten rückten ungehindert in das Nachbarland ein, vielerorts wurden sie unter frenetischem Jubel von der Bevölkerung begrüßt. Dem sogenannten »Anschluss« von Hitlers Geburtsland wurde als weiteres Glanzstück von dessen politischem Genie allgemeine Bewunderung zuteil.
Als die Familie Goeben am Montag nach diesem ereignisreichen Wochenende gemeinsam am Frühstückstisch saß, schwebte dieser neuerliche Coup des Führers wie ein Gespenst über ihren Köpfen.
Zwar war neben Klaus, der bereits am Vorabend zum Fliegerhorst zurückgekehrt war, auch die Mutter durchaus angetan von den Ideen des Nationalsozialismus im Allgemeinen und dem charismatischen Führer im Besonderen, doch zeigte sich das Familienoberhaupt weit weniger begeistert. Mit finsterer Miene kaute Christophs Vater lustlos auf einem Stück Brot herum und blätterte in der Zeitung.
»Da soll einer aus euch Männern schlau werden.«, sagte die Mutter, der die gedrückte Stimmung von Vater und Sohn nicht entgangen war. »Endlich gibt es genug Arbeit und unser Land wird wieder zu dem, was es einmal war, und ihr beiden guckt drein wie sieben Tage Regenwetter.«
Der Vater sagte kein Wort, blickte nicht einmal von seiner Zeitung auf. Er war ein einfacher Mann mit einfachen Überzeugungen und bestritt als Vorarbeiter in einer Getriebefabrik den Unterhalt der Familie. Man konnte ihn getrost als unparteiisch bezeichnen, wollte er doch mit Fragen, die nicht unmittelbar seine Arbeit oder sein Privatleben betrafen, in Ruhe gelassen werden. Am liebsten war es ihm, wenn er unbehelligt seiner täglichen Routine nachgehen und sich aus allem anderen heraushalten konnte – ein Charakterzug, in dem sich Vater und Sohn nicht unähnlich waren. Seiner Meinung nach war es für einen anständigen Mann selbstverständlich, die Familie nach bestem Vermögen zu ernähren und sich nicht über die tägliche Mühsal zu beklagen. Sich daneben auch noch für politische Ideen zu interessieren, dafür besaß er keinen Sinn.
Trotz allem war er einmal von einem Kollegen verdächtigt worden, für die Kommunisten zu spionieren, wenngleich damals keinerlei Beweise gegen ihn vorgebracht werden konnten. Er wusste bis heute nicht, wer ihn in dieser Hinsicht angeschwärzt hatte, denn er besaß im Betrieb keine Feinde, jedenfalls keine, von denen er wusste. Die Urheberschaft der Denunziation blieb ein Geheimnis, man hatte ihn seinerzeit lediglich in das Personalbüro bestellt und mit den Vorwürfen konfrontiert. Trotz des Beweismangels war er nur dank seines guten Standes mit der Firmenleitung nicht sofort gekündigt worden, er war sich aber auch darüber im Klaren, dass er seither unter Beobachtung stand. Täglich rechnete er damit, erneut in ein Büro zitiert zu werden und am Ende möglicherweise seine Stelle zu verlieren. Noch hielten ihm seine Vorgesetzten den Rücken frei, auch war seit jenem Tag nie wieder etwas Derartiges an ihn herangetragen worden. Doch die Hyänen lauerten bereits, das merkte er an manch verstohlenem Blick, den er im Werk immer wieder auf sich ruhen spürte. Seiner Familie hatte der Vater von alldem nichts erzählt, da er einerseits keine unnötige Unruhe stiften wollte, andererseits weil er sich keiner Schuld bewusst war und daher keine Veranlassung sah, in seinem zu Hause darüber zu sprechen.
Was die bezüglich der jüngsten Ereignisse offen zur Schau gestellte Euphorie seiner Frau anging, die konnte er nicht teilen. Es kümmerte ihn nicht, ob Österreich nun zu Deutschland gehörte oder nicht, ob das Reich am Fuße der Alpen endete oder über sie hinausreichte, es erfüllte ihn nicht mit falschem Stolz, dass aus seinem Land nunmehr ein »Großdeutschland« geworden war. An seinem Leben änderte das eine so wenig wie das andere, wenn überhaupt, dann brachte es unter Umständen einige weitere Komplikationen mit sich. Wie zu befürchten stand, würde sich dadurch der nationale Eifer einiger Kollegen erneut entfachen und in neuen, gegen seine Person gerichtete Beschuldigungen äußern. Patriotismus schafft Feinde, echte wie eingebildete, wie er sehr wohl wusste.
Christoph erwiderte den Blick seiner Mutter, die ihn genauso verständnislos musterte wie seinen Vater, und zuckte mit den Schultern. Was hätte er auch sagen können? Die Fortschritte, die das Land derzeit erlebte, waren unverkennbar und sicherlich außerordentlich. Niemand konnte ernsthaft bestreiten, dass der Großteil der Deutschen heute ein besseres Leben führte als noch vor Jahren. Auch die technische Entwicklung und der Ausbau der Infrastruktur waren beeindruckend. Letzteres wurde besonders gut sichtbar in Form des Baus einer Autobahn zwischen Augsburg und Ulm. Besäße die Familie ein Automobil, könnte sie die letztgenannte Errungenschaft auch nutzen, allem Anschein nach war aber selbst ein sogenannter »Volkswagen« für jedermann bereits in Planung.
Sorgen bereitete Christoph, dass man sich in anderen Bereichen geradezu dramatisch bis auf eine Stufe zurück zu entwickeln schien, die dem Mittelalter zur Ehre gereichte. Zwar war er zu jung, um die Kaiserzeit noch erlebt haben zu können, auch kannte er die deutsche Monarchie lediglich aus dem Geschichtsunterricht sowie durch Erzählungen seines Vaters und Großvaters. Aber selbst damals hatte doch immerhin eine gewisse Ordnung geherrscht, die etwa Minderheiten vor Übergriffen schützte und ein Mindestmaß an persönlicher Freiheit garantierte. Doch so weit in die Vergangenheit musste man überhaupt nicht zurückgehen. Selbst Christoph hatte in den vergangenen fünf Jahren die zunehmenden Eingriffe in das Privatleben der Bürger trotz seines jungen Alters durchaus wahrgenommen. Fortschritt auf der einen Seite, Rückschritt auf der anderen – war das der Preis, den man zu zahlen hatte?
Auch Christoph kümmerte die von der Propaganda so betitelte »Heimholung ins Reich« herzlich wenig. Er bildete sich ein, die immer neuen Zwänge, die sich das Regime ausdachte, um den »Volkskörper« zusammenzuschweißen und »gesund zu erhalten«, würden ihm zunehmend die Luft abschnüren. Zuletzt hatte ihm sogar der Schuldirektor, vermutlich auf Drängen von Klassenvorstand Neumann, nahegelegt, er solle doch möglichst bald in die Hitlerjugend eintreten. Es sei ja nicht mehr lange, mit achtzehn Jahren könne er dann zügig den Reichsarbeitsdienst ableisten, sodann den Wehrdienst antreten und der Pflicht wäre Genüge getan. In drei Jahren wäre alles vorüber und sein Leben gehöre wieder ihm selbst. Sollte er sich allerdings weiterhin in dieser, die Hitlerjugend betreffenden Angelegenheit quer stellen, so der Direktor, wäre es nicht besonders rosig um Christophs Zukunft bestellt. Ohne die vorgesehenen Institutionen zu durchlaufen, brächte es heutzutage niemand mehr sonderlich weit. Christoph hatte hierzu lediglich genickt, unfähig oder unwillig irgendetwas zu erwidern.
Vor der Hitlerjugend drückte er sich schon seit Jahren, obwohl Michel wie auch Jan und viele seiner übrigen Klassenkameraden schon lange eingetreten waren. Aber der Gedanke, Mitglied dieses uniformierten Vereins zu werden und an all diesen politisch aufgeladenen Pfadfinderaktivitäten teilzunehmen, mit all den damit verbundenen strengen Vorschriften und Regeln, behagte ihm überhaupt nicht. Hinzu gesellte sich eine Besonderheit in der Organisationsstruktur der Hitlerjugend. Man konnte nämlich im Vorfeld nicht wissen oder sich gar aussuchen, in welche Schar, welche Gefolgschaft und welchen Stamm man aufgenommen wurde. Diese Herangehensweise, zu der sich die Reichsjugendführung entschieden hatte, sollte die Bildung von Gruppen verhindern, die schon vor dem Eintritt in die HJ miteinander bekannt oder befreundet waren. Zudem sollten dadurch alle sozialen Schichten vermengt, bestehende Unterschiede und Ungleichheiten zwischen den Jugendlichen verwischt werden. Es war also nicht zu erwarten, dass Christoph seinen HJ-Dienst gemeinsam mit Jan oder Michel würde verrichten können, weshalb dieser vielleicht einzige Anreizpunkt ebenfalls nicht vorhanden war. Sein bester Freund Jan hatte in der Vergangenheit schon mehrfach versucht, ihn zu einem Eintritt zu bewegen, letztlich aber Christophs konsequente Weigerung akzeptiert und irgendwann nicht mehr davon gesprochen.
Schmollend räumte die Mutter den Tisch ab, warf Ehemann und Sohn gelegentlich ärgerliche wie auch verständnislose Blicke zu. Christophs Vater, der sein Gesicht noch immer in der Zeitung vergraben hatte, büßte dabei ein erst halb aufgegessenes Wurstbrot ein, das ihm unter der Nase weggezogen wurde.
***
Nach dem Frühstück machte sich Christoph auf den Weg zur Schule. Auf seltsame Weise kam ihm die Stadt weniger geschäftig vor als sonst, dafür bildete er sich ein, sie sei aufgeregter und unruhiger. Er konnte nicht einmal genau bestimmen, was diesen Eindruck bei ihm hervorrief. Es schien, als liege etwas in der Luft: Der Gang der Passanten wirkte nervös, die Art, wie die Tram durch die Straßen polterte, schien lauter und wütender, die Pkws brausten gehetzter über die Fahrbahn. Diese eingebildete oder echte Unruhe übertrug sich bald auch auf Christoph, der unwillkürlich seine Schritte beschleunigte.
Gerade, als er den Königsplatz hinter sich gelassen hatte und eilig die Schießgrabenstraße überqueren wollte, machte es Bums! An einer Hausecke stieß er mit jemandem, der aus der anderen Richtung angelaufen kam und durch die Fassade nicht zu sehen gewesen war, zusammen. Allerhand Gegenstände flogen durch die Luft und landeten verstreut auf dem Bürgersteig.
Die andere Person gab ein erschrockenes »Huch!« von sich, Christoph stammelte nicht weniger erschrocken eine Entschuldigung – bis er hochrot anlaufend bemerkte, mit wem er da kollidiert war.
Mit einem Ausdruck in den grünen Augen, der wohl Überraschung verriet, aber auch etwas Unergründliches an sich hatte, stand Teresa vor ihm. Das offene braune Haar, durch den Zusammenstoß ein wenig in Unordnung gebracht, wallte ihr über die Schultern. Sie war nur etwas kleiner als Christoph und von athletischer Statur, der nicht eben sanfte Zusammenprall hatte sie kaum ins Wanken gebracht. Die Tasche, die ihre Fracht soeben ringsum entladen hatte, hielt sie noch in den Händen.
Als Christoph gewahr wurde, dass er Teresa wie eine Zirkusattraktion mit offenem Mund anstarrte, beeilte er sich, die verstreuten Gegenstände, darunter Bücher, Hefte und Stifte, aufzusammeln. Er entschuldigte sich mehrmals, wagte es dabei kaum aufzusehen.
»Du hast es aber eilig zum Unterricht zu kommen.«, sagte Teresa gar nicht böse, eher amüsiert, ging in die Hocke und half Christoph beim Einsammeln ihrer Schulsachen. »Ich habe schon gedacht, eine Tram hätte mich erwischt.«
Als Tochter tschechischer Einwanderer war Teresa im Alter von zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Dadurch, dass sie den größeren Teil ihrer Kindheit in der Tschechoslowakei verbracht hatte, sprach sich noch immer mit einem leichten Akzent. Am auffälligsten war dabei das »I«, das sie ein wenig über Gebühr in die Länge zu ziehen pflegte, sodass die Wörter aus ihrem Mund etwa wie »eilieg« und »erwiescht« klangen.
Christoph wusste nicht, was er darauf sagen sollte, er wusste überhaupt nicht, wie ihm gerade geschah. Eben noch in Gedanken beim Schuldirektor und der deprimierenden Vorstellung, der Hitlerjugend beitreten zu müssen, fand er sich unvermittelt seinem langjährigen Schwarm gegenüber. Am liebsten wäre er im Boden versunken.
Im Nu klaubten sie die Sachen vom Bürgersteig, Teresa geschmeidig wie eine Katze, Christoph mechanisch wie eine Holzpuppe. Danach richtete sich Christoph steif auf, trat mit einem Stapel Schulutensilien vor der Brust verlegen von einem Fuß auf den anderen und war schon mit der Frage überfordert, wohin er nur mit seinen Augen sollte. Hätte Teresa, die ihn erwartungsvoll musterte, nichts gesagt, wäre er noch für den Rest des Tages genauso stehen geblieben.
»Nun also, die letzten paar Meter können wir ja dann auch noch zusammen gehen – sofern dir das nicht zu langsam ist.«, stichelte Teresa und zauberte dadurch eine frische Röte in Christophs Gesicht.
Der nickte lediglich und wusste nicht wohin mit sich. Schon die simple Entscheidung, ob er einfach losgehen oder warten sollte, bis sich Teresa als erste in Bewegung setzte, ob er vor, hinter oder neben ihr gehen, ob er zuerst den rechten Fuß vor den linken oder den linken vor den rechten setzten sollte, überforderte ihn heillos.
»Das darfst du mir gerne geben.«, sagte Teresa, nachdem Christoph auch Sekunden später noch immer keinerlei Anstalten machte, ihr den Inhalt ihrer Tasche zurück zu geben.
»Ja.«, sagte er nur, sich wie ein Trottel fühlend, und beeilte sich, der Aufforderung nachzukommen.
Ganz wie von selbst, auch ohne, dass es hierfür wie von Christoph befürchtet ausgiebiger Planung bedurft hätte, setzten sie sich gleichzeitig in Bewegung. Sorgsam achtete Christoph darauf, Teresa nicht zu nahe zu kommen oder sie durch einen Zufall zu berühren. Schweigend ging er etwas nach hinten versetzt neben seinem heimlichen Schwarm her und sah sie dabei immer wieder verstohlen von der Seite an. Er wollte so diskret und unaufdringlich wie möglich wirken, um nur ja keinen falschen Eindruck zu erwecken. Vielleicht war ihm auch eher daran gelegen, nicht den richtigen Eindruck zu erwecken, so genau wusste er das selbst nicht, denn in seinem Innersten herrschte das reinste Chaos. Seine Brust fühlte sich an, als habe sich darin ein wildes Pferd losgerissen und galoppiere mit seinem Herzen davon, gleichzeitig rasten die Gedanken in seinem Kopf wie Elektronen um einen Atomkern. Sein gesamter Schädel schien einem unerhörten Druck ausgesetzt zu sein, wie ein Kessel voll Eintopf, der sich kurz vor dem überkochen befand. Er spürte, wie er zu schwitzen anfing, obwohl es draußen der Jahreszeit entsprechend noch immer kühl war, und für eine Sekunde glaubte er gar, sich eine Erkältung eingefangen zu haben. Es wollte ihm kaum gelingen, Ordnung in diese unmögliche Suppe zu bringen, die einmal als Christoph Goeben bekannt gewesen war. Nach einigen Minuten bemächtigte sich eine seltsame Mischung aus Glück, Erwartungsfreude, Bedrücktheit und Angst seiner.
Seitdem die Schule dazu übergegangen war, Jungen und Mädchen zu trennen und in gleichgeschlechtlichen Klassen zu unterrichten, hatte Christoph bei jedem Gang durch das Schulgebäude oder über den Hof darauf gehofft, Teresa zu erspähen, und sei es auch nur für einen flüchtigen Moment. Sie hier und jetzt in seiner unmittelbaren Nähe zu wissen, war mehr als er je zu hoffen gewagt hatte, schlimmer noch, es war weit mehr als er in diesem Moment verkraften konnte.
Krampfhaft suchte er nach etwas, das er zu ihr sagen könnte. Er wollte nicht wie ein stummer Idiot dastehen, stattdessen eine Mischung aus Selbstvertrauen und Gelassenheit zur Schau stellen – beides Eigenschaften, die im Augenblick nicht weiter von der Wahrheit hätten entfernt sein können. Er schluckte einen dicken Kloß herunter, straffte sich und gab sich einige Mühe, seiner Stimme Festigkeit zu verleihen. »Wie ist es so in deiner neuen Klasse?«, quetschte er hervor und war erschrocken darüber, wie heiser und brüchig das klang.
Teresa drehte sich zu ihm, schien von seinem plötzlichen Stimmbruch nichts zu merken und sagte fröhlich: »Eigentlich nicht viel anders als in der alten. Nur, dass wir jetzt ausschließlich Mädchen sind.«
Nichts könnte auch nur annähernd beschreiben, wie dumm Christoph sich vorkam. Diese Frage war wirklich zu bescheuert gewesen, wäre ihm doch bloß etwas Klügeres eingefallen. Beschämt senkte er den Kopf und begutachtete die Beschaffenheit des Bürgersteigs.
Der heitere Ausdruck auf Teresas Gesicht verschwand so schnell wie er gekommen war. Nicht, dass Christoph davon etwas bemerkt hätte. Wie er schien auch sie auf einmal ein reges Interesse an der städtischen Gehwegs-Architektur entwickelt zu haben.
Nach einer Weile verschaffte sie ihren Gedanken Ausdruck. »Das stimmt eigentlich gar nicht.«, sagte sie nachdenklich.
»Was?«, wollte Christoph wissen und glaubte, etwas überhört zu haben.
»Dass sich sonst nichts verändert hat. Es ist vieles anders geworden. Zum Beispiel ist der Matheunterricht auf ein Minimum gekürzt worden, ebenso Sport und die meisten anderen Fächer.« Sie sah Christoph an, ihre Augen leuchteten aufmüpfig. »Dafür haben wir jetzt Hauswirtschaft, Handarbeit und Pflege. Kannst du dir das vorstellen? Handarbeit, pah! Die können sich ihre Socken schön selber stopfen.«
Teresa war eine echte Leuchte, wenn es um Zahlen ging, das wusste Christoph. In Mathematik hatte sie stets zu den Klassenbesten gehört, was man von ihm nicht gerade behaupten konnte. Dass eines ihrer Paradefächer nun zu einem Nebenfach degradiert worden war, frustrierte sie verständlicherweise.
Christoph hätte sie gerne getröstet, wusste aber nicht wie. Noch immer steckte ein Kloß fest in seinem Hals, außerdem fürchtete er, seine Stimme könne sich wie bei einem Zwölfjährigen überschlagen. Mit einem Trick versuchte er, sich die Anspannung zu nehmen: Zunächst drehte er seinen Kopf soweit zur Seite, dass er Teresa nicht einmal mehr aus dem Augenwinkel erkennen konnte, dann stellte er sich vor, an ihrer statt ginge Jan neben ihm und habe soeben von seinen Schwierigkeiten im Hauswirtschaftsunterricht berichtet. Es funktionierte wirklich. Christoph musste grinsen, sammelte seinen Mut und versuchte es mit einem Scherz. »Wenn ich acht Paar Socken mit durchschnittlich drei Löchern besitze, zum Stopfen eines Loches 13 Minuten benötige, wie lange brauche ich dann, bis ich im Sportunterricht wieder ungeniert meine Schuhe ausziehen kann?«
Was folgte, waren bange Sekunden, ob der Witz geglückt war oder nicht. Schon biss sich Christoph auf die Lippen, kratzte sich am Kopf und hätte sich am liebsten selbst geohrfeigt. »Was für eine selten dämliche Rechenaufgabe«, fluchte er innerlich, »und was für ein selten dämlicher Idiot, der sich sowas ausdenkt.«
Dann fing Teresa zu seiner großen Überraschung an zu kichern. Dabei öffnete sie ihren Mund nur ein ganz kleines Stück, sodass lediglich die untere Kante ihrer oberen Frontzähne zu sehen war. Das Geräusch, das sie bei dieser besonderen Form des Kicherns von sich gab, war kaum zu hören, es bestand aus kurzen, schnellen Atemstößen und etwas, das wie ein leises Stöhnen klang.
Christoph stellte sich vor, dass es wohl genau so klingen müsste, wenn Kaninchen lachen könnten. In diesem Moment war es für ihn das schönste Geräusch der Welt.
Wenig später bogen Teresa und Christoph in die Hallstraße ein. Diese war weder besonders breit noch sonderlich lang, insgesamt maß sie von einem Ende zum anderen nur rund dreihundert Meter. Auf halber Strecke befand sich das ehemalige Dominikanerinnen-Kloster St. Katarina, in dem seit 1877 die Kreisoberrealschule untergebracht war, und so konnte man schon von der Einmündung der Straße aus erkennen, was vor dem Schulgebäude vor sich ging.
Dort hatten sich die meisten Schüler und Lehrer bereits auf dem winzigen, an die Fahrbahn angrenzenden Vorplatz zum Fahnenappell versammelt. Soweit schien alles normal. Anders als sonst lümmelten sie jedoch nicht in unordentlichen Grüppchen umher – was üblicherweise für Lehrer und Schüler gleichermaßen galt –, sondern standen auf wundersame Weise ordentlich nach Klassen, mit den jeweiligen Klassenlehrern an der Spitze, aufgereiht da. Das Bild, das sich dem Beobachter darbot, erweckte mehr den Eindruck eines Kasernenhofs als den eines Schulvorplatzes.
Teresa und Christoph wunderten sich sehr und sahen sich zur Eile genötigt. Ohne auch nur noch ein weiteres Wort miteinander zu sprechen, trennten sie sich, suchten ihre Klassen und reihten sich in die Menge ein.
Christoph entdeckte Jan und Michel und drängelte sich zwischen sie.
Niemand sagte etwas, Jan sah stumm und streng nach vorn, Michel nickte ihm zur Begrüßung zu, Peter glänzte durch Abwesenheit. Obwohl er nicht zu spät gekommen war, quittierte Klassenvorstand Ulrich Neumann Christophs Erscheinen mit gerunzelter Stirn und zusammengekniffenen Augen.
Die Blicke seines Lehrers waren ihm unangenehm, gleichzeitig war er wütend auf ihn, weil er seiner Vermutung nach gerade diesem das kürzliche Gespräch beim Direktor zu verdanken hatte. Er versuchte den Klassenvorstand zu ignorieren und sich abzulenken. Den Kopf wendend und reckend, fahndete er nach Teresas braunem Haarschopf, konnte ihn aber nicht finden. Dann glaubte er sie zu entdeckt zu haben, doch wurde sie halb von der Schulter einer großen Mitschülerin verdeckt, sodass er sich letztlich nicht ganz sicher sein konnte. »Komisch«, wunderte er sich, »ständig verliere ich sie aus den Augen.«
Nach einer Weile trat der Schülersprecher an den Mast, um die Fahne zum morgendlichen Apell aufzuziehen. Heute assistierten ihm zwei weitere Schüler, die wie er die Uniform der Hitlerjugend trugen. Auch das unterschied diesen Morgen von allen anderen, war für gewöhnlich doch für das Hissen der Flagge eine Person ausreichend. Zackig und mit erhabener Feierlichkeit ging das Prozedere vonstatten, nicht einmal ein verhaltenes Gähnen war aus den Reihen der versammelten Schülerschaft zu hören, und schon flatterte das Hakenkreuz über dem Platz.
Wie üblich platzierte sich unmittelbar darauf der Schuldirektor im Schatten der Flagge. Wiederum war eine Abweichung von der Norm festzustellen, denn anders als sonst wirkte der feiste Mann nicht im Geringsten schüchtern oder unbehaglich, auch begnügte er sich heute nicht damit, die Schüler mit Verweis auf den in Kürze beginnenden Unterricht in die Klassenzimmer zu schicken. Mit geschwollener Brust und ausladendem Bauch baute er sich auf, rückte seine Brille zurecht und schaute mit einer Strenge in die Runde, die man ihm nicht so recht abnehmen wollte. Die Schüler wussten längst, dass ihr Direktor zwar gerne die Haltung eines preußischen Bürokraten mimte, in Wahrheit aber ein gutmütiger Mann war.
Nach einem volltönenden Räuspern hob er zu einer Rede an. »Wie Sie alle vermutlich unlängst wissen, ist unserem Führer an diesem Wochenende ein epochaler Erfolg geglückt.«
Schon nach diesem ersten Satz hielt der Direktor den Einbau einer Pause für erforderlich. Vermutlich wollte er damit den verschlafenen Köpfen der Schüler etwas Extrazeit einräumen, damit seine Einleitung in sie hineinsickern konnte.
Die Linke hinter dem Rücken auf den breiten Backen seines Gesäßes ruhend, die Rechte zur Faust geballt und zur Unterstreichung des Gesagten immer wieder vorschnellend, fuhr er fort. »Als meisterhafter Staatslenker, dessen Name fortan in einem Zuge mit den ganz Großen der deutschen Geschichte wie Bismarck oder Friedrich dem Zweiten genannt werden wird, hat er innerhalb weniger Wochen vollbracht, was anderen vor ihm in einem ganzen Zeitalter nicht gelungen ist.«
Erneute Pause. Die Faust verharrte in der Luft, der dicke Bauch sackte ein Stück nach unten. Der Mund stand einige Sekunden lang offen, als befände sich eine dampfend heiße Kartoffel darin. Diesmal konnte man nicht ganz sicher sein, ob der Direktor nicht den Faden verloren hatte.
Glücklicherweise sah sich sein Gehirn bald wieder dazu in der Lage, weitere Sätze zu formulieren. Nun lief es flüssiger und ohne ungewollte Unterbrechung. »Unsere deutschen Brüder im Süden sind endlich mit uns in einem gemeinsamen Vaterland vereint. Nach den schrecklichen Demütigungen des vergangenen Krieges hat uns der Führer in eine großartige Zeit geführt, womöglich erleben wir unter seiner brillanten Staatsführung sogar den Beginn eines goldenen Zeitalters für unsere Zivilisation.« Von neuem Selbstvertrauen erfüllt, drehte der Direktor seinen Oberkörper von links nach rechts und blickte dabei fest in die Gesichter von Lehrern und Schülern. »Sie dürfen stolz sein. Stolz darauf, hier und heute stehen zu dürfen und Zeugen eines neuen Deutschlands zu werden. Zollen wir dem Führer Respekt mit einem dreifachen – Sieg!«
»Heil!«
»Sieg!«
»Heil!«
»Sieg!«
»Heil!«
Mit einer Begeisterung, die Christoph nicht für möglich gehalten hätte, war die Menge der Schüler und Lehrer dem Aufruf des Direktors gefolgt. Sie waren nicht die einzigen geblieben.
Auf der Straße hatten Passanten in ihrem Treiben respektvoll innegehalten, sogar ein Automobil war stehengeblieben, Fahrer und Beifahrer waren ausgestiegen und hatten sich dem Fahnengruß angeschlossen. Man hätte den Eindruck gewinnen können, als handle es sich nicht um das übliche Morgenzeremoniell einer Schule, sondern um einen offiziellen Aufmarsch der Partei.
Auch sich selbst hatte Christoph dabei ertappt, wie er beinahe in die Siegheil-Rufe eingestimmt wäre. Erschrocken musste er eingestehen, dass es nicht einfach war, dieser Euphorie, die in der Menge wie ein heißer Dunst vor und zurück wogte, zu widerstehen. Er hatte gespürt, wie er von einer Welle der Begeisterung mitgerissen zu werden drohte, ob er das nun wollte oder nicht. Nein, das war nur die halbe Wahrheit, denn für den Bruchteil einer Sekunde wollte er sich mitreißen lassen. Es war so einfach und naheliegend erschienen, hatte sich seltsam natürlich angefühlt, wie alle anderen um ihn herum ein ekstatisches »Heil!« hinauszubrüllen. Nur mit Mühe hatte er sich zurückhalten können, sehr wahrscheinlich war es ihm nur deshalb gelungen, weil ihn die spektakuläre Geräuschkulisse in Staunen versetzt und vom Brüllen abgehalten hatte.
Nun, da der Moment des Wankens überstanden war, fühlte er sich konfus, als habe er allen Grund sich zu schämen. Wofür er sich schämen sollte, das wusste er nicht. Vielleicht, weil er sich nicht an den Heilrufen beteiligt hatte. Möglicherweise auch deshalb, weil sich etwas in ihm danach sehnte, wie alle anderen zu sein, sich fallen und wie ein toter Fisch vom dahinfließenden Strom treiben zu lassen. Nur knapp hatte dieses Mal sein Eigensinn, seine naturgegebene Widerborstigkeit, die er sich manches Mal vorhalten lassen musste, den Sieg davongetragen.
Auch in Christoph steckte also ein toter Fisch, und der hatte gerade kräftig mit der Schwanzflosse geschlagen.
***
Trotz dieses aufwühlenden und außerordentlichen Starts in den Schultag verlief der Unterricht wenig spektakulär. Klassenlehrer Neumann behelligte die Schüler nicht einmal mit den üblichen Sticheleien und Bosheiten. Vermutlich fühlte der sich im Augenblick des aktuellen nationalen Triumphes zu erhaben, um sich zu einer Schelte eines unbedeutenden Schülers herabzulassen. Jedenfalls beließ er es dabei, einige Male, wenn jemand eine Frage falsch beantwortete oder dem Unterricht nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenkte, geringschätzig mit den Augen zu rollen oder angewidert die Nase zu rümpfen. Zu Christophs Überraschung blieb sogar der erwartete Monolog zur Großartigkeit von Führer und Reich aus.
Seine Freunde zeigten sich von den Ereignissen erstaunlicherweise nur wenig bis gar nicht beeindruckt. Peter kam wie immer zu spät und tauchte erst kurz vor Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer auf, Michel präsentierte seine normale Leichenblässe und wirkte gewohnt besorgt, nur Jan schien sonderbar reizbar zu sein und erwies sich als wortkarg. Christoph kannte seinen Freund gut genug um zu wissen, dass es in einem solchen Fall am besten war, ihn einfach in Ruhe zu lassen und nicht mit Fragen zu bedrängen. Zu gegebener Zeit würde er ganz von selbst mit der Sprache herausrücken und erzählen, was sein Gemüt belastete. Außerdem war Christoph im Augenblick mit seinen eigenen Sorgen zu beschäftigt, um sich über die Laune seines Klassenlehrers oder die Stimmung seiner Freunde allzu viele Gedanken zu machen.
In den vergangenen Wochen und Monaten war es immer offenbarer geworden, dass er um eine, wenn auch kurze, Mitgliedschaft in der Hitlerjugend nicht herumkommen würde. Nicht zuletzt das Gespräch mit dem Schuldirektor hatte Christoph deutlich vor Augen geführt, wie es um die Aussichten auf einen Studienplatz stand, wenn man sich dem widersetzte. Und ein Studium erschien Christoph zunehmend attraktiv, jedenfalls wenn er die Alternative, wie sein Vater als Arbeiter in einer Fabrik zu enden, bedachte. Seine Noten, nun ja, die waren nicht sonderlich atemberauben, aber das Abschlussjahr stand erst noch bevor und so hatte er den Entschluss gefasst, ab sofort das Musterbeispiel eines fleißigen und lernwilligen Schülers abzugeben. Was natürlich nichts daran änderte, dass er sich noch an diesem Nachmittag beim zuständigen Ortsgruppenleiter der Hitlerjugend melden musste. Dank der Erzählungen von Jan und Michel besaß Christoph ein recht klares Bild davon, was ihn dort erwartete – und er verspürte nicht die geringste Lust auf Lagerfeuer, Gesang und kindische Kriegsspiele.
Nach Schulschluss standen die Freunde noch für einige Minuten zusammen auf dem Schulhof, während die Masse der anderen Schüler eilig an ihnen vorbeiströmte und sich ausgelassen auf den Heimweg begab. Jan äußerte den Vorschlag, noch auf ein Bier im Ratskeller einzukehren.
Peter schüttelte eifrig den Kopf. »Geht nicht, ich bin gerade ziemlich blank. Mein Alter scheint was gemerkt zu haben, neuerdings lässt er seine Geldbörse kaum mehr aus den Augen. Wenn ich bloß wüsste, wo er …«
Jan wollte diesen Einwand nicht gelten lassen. »Schon gut, ich geb' einen aus.«, sagte er, Peter misstrauisch beäugend. Er schien zu überlegen, ob das nur eine raffinierte Masche von ihm war.
»Da kann ich wohl schlecht nein sagen.«, stellte Peter freudestrahlend fest und erhärtete damit nur Jans Verdacht.
Michel zuckte schwach mit den schmalen Schultern, was gemeinhin als Zustimmung gewertet wurde.
»Was ist mit dir?«, wurde Christoph gefragt, der als einziger weder zugestimmt noch abgelehnt hatte.
Er machte ein betrübtes Gesicht und druckste herum. »Kann nicht, Termin.«
»Du hast wohl was Besseres vor, wie?«, bohrte Jan und fixierte seinen Freund. Einige Sekunden lang sagte er nichts, starrte nur, wartete, dass der andere laut aussprechen würde, worüber er schon längst Bescheid zu wissen glaubte. Dann plötzlich, als sei er des Wartens bereits überdrüssig, entspannte er sich. Mit der Hand machte er eine wegwerfende Bewegung. »Dein Termin ist verstrichen.«, verkündete er und betonte dabei das Wort »Termin« überdeutlich. »Die ist schon weg, keine drei Meter vor mir zum Tor raus.«
»Das … ich … nein.«, stotterte Christoph, der zunächst gar nicht begriff, worauf Jan da gerade anspielte. Dann dämmerte ihm, dass der wohl gesehen haben musste, wie Teresa und er am Morgen zusammen zur Schule gekommen waren.
Peter und Michel schienen als einzige nicht recht zu begreifen, worum es zwischen Jan und Christoph gerade ging. Fragend sahen sie sich an.
»Habt ihr was am Laufen, oder was soll die Geheimniskrämerei?«, obsiegte Peters Neugier.
Schließlich rückte Christoph mit der Sprache heraus. »Ich muss gleich noch in die Kanalstraße.«
Auf diese Offenbarung hin reihte sich Jan, verblüfft von der unerwarteten Wendung, in die Gruppe der Ahnungslosen ein. »Wie jetzt?«
»Was willst du denn da?«, wollte Michel unschuldig wissen.
»Nicht dein Ernst?«, fragte Peter und zog dabei eine vorwurfsvolle Grimasse.
Die Angelegenheit war Christoph unangenehm. Dass ihn seine Freunde mit offenen Mündern anstarrten, machte es nicht leichter. Seit Jahren weigerte er sich nun schon, der Hitlerjugend beizutreten. Gegen alle Überredungsversuche, sei es von Seiten seiner Freunde, seiner Mutter oder seiner Klassenkameraden und Lehrer, hatte er sich stets unnachgiebig gezeigt. Je länger er seine verweigernde Haltung aufrechterhielt, desto schwerer fiel es ihm, vom einmal eingeschlagenen Kurs abzuweichen. Jetzt kleinbeizugeben, glich dem Eingestehen einer Niederlage oder eines Irrtums, an dem man lange Zeit festgehalten hatte. Er fühlte sich beschämt, beinahe erniedrigt, wie jemand, der eine böse Schlappe davongetragen hatte. Kaum wagte er seinen Freunden in die Augen zu schauen. »Das habe ich alles nur diesem Dreckskerl Neumann zu verdanken.«, sagte er wütend, auch um von seinen wahren Gefühlen abzulenken. »Beim Direktor angeschwärzt hat er mich, dieser Hund. Aber der soll mich schon noch kennenlernen, und wenn ich ihm nachts vor seiner Wohnung auflaure und ihn mit Pferdemist bewerfe!« Dass eine solche Herangehensweise seinem ursprünglichen Plan, sich fortan wie ein Musterschüler zu verhalten und seine Noten drastisch zu verbessern, widersprach, merkte er in diesem Moment nicht.
»An sich eine schöne Idee.«, bemerkte Peter vergnügt und malte sich im Geiste bereits aus, wie sich die »Operation Pferdemist« in die Tat umsetzen ließe. »Wenn du noch jemanden brauchst, der zufällig weiß, wo es die saftigsten Pferdeäpfel gibt ...«
»Weißt du das auch sicher, dass er dich angeschwärzt hat?«, wollte Michel wissen.
»Ihr kennt doch unseren werten Herrn Direktor. Dem wäre es wohl herzlich egal, ob nun einer seiner Schüler der HJ beitritt oder nicht. Aber ein Feigling ist er eben auch. Und ihr kennt unseren Neumann.«
Die Überraschung war aus Jans Gesicht gewichen, stattdessen wirkte er erleichtert, geradezu heiter. Mit seiner Linken hieb er Christoph kraftvoll auf die Schulter, dass es knallte. »Lass dir mal nicht gleich die Laune verderben. So schlimm ist das nicht, wirst schon sehen. Nach zwei, spätestens drei Wochen hast du dich eingewöhnt. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du ein paar neue Talente und wirst in einigen Jahren zum Gauleiter von Schwaben ernannt.«
Trotz des guten Zuredens fühlte sich Christoph nicht besser. Der beklemmende Druck in seiner Brust hatte im Gegenteil sogar zugenommen. Alles, was ihm noch blieb, war die leidige Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Also verabschiedete er sich von seinen Freunden und machte sich zu Fuß auf den Weg in die etwa dreißig Minuten entfernte Kanalstraße. Mit dem Bus hätte er sein Ziel wesentlich schneller erreicht, doch einerseits sah er keine Veranlassung, dort früher anzukommen als unbedingt nötig. Andererseits verlangte es ihn wie immer, wenn ihn etwas beschäftigte, nach einem Spaziergang, um die Zeit zum Nachdenken zu nutzen.
Zum einen gab es da diesen Zusammenprall mit Teresa von heute Morgen, der nach einer eingehenden gedanklichen Betrachtung verlangte. Christoph ließ die Situation noch einmal Revue passieren, spürte erneut wie ihr kleiner drahtiger Körper gegen seinen stieß, sah die Schulutensilien durch die Luft segeln. Er erinnerte sich an ihr in Unordnung geratenes Haar, ihre grünen Augen, ihren Duft, als sie neben ihm hergegangen war, ihre Stimme, als sie sich unverbindlich unterhalten hatten. Teresa hatte mit ihm wie mit einem gewöhnlichen Menschen gesprochen, so als wäre überhaupt nichts dabei, als sei es das Normalste von der Welt. Normal war es für ihn ganz und gar nicht, und dennoch hatte er sich dabei nicht so dumm angestellt, wie er befürchtet hatte. Tatsächlich war es ihm sogar gelungen, Teresa durch einen Scherz zum Schmunzeln zu bringen – eine Leistung, die er sich selbst hoch anrechnete und die seinem Gang eine besondere Leichtigkeit verschaffte. Ein warmes Kribbeln erfüllte Christoph, während er über all dies nachdachte.
Dann kam ihm ein Gedanke. Obwohl er nicht genau wusste, wo Teresa wohnte, und er ihr, trotzdem sie jahrelang eine gemeinsame Klasse besucht hatten, noch nie zuvor auf dem Weg zur Schule begegnet war, ließ ihr Zusammentreffen nur einen Schluss zu. Zumindest den letzten Abschnitt des Schulweges ab der Ecke Königsplatz/Schießgrabenstraße mussten sie gemeinsam haben. Dass er sie dort zum ersten Mal getroffen hatte, dafür gab es verschiedene Erklärungen. Möglicherweise war sie erst kürzlich mit ihren Eltern umgezogen, vielleicht hatte sie aber auch an diesem Morgen einen Umweg gemacht. Christoph beschloss, ab sofort das Haus einige Minuten früher zu verlassen und an eben jener Stelle, wo er mit Teresa zusammengestoßen war, zu warten. Natürlich würde er es so einrichten, dass es wie ein Zufall erschiene, wenn sie sich begegneten. In seiner Vorstellung malte er sich schon aus, wie sie fortan die letzten Meter gemeinsam zurücklegen und miteinander scherzen würden. Er dachte an Teresas Lachen, das Lachen eines Kaninchens, und war für einen flüchtigen Augenblick sehr zufrieden mit sich und der Welt. Derart vertieft in solcherart Gedanken, vergaß Christoph beinahe, wohin er gerade unterwegs war.
Als er um eine Straßenecke bog, sprang ihm ein Lkw ins Auge, der mitten auf der Straße parkte. Eine Gruppe von Männern in brauner SA-Uniform war gerade dabei, von der Ladefläche des Lkws abzusitzen. Unmittelbar dahinter, in der Tür eines Geschäfts mit der Aufschrift »Israel Nachtmann, Optiker«, stand ein kleiner, untersetzter, gut gekleideter Mann – der Besitzer, wie Christoph schlussfolgerte – und blickte verängstigt auf einen der Uniformierten.
Bedrohlich, die Hände in die Hüften gestemmt, hatte sich ein besonders großer SA-Mann breitbeinig vor ihm aufgebaut, knurrte etwas Unverständliches und stieß den Ladenbesitzer grob mit beiden Händen ins Geschäft.
Von der Wucht unerwartet getroffen, strauchelte der Ladenbesitzer und wäre fast gestürzt. Dann verschwand er, angetrieben vom Anführer des Trupps, aus Christophs Sichtfeld im Inneren. Kurz darauf erschien der Uniformierte wieder in der Tür und winkte seine Kameraden zu sich.
Jäh durch das, was in der Straße vor sich ging, in die Realität zurückgeholt, bemerkte Christoph erst jetzt, dass sich unweit des Lkws zwei Polizisten aufhielten. Scheinbar unbeteiligt, der eine die Arme hinter dem Rücken verschränkt, der andere die Daumen in den Gürtel gesteckt, beobachteten sie, wie das braune Rollkommando lärmend und grölend das Ladengeschäft stürmte.
Nur wenige Augenblicke später – Christoph war in normalem Tempo weitergegangen, um nicht aufzufallen – lag der Schauplatz auch schon hinter ihm. Der Lärm wurde unterdes stärker, Rufe und Gelächter erschallten, eine Scheibe zerbarst klirrend in tausend Splitter. Christoph widerstand dem Drang sich umzudrehen und zu beobachten, was weiter geschehen würde. Das war kein leichtes Unterfangen, neigen Menschen doch im Angesicht von Aufruhr und Gewalt dazu, eine beinahe sadistische Faszination zu entwickeln. Nur die Angst mag so manches Mal noch größer sein als die Lust am Spektakel. So verhielt es sich auch in Christophs Falle, wenngleich Furcht völlig unbegründet war, gab es doch nichts, das er von den Schlägern zu befürchten gehabt hätte. Dennoch trieb ihn ein ungutes Gefühl vorwärts, wie ein Fuchs, der spürt, dass ihm die Hunde dicht auf den Fersen sind. Er wollte fort.
Wenige Meter bevor er die nächste Querstraße erreichte, begann er zu laufen und wurde erst wieder langsamer, als von dem Krach nichts mehr zu hören war. Obwohl er wusste, wie lächerlich das war, drehte er sich um und hielt Ausschau, ob man ihn verfolgte.
Natürlich folgte niemand Christoph. Das vage Gefühl, beobachtet zu werden, blieb. Hinzu gesellte sich ein beunruhigender Gedanke, der Urheber seiner irrationalen Angst sein mochte: Er fragte sich, ob er ebenfalls bald auf einem solchen Lkw sitzend durch die Stadt gefahren würde, um an derartigen Überfällen teilzunehmen. Wie sollte er reagieren, wenn das von ihm verlangt würde? Würde er sich einfach fügen oder gar mitmachen? Konnte er sich weigern? Diese Fragen bereiteten Christoph ernsthafte Sorgen, während er seinen Weg fortsetzte. Noch einmal hatte er das ängstliche Gesicht des winzigen Männchens in der Tür des Ladens vor sich und empfand Mitleid. Ob im äußersten Fall aber das Mitgefühl oder die Angst vor seinen neuen »Kameraden« die Oberhand gewinnen würde, das konnte er nicht sagen. Und er hoffte inständig, dass er es niemals herausfinden musste.
Christoph versuchte sich abzulenken, wollte den Schlägertrupp und den armen Besitzer des Geschäfts aus seinem Kopf verbannen, stattdessen wieder an Teresa denken. Es gelang ihm nicht. In düsterer Stimmung erreichte er sein Ziel: ein freistehendes, schmales, zweistöckiges Gebäude, an dessen Rückseite ein kleiner Bach vorbeifloss. Von außen betrachtet war nicht zu erkennen, dass es sich um ein Heim der Hitlerjugend handelte, denn es waren weder Fahnen noch Wimpel noch sonst irgendetwas in dieser Art zu sehen. Es gab nichts, wodurch es sich von einem gewöhnlichen Gebäude unterschied.
Christoph glaubte schon, sich in der Adresse geirrt zu haben. Zögerlich ging er zum Eingang, um nachzuforschen, ob er sich am richtigen Ort befand. Als er die Tür öffnete und hindurchging, kam ihm eine Gruppe Gleichaltriger in der Uniform der Hitlerjugend entgegen. Mit einem von ihnen, der im Gehen redete wie ein Wasserfall und nicht darauf achtete, wohin er trat, wäre er beinahe zusammengestoßen.
Der Junge, ein frech aussehender rothaariger Kerl mit Sommersprossen, zuckte zurück, verharrte einen Augenblick verblüfft und musterte Christoph von oben bis unten. »Hast dich wohl in der Hausnummer geirrt, was? Die Klosterknaben sind zwei Straßen weiter.«, machte er sich über ihn lustig. Sich zuvor vergewissernd, dass die anderen über seinen Witz lachten, rempelte er Christoph beim Hinausgehen absichtlich an und verschwand nach draußen.
Seine Kameraden enttäuschten den Burschen nicht, folgten ihm lachend und grinsten Christoph schadenfroh ins Gesicht. Alle bis auf einen.
Der letzte in der Gruppe blieb vor Christoph stehen. Nicht unfreundlich, wohl auch ein wenig beschämt über das Verhalten der anderen, wies er ihm den Weg. »Bis zum Ende und dann rechts, wenn du dich anmelden willst. Der Moosbacher verpasst Torben gerade einen Einlauf, aber lass dich davon nicht abschrecken. Eigentlich ist der ganz in Ordnung.«, sagte der Junge, beeilte sich sodann, seine Gruppe einzuholen.
Bevor Christoph sich bedanken konnte, befand er sich allein im Flur. Er tat wie ihm geheißen, folgte dem Gang bis zum Ende und wollte schon an die angelehnte Tür klopfen, als er hörte, wie drinnen jemand laut und ärgerlich sprach. Offenbar war der erwähnte »Einlauf« noch immer in vollem Gange.
»Sie sind doch keine zwölf mehr, Mann, also reißen Sie sich in Zukunft gefälligst zusammen!«, schimpfte eine Männerstimme. »Den Jüngeren ein Vorbild sein, das sollten Sie! Stattdessen haben Sie dieselben Flausen im Kopf wie ein Bubi, der noch immer an Muttis Rockzipfel hängt.«
Christoph konnte durch den schmalen Türspalt nicht sehen, wer da sprach, auch war von demjenigen, der als zwölfjähriger Bubi bezeichnet worden war, nicht der leiseste Mucks zu vernehmen. Fast hätte man meinen können, der Mann, bei dem es sich um diesen Moosbacher handeln musste, führe ein aufgeregtes Selbstgespräch.
Es folgte eine kurze Pause, dann die Entlassung des Gerügten.
»Wenn mir so etwas noch einmal zu Ohren kommt, dann fliegen Sie hier hochkantig raus. Und jetzt verschwinden Sie.«
Die Tür wurde ruckartig aufgezogen. Mit hochrotem Kopf und glasigen Augen drängte sich ein Junge von sechzehn oder siebzehn Jahren hastig an Christoph vorbei. Die Sicht in das enge, büroartig eingerichtete Zimmer war frei.
Den Kopf auf die Faust gestützt, saß ein etwa Vierzigjähriger in feldgrauer Wehrmachtsuniform da und notierte etwas auf ein Blatt Papier. Sein Schopf war mit kurzgeschorenen braunen Haaren bedeckt, nur an den Schläfen leuchteten zwei weiße Büschel aus dem Braun heraus. Sein Gesicht war glattrasiert, dennoch schimmerten zahllose dunkle Stoppeln durch die blasse, von blauen Äderchen durchzogene Haut. Ohne von dem Blatt aufzusehen, griff der Mann nach einer glimmend auf einem Aschenbecher abgelegten Zigarette und nahm einen hastigen Zug.
Widerwillig trat Christoph ein. Er musste sich zwingen, nicht auf dem Absatz kehrt zu machen und das Gebäude so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Unwillkürlich musste er an den Schlägertrupp von vorhin denken, das gleiche Unbehagen stieg erneut in ihm hoch. Als er sich inmitten des schmalen Raums befand, hätte er sich am liebsten übergeben.
Eigentlich hatte Christoph einen weiteren Hitlerjungen erwartet, denn das proklamierte Prinzip »Jugend wird durch Jugend geführt« wurde innerhalb der NS-Jugendorganisationen konsequent umgesetzt. Dass es aber auch Ausnahmen davon gab, vor allem dann, wenn sich die jungen HJ-Führer als der Aufgabe nicht gewachsen erwiesen, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Jetzt nicht einem jungen Erwachsenen, sondern einem echten Soldaten in Wehrmachtsuniform gegenüberzustehen, machte es für Christoph auf eigentümliche Weise noch schlimmer. Die braune Kleidung der Sturmabteilung, die derjenigen der Hitlerjugend nicht unähnlich war, hatte auf ihn immer seltsam unpassend gewirkt, weniger uniformhaft, mehr wie eine Verkleidung. Das Feldgrau der Armee hingegen strahlte Autorität aus und verfehlte seine Wirkung nicht. Ohne ein Wort zu sagen, stand Christoph einfach da und wartete darauf, angesprochen zu werden.
»Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«, richtete sich der Mann an ihn.
Christoph spürte, wie er unter seinem Hemd zu schwitzen begann. Gab es an der einen Stelle seines Körpers zuviel Flüssigkeit, war an anderer zu wenig vorhanden, denn sein Mund war ausgetrocknet wie eine Wüste. Nur mit Mühe brachte er hervor: »Goeben, Christoph, ich melde mich zur Hitlerjugend.« Er hatte versucht, militärisch zu klingen, tatsächlich aber war ein unbeholfener Satz herausgekommen, der so gar nicht nach ihm klang.
Der Mann wirkte unbeeindruckt, zeigte dafür Anzeichen unterdrückter Belustigung. Sein linker Mundwinkel krümmte sich für den Bruchteil einer Sekunde nach oben, kehrte danach sofort wieder in seine neutrale Ausgangsstellung zurück. Bevor er antwortete, gönnte er sich noch einen Zug seiner Zigarette. »Sie meinen wohl, Sie würden sich gerne anmelden, nicht?«, korrigierte er, im Tonfall deutlich milder als zuvor.
An Christophs Aufregung änderte das allerdings nichts, er bemerkte die Tonänderung nicht einmal. Der Schweiß trat ihm nun auch auf die Stirn und er wusste nicht, was er als Nächstes sagen sollte.
»Nun entspannen Sie sich erst einmal, wir sind hier nicht beim Militär.«, ließ sich der Mann vernehmen und spottete damit seiner eigenen soldatischen Erscheinung.
Christoph erschien das sonderbar, er überlegte, ob er etwa auf den Arm genommen wurde. Vielleicht war es auch eine Art Aufnahmetest, damit man anhand seiner Reaktion sogleich feststellen konnte, mit welcher Art Querschläger man es zu tun hatte. Die Aufforderung verpuffte indes wirkungslos. Selbst, wenn man es ihm befohlen hätte, wäre Christoph nicht dazu in der Lage gewesen, sich zu entspannen. Unverändert steif harrte er an Ort und Stelle aus.
»Mein Name ist Moosbacher.«, sagte der Mann und schien sich über die verkrampfte Gestalt vor ihm zu wundern. »Stabsfeldwebel Moosbacher eigentlich, aber den ersten Teil davon können Sie sich sparen.« Aus einer Schublade kramte er etwas hervor und legte es vor Christoph auf den Schreibtisch. »Füllen Sie zunächst einmal dieses Formular aus, das können Sie meinetwegen auch zu Hause machen. Ich nehme an, Sie haben eine schriftliche Erlaubnis Ihrer Eltern bei sich?«
Eine solche besaß Christoph.
Moosbacher verschwendete nicht einmal einen Blick daran, legte das Papier in die Ablage, nahm noch einen letzten Zug seiner fast abgebrannten Zigarette und drückte sie aus. Dann rückte er seinen Stuhl ein Stück zur Seite, lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Sie sind etwas zu früh dran, die Aufnahme in die Hitlerjugend erfolgt jährlich am 19. April. Besorgen Sie sich bis dahin die nötige Kleidung.«
Christoph nickte. Zunächst war er nicht sicher, ob Moosbacher fertig war und er gehen konnte. Der aber sagte nichts mehr, saß nur mit ineinander verschränkten Fingern da und sah ihn mit einer Mischung aus Neugier und Belustigung an. Also drehte Christoph sich einfach um und griff nach der Tür. Seine Hände waren derart nassgeschwitzt, dass er abrutschte und die Klinke lautstark in ihre Ausgangsposition zurückfederte. Eilig entschlüpfte er in den Flur und sah zu, das Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen.