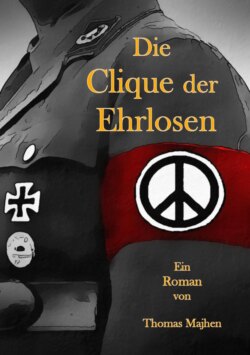Читать книгу Die Clique der Ehrlosen - Thomas Majhen - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 6
März 1938
Der Wind pfiff wie verrückt, zog und zerrte und fuhr schneidend wie eine Rasierklinge in jeden noch so kleinen Spalt in der Kleidung. Die wenigen umstehenden Bäume wogten hin und her wie Pinsel, die von einem Maler energisch über die Leinwand gezogen werden.
Hans Oster klappte den Kragen seines Mantels hoch und vergrub die Hände in den Taschen. Leise vor sich hin fluchend, ging er ungeduldig auf und ab.
Warum mussten sie sich ausgerechnet hier treffen? Weit und breit nur Wiesen und Felder und damit nichts, das den Wind in seine Schranken verwies. Auf Anhieb fielen ihm eintausend Orte ein, die sich für ein heimliches Treffen mindestens ebenso gut, wenn nicht wesentlich besser geeignet hätten.
Mit wachsender Besorgnis gen Himmel blickend, begutachtete er die Farbmischung aus bedrohlich dunklen Grautönen, die wie ein stürmisches Meer das Firmament beherrschten. Wenn es nun auch noch zu regnen anfing, wäre alles perfekt. Er sah sich um, wollte schon auf die silbrig glitzernden Wellblechbaracken des Lagers zugehen, um Schutz vor dem Wetter zu suchen, als er bemerkte wie sich eine dunkle Gestalt näherte.
General Witzleben war in einen feldgrauen Ledermantel gehüllt, der bis über die Knie ging. Obwohl er in etwa genauso groß war wie Oster, wirkte er darin doch fast wie ein Kind, das im Spiel in den viel zu weiten Mantel seines Vaters geschlüpft war. Als sie sich gegenüberstanden, bemerkte Oster, dass das Gesicht des Generals fahl und abgespannt wirkte und farblich kaum von der über ihnen hängenden Wolkendecke zu unterscheiden war.
Mit der Linken hielt Witzleben die Schirmmütze fest, damit diese nicht vom Wind davongetragen wurde, während er seine Rechte zum Gruß ausstreckte. »Nun, Hans, machen wir es möglichst kurz. Sie wollen sicher genauso schnell raus aus diesem Sauwetter wie ich. Was haben Sie für mich?«
Oster öffnete ein Stück weit seinen Mantel, gerade genug, um einen Aktenhefter hervorzuholen. Zum Schutz vor den reißenden Luftmassen stellte er sich dicht an den General. »Es gibt einen zweiten Fritsch.«, begann er geheimnisvoll mit einem schelmischen Lächeln. Ohne das Gesagte weiter auszuführen, hielt er inne, damit sich die Dramatik seiner Worte voll entfalten konnte.
Witzleben, der offenbar weder zum Scherzen aufgelegt war noch Lust auf ein Ratespiel hatte, reagierte mit Ungeduld. »Kommen Sie schon, Hans. Sagen Sie mir einfach was los ist, verdammt.«
Daraufhin öffnete der Oberstleutnant den Aktenhefter, vorsichtig, damit auch nichts verloren ginge. Auf der ersten Seite war mit einer Büroklammer eine Fotografie befestigt.
»Wer ist das?«, wollte Witzleben wissen. Der Mann, der auf dem Foto abgelichtet war, schien ihm nicht im Entferntesten bekannt.
»Darf ich vorstellen, Herr General, das ist Rittmeister Achim von Fritsch.«
Dem General dämmerte, worauf die Sache hinauslief. Es war nahezu unglaublich und doch ergab dadurch alles auf abstruse Weise einen Sinn. Erstaunt sah er den anderen an. »Sie wollen sagen, die ganze Angelegenheit beruhe auf einer simplen Verwechslung?«
Triumphierend klappte Oster den Hefter zu, als wäre der Fall damit restlos aufgeklärt. »Dieser Rittmeister ist derjenige Fritsch, den der Zeuge Otto Schmidt bei gewissen unsittlichen Aktivitäten beobachtet und sodann über mehrere Monate hinweg erpresst hat. Die Verteidigung des Oberbefehlshabers – ich wollte sagen, des ehemaligen Oberbefehlshabers – hat Anfang des Monats davon erfahren. Danach ist es ihr ohne Schwierigkeiten gelungen, den ‚Doppelgänger‘ zügig ausfindig zu machen. Sie haben ihn sofort vernommen, der Mann hat alles zugegeben. Werner von Fritsch hat nichts mit den Anschuldigungen zu tun.«
Witzleben wirkte erleichtert, sichtbare Freude über diese Neuigkeiten ließ er hingegen nicht erkennen. Mit seiner behandschuhten Hand fasste er sich wie beiläufig an den Bauch und verzog dabei den Mund. Angestrengt und vorsichtig atmete er aus. Seine Stimme klang gepresst, wie bei jemandem, der Mühe hat zu sprechen. »Das ist gut. Damit wird dem Kriegsgericht nichts anderes übrigbleiben, als unseren Fritsch freizusprechen.«
Oster pflichtete dem bei. In seiner Euphorie bemerkte er gar nicht, unter welchen Schmerzen sein Gegenüber litt. »Aber das ist noch nicht alles.«, fuhr er aufgeregt fort. »Der Aussage des Rittmeisters zufolge wurde er bereits vor Wochen von der Gestapo befragt, also lange bevor die Verteidigung überhaupt davon erfahren hat. Das bedeutet, Himmler und seinen Schergen war die Verwechslung längst bekannt. Was wiederum nur den Schluss zulässt, dass es sich wirklich um eine Intrige handelt, mit deren Hilfe man den OB zu Fall bringen wollte.«
»Gibt es noch weitere Hinweise, die in diese Richtung deuten? Je mehr Material wir in den Händen halten, desto besser.«, stellte der General fest. Trotz des kalten Windes zeigten sich Schweißperlen auf Stirn und Wangen.
»Die gibt es.«, bestätigte der Oberstleutnant begeistert. »Sie werden es nicht glauben. Wie ich durch meinen Kontakt bei der Kripo erfahren habe, konnte Otto Schmidt bei der Befragung in der Prinz-Albrecht-Straße unseren Fritsch nicht identifizieren. Man hat ihm Fotos gezeigt. Schmidt war sich nicht nur unsicher, er hatte nicht einmal den leisesten Schimmer, wer das auf dem Bild sein könnte. Weiterhin hat er zu Protokoll gegeben, der von ihm erpresste Offizier wohne in Lichterfelde, was bekanntermaßen nicht auf Werner von Fritsch zutrifft.«
Witzleben nickte nur, während er den Ausführungen des anderen lauschte. Ein heftiger Windstoß zwang ihn zu einem Ausfallschritt, damit er nicht das Gleichgewicht verlöre.
»Allerdings mag uns das wenig nützen.«, meinte Oster, der reflexartig seinen freien Arm ausstreckte, um den General vor einem Sturz zu bewahren. »Die Gestapo hat Schmidt durch Drohungen soweit eingeschüchtert, dass er diese Details wohl kaum vor Gericht zugeben wird.«
Der General, der sich auf Hans Osters Arm stützte und gegen die anbrandenden Luftmassen stemmte, wischte dieses Manko beiseite. »Die Aussage des Rittmeisters wird reichen. Sobald Fritsch von den Anschuldigungen freigesprochen wird, müssen wir das alles nur noch öffentlich machen. Der daraus resultierende Skandal wird die Leute gegen die Geheime Staatspolizei und auch gegen die SS aufbringen und uns zusätzlichen Rückhalt in Wehrmacht und Bevölkerung verschaffen.« Nach einer kurzen Pause fügte er schweratmend hinzu: »Und jetzt lassen Sie uns von diesem verfluchten Feld herunterkommen.«
Hans Oster überließ Witzleben den Aktenhefter, der Kopien aller entlastenden Beweise enthielt, die Fritschs Verteidigung bislang zusammengetragen hatte. Dann trennten sie sich. Der General ging in Richtung der Baracken des Truppenübungsplatzes Döberitz davon, der Oberstleutnant nahm seinen eigenen Wagen zurück in die Stadt. Beide waren sie zuversichtlich, mit Hilfe der Enthüllungen dem Regime in Kürze einen entscheidenden Hieb versetzen zu können. Die Aussicht, soeben möglicherweise sogar die ersten Schritte zum Sturz der NS-Regierung unternommen zu haben, versetzte vor allem Hans Oster in eine hoffnungsvolle Stimmung. General Witzleben hingegen war nicht nur viel zu vorsichtig, um sich bereits jetzt derartigen Träumereien hinzugeben. Sein sich rapide verschlechternder gesundheitlicher Zustand ließ einen positiven Blick in die Zukunft überhaupt nicht zu.
Wie es das Schicksal so wollte, gab es auch keinen Grund für überschwänglichen Optimismus. Denn das Timing – davon konnten weder Oster noch Witzleben bei ihrem Treffen freilich etwas ahnen – war denkbar ungünstig. Während in Berlin eine Handvoll Regimekritiker einen innenpolitischen Skandal aufdecken und damit das öffentliche Vertrauen in die Partei untergraben wollte, richtete sich die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf den Südosten – dorthin, wo sich ein außenpolitisches Ereignis von historischer Bedeutung anbahnte.
***
Schon Mitte Februar hatten sich der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler und der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg in Berchtesgaden getroffen, wo es zu einer unsanften Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen war. Der Diktator war in einen künstlichen Wutausbruch verfallen und hatte dem Österreicher kaum verhohlen mit Krieg gedroht, sollte dieser nicht umgehend seinen Forderungen nachkommen. Schuschnigg hatte sich denn auch wohl oder übel dazu gezwungen gesehen, nachzugeben, wollte er keinen Krieg mit dem übermächtigen Deutschland riskieren. Daraufhin wurde die in dem kleinen Nachbarland seit 1933 verbotene »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Österreichs« wieder zugelassen und sogar Teil der Regierung. Weiterhin wurde in einer Art Austauschprogramm das österreichische Offizierskorps mit Offizieren der Wehrmacht durchsetzt. Durch diese Infiltration und Zersetzung von innen gelang es, die Verteidigungsfähigkeit des im Kern zum Widerstand entschlossenen österreichischen Bundesheeres entscheidend zu schwächen.
Nun hatte Kurt Schuschnigg für den 13.03.1938, nur einen Tag, bevor das Verfahren gegen Werner von Fritsch beginnen sollte, eine Volksabstimmung angekündigt, um eine Annexion seines Landes in letzter Minute zu verhindern. Hitler, der im Angesicht dieser Provokation Gift und Galle spie, befahl die Mobilisierung von Truppen für einen sofortigen Einmarsch. Am 10.03. wurde Fritschs Verfahren vor dem Kriegsgericht in Berlin zwar noch formal eröffnet, aufgrund des drohenden Feldzuges gegen die Alpenrepublik aber sofort vertagt, da sich sämtliche Offiziere umgehend bei ihren Einheiten einzufinden hatten.
Sogar diejenigen, die an der Verteidigung des ehemaligen Oberbefehlshabers mitwirkten, waren sich darin einig, dass die Gerichtsverhandlung vor der angespannten Lage zurückstehen müsse. Die patriotische und soldatische Pflichterfüllung stand in dieser Situation selbst für entschiedene Gegner des NS-Regimes unzweifelhaft an erster Stelle.
Einer von ihnen war Generalstabschef Ludwig Beck, der es noch im Jahr zuvor aus Protest unterlassen hatte, die von ihm geforderten Aufmarschpläne gegen das Nachbarland auszuarbeiten und sich daher nun gezwungen sah, entsprechendes buchstäblich über Nacht zu improvisieren. Nicht nur tat Beck das, was von ihm verlangt wurde. Es war, als habe er seine Meinung grundsätzlich geändert, denn nunmehr befürwortete er sogar den Einsatz von Truppen. Dieser scheinbare Sinneswandel ließ sich jedoch nicht durch stumpfen Opportunismus oder falsche Kriegsbegeisterung erklären. Becks Überlegungen folgten einer pragmatischen Strategie, wollte er durch eine Machtdemonstration lediglich Italien und die Tschechoslowakei daran hindern, etwaige Territorial- oder Kompensationsansprüche zu stellen.
Der Coup gelang auf ganzer Linie. Am 12.03. rückte die Wehrmacht, ohne auf Widerstand zu treffen, unter Jubelrufen der Bevölkerung in Österreich ein; die Regierung wurde ohne Verzögerung aufgelöst, das Bundesheer in die Wehrmacht eingegliedert. Ohne, dass auch nur ein Schuss abgefeuert wurde, war es Adolf Hitler gelungen, einen weiteren Punkt des Versailler Vertrages ungestraft außer Kraft zu setzen und das Reich um über sechseinhalb Millionen Bürger und 84.000 Quadratkilometer Fläche zu vergrößern. Nicht nur die neuen Reichsbürger schäumten angesichts der Schaffung des Großdeutschen Reiches vor Begeisterung regelrecht über. Im sogenannten »Altreich«, den deutschen Kernlanden, erfreute sich der Diktator so großer Beliebtheit wie niemals zuvor.
Auch zurückhaltende Stimmen mussten zähneknirschend zugeben, dass dem Führer eine Großtat nach der anderen gelang, wo während der Weimarer Jahre eine Regierung nach der anderen gescheitert war. Zuerst hatte er es vollbracht, sechs Millionen Arbeitslose innerhalb kürzester Zeit in Lohn und Brot zu bringen. Danach war die straflose Besetzung des Rheinlandes und die Wiederbewaffnung erfolgt, was in Frankreich und Großbritannien lediglich schwache Proteste ausgelöst hatte. Jetzt hatte Hitler mit der Vereinigung der deutschen Lande das vielleicht größte Kunststück seiner politischen Karriere vorgeführt. Es fiel schwer, diese unglaublichen Leistungen nicht auch als solche anzuerkennen. Wer es von diesem Tag an noch wagte, gegenüber Freunden oder Familienmitgliedern offene Kritik zu äußern, der machte sich schnell verdächtig, ein unverbesserlicher Nörgler und Miesepeter zu sein. Aber solche Stimmen waren ohnehin in der Minderheit: Schätzungsweise neunzig Prozent der deutschen Bevölkerung standen nach dem Anschluss Österreichs geschlossen hinter der Regierung Hitler.
Noch bevor die Jubelrufe in den Straßen verhallten, machte sich eine Person eiligst auf den Weg nach Wien. Admiral Wilhelm Canaris verlor keine Zeit mit unreflektierten Emotionsausbrüchen, kühl und entschlossen folgte er in seinem Handeln rationalen Überlegungen. Er wusste, im Zuge der Begeisterung würde die allgemeine Achtsamkeit nachlassen und für kurze Zeit ein Vakuum erzeugen, das er unauffällig nutzen konnte. Unmittelbar nachdem der Admiral die österreichische Hauptstadt erreicht hatte, suchte er den Sitz des dortigen Nachrichtendienstes auf, um in den Archiven nach brisanten Dokumenten zu fahnden. Er ging dabei nicht ganz uneigennützig vor, wusste er doch von Unterlagen, die der österreichische Geheimdienst über seine Person gesammelt hatte und die befürchten ließen, er selbst könne nach deren Sicherstellung durch die Gestapo in den Fokus des deutschen Staatsschutzes geraten. Ein größerer Teil bestand aber aus belastendem Material, von dem Canaris hoffte, es bald gegen die Nationalsozialisten verwenden zu können. So brachte er stapelweise Papiere in seinen Besitz, darunter Akten über mehre Morde während der sogenannten »Nacht der langen Messer«, außerdem eine Dokumentation, die als Urheber des Reichstagsbrands von 1933 die Nationalsozialisten selbst vermutete, sowie Kopien von Ermittlungsakten der Münchner Polizei zum Fall Geli Raubal – Hitlers Nichte, die sich im September 1931 in der Wohnung des späteren Diktators durch einen Schuss in die Lunge das Leben genommen hatte.
Mit der Beschlagnahmung der genannten Unterlagen kam Canaris dem Chef des Sicherheitsdienstes, Reinhard Heydrich, der ein alter Bekannter und gleichzeitiger Gegenspieler von ihm war, nur um wenige Stunden zuvor. Ohne dem anderen auch nur über den Weg zu laufen, verschwand der Admiral genauso schnell und spurlos wie er aufgetaucht war. Die sichergestellten Unterlagen schaffte er unerkannt nach Berlin, wo sie Hans Osters Sammlung hinzugefügt und in einem Tresor der Abwehr verwahrt wurden.
Wenige Tage später, nachdem die Erleichterung innerhalb des Heeres über den gewaltlosen Anschluss allmählich der gewohnten Routine wich, wurde das Verfahren gegen Werner von Fritsch wiederaufgenommen. Die Verteidigung leistete ganze Arbeit, und obwohl Hermann Göring wie auch Walther von Brauchitsch, Fritschs Nachfolger als Oberbefehlshaber des Heeres, auf der Richterbank saßen, blieb ihnen vor allem aufgrund des ermittelten Doppelgängers nichts anderes übrig, als Fritsch nach nur einem einzigen Verhandlungstag von der Anklage frei zu sprechen. Das Urteil war unzweifelhaft als großer Erfolg zu werten, ein bitterer Nachgeschmack blieb.
Trotz allem sah sich der Reichskanzler Adolf Hitler nicht dazu genötigt, den Geprellten in aller Form öffentlich zu rehabilitieren, ja offenbar hatte er nie auch nur mit dem Gedanken gespielt, den Unglücklichen in sein altes Amt wiedereinzusetzen. Alles wurde einfach stillschweigend so belassen, wie es war. Ob es sich nun von Beginn an um ein schmutziges Spiel gehandelt haben mochte oder nicht, das Ergebnis war letztlich das gleiche: Werner von Fritsch verblieb im Ruhestand. Jeder Versuch, die Drahtzieher hinter der möglichen Intrige ausfindig zu machen, wurde unterbunden. Laut offizieller Lesart handelte es sich schlicht um eine bedauerliche Verwechslung.
In der allgemeinen Euphorie über die Eingliederung Österreichs, ein Ereignis, das noch auf Wochen hinaus in der Bevölkerung hohe Wellen schlug, gerieten die Begebenheiten um den Ex-Oberbefehlshaber zudem schnell in Vergessenheit. Außerhalb der Armee nahm von dessen Freispruch kaum jemand Notiz. Selbst in Militärkreisen wurde die Affäre, die für kurze Zeit so viel Aufsehen erregt und Empörung hervorgerufen hatte, zügig zu den Akten gelegt. Man wollte sich nicht länger mit diesem unschönen Intermezzo belasten und lieber zur Tagesordnung übergehen.
Den Kleinkriminellen und falschen Zeugen Otto Schmidt, den man mit so voreiliger Siegesgewissheit präsentiert hatte, ließ man indessen in einem Konzentrationslager verschwinden. Seinen Part hatte er nicht erfüllt, dafür bekam er nun die Quittung. Darüber hinaus stellte er als Mitwisser über die wahren Hintergründe der Affäre eine bleibende Gefahr für Gestapo und SS dar, weshalb es vermutlich nur eine Frage der Zeit war, bis man sich seiner endgültig entledigen würde. Sicherlich kein achtbarer und anständiger Mensch, wäre das Bauernopfer Schmidt innerhalb kürzester Frist für immer vergessen.
All das sorgte dafür, dass Hans Oster nicht mehr so recht wusste, wo ihm der Kopf stand. Für einen kurzen Moment hatte er wirklich geglaubt, einen entscheidenden Sieg davongetragen zu haben. Wieder einmal hatte er die Rücksichtslosigkeit und Berechnung der NS-Führung auf der einen Seite und die Trägheit der Generalität auf der anderen unterschätzt. Es war ungerecht und frustrierend, fast schämte er sich, Offizier zu sein. Dieses scheinheilige Gerede von Pflicht, Ehre und Kameradschaft war nichts weiter als eine Farce. Wenn es um das eigene Vorankommen ging, soviel hatte Oster gelernt, waren diese vielgepriesenen Soldatentugenden schnell vergessen.
Krampfhaft überlegte er, was er noch tun könnte. Aufgeben war keine Option, soviel stand bei allen Rückschlägen für ihn fest. Er durfte nicht nachlassen, musste die gegebenen Umstände, an denen er nun einmal nichts ändern konnte, so gut wie irgend möglich nutzen. Vielleicht war noch nicht alles verloren, überlegte er, vielleicht ließ sich die Niederlage noch abwenden und in einen Triumph verwandeln.
Ihm kam eine Idee in den Sinn. Sie war ein wenig unkonventionell, man könnte auch sagen aus der Mode geraten. Doch versuchen musste er es.
Von neuem Mut erfüllt, suchte Hans Oster erneut Werner von Fritsch auf. Er traf den zwangspensionierten General genauso an wie er das erwartet hatte: völlig in sich zusammengesunken und zutiefst deprimiert in einem Sessel sitzend. Oster war entschlossen, Fritsch aus diesem Loch zu ziehen, dessen Niedergeschlagenheit in Wut zu verwandeln und diese Wut gegen ein lohnendes Ziel zu richten. Dabei musste er behutsam vorgehen. Der General hatte es schon einmal abgelehnt, dass man sich einmischte und würde auf einen allzu plumpen Versuch, ihn zu manipulieren, zweifellos äußerst ungehalten reagieren.
Man habe einen Etappensieg errungen, eröffnete der Oberstleutnant, nun müsse man dafür Sorge tragen, dass die Rehabilitierung des Generals in aller Öffentlichkeit bekanntgegeben werde. Den Kopf nun in den Sand zu stecken, sei zwar eine verständliche Reaktion, allerdings weder hilfreich noch förderlich. Die Möglichkeiten des Augenblicks auszunutzen, heiße die Devise.
Einen bescheidenen Erfolg mochte man zwar durchaus davongetragen haben, erwiderte Fritsch. Einen Weg, auf dem sich dieser Erfolg nutzen ließe, erkenne er hingegen nicht. Der Führer habe es bisher vermieden, mit ihm zu sprechen, ja nicht einmal ein Schreiben habe er von diesem erhalten. Dass ihm derart die kalte Schulter gezeigt werde, verdeutliche unmissverständlich, welchen Wert man seiner Person beimesse. Hitler persönlich habe ihn fallengelassen und abserviert, das käme einem mittelalterlichen Kirchenbann gleich und sei nicht anfechtbar. Er, Fritsch, sei nicht der Mann, der voreilig das Schlachtfeld räume. Wann die Lage als aussichtslos zu betrachten sei, man sich geschlagen geben und in sein Schicksal fügen müsse, das wisse er aber.
Möglicherweise gebe es eine Hintertür, die man übersehen habe, meinte Oster. Die Ermittlungen der Verteidigung deuteten klar darauf hin, dass namentlich eine Person hinter der Schmutzkampagne stünde, nämlich Heinrich Himmler. Er sei sich wohl der Unmöglichkeit bewusst, den Reichsführer auf juristischem Wege zur Verantwortung zu ziehen. Innerhalb der Armee hege man bezüglich der Urheberschaft dieser abscheulichen Intrige jedoch keinerlei Zweifel, und so stehe dem General noch eine letzte Möglichkeit offen. Das Vorgehen, dass Oster dabei vorschwebe, mute zwar mittlerweile etwas antiquiert an, sei nach seiner Meinung aber durchaus ein legitimes Mittel. Immerhin handle es sich nicht nur um eine persönliche Ehrverletzung, sondern um die Herabwürdigung des gesamten Offizierstandes, den der General als Oberbefehlshaber außer Dienst noch immer vertrete.
Fritsch, der nun aufhorchte, wollte vom Oberstleutnant wissen, was dieser also vorschlage, ob er etwa das meine, von dem Fritsch glaube, dass er meine. Er sei von einem solchen Gedanken durchaus angetan, fraglich sei indes, ob sich Himmler einerseits darauf einlassen und ob Hitler andererseits dies überhaupt gestatten würde.
Hans Oster, der merkte, wie die Lebensgeister allmählich in den Geprellten zurückkehrten, wähnte sich schon am Ziel. Er spürte, dass er ins Schwarze getroffen hatte und erkannte die vielleicht letzte Chance, das Blatt in der fraglichen Angelegenheit noch einmal zu ihren Gunsten zu wenden.
Er sage es nunmehr frei heraus, auch wenn es der General zweifellos schon selbst errate habe: Fritsch solle von Himmler Satisfaktion verlangen und diesen zum Duell herausfordern. Im günstigsten Falle würde der Reichsführer, der nach Osters Ansicht noch nie eine Waffe in den Händen gehalten habe, akzeptieren und so seine Schuld indirekt eingestehen. Der zweitbeste Ausgang bestünde darin, dass er die Herausforderung ablehne und somit in aller Augen als das dastehe, was er nach Meinung vieler schon längst sei, nämlich als Feigling. Sollte aber im ungünstigsten Fall, nämlich drittens, Hitler den Ehrenhandel unterbinden, so wäre zumindest noch einmal auf die Sache aufmerksam gemacht und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen worden. Der General habe sodann sein Möglichstes getan und seine Ehre wiederhergestellt.
Fritsch überlegte noch eine Weile hin und her. Während er grübelnd im Zimmer auf und ab ging, war sich Hans Oster längst sicher, den General überzeugt zu haben. Fast schon begeistert stimmte Fritsch schließlich zu und setzte noch am selben Abend eine schriftliche Herausforderung zum Duell an Heinrich Himmler auf. Im gleichen Atemzug verkündete er, dieses Schreiben in den folgenden Tagen General Rundstedt mit der Bitte zu übergeben, es persönlich an den Reichsführer SS weiterzuleiten.
In der Gewissheit, die vorhandenen Möglichkeiten voll ausgeschöpft zu haben, kehrte Hans Oster befriedigt in seine Wohnung im Berliner Stadtteil Wilmersdorf zurück. Dadurch, dass es ihm gelungen war, Fritsch aus seiner Lethargie zu reißen und zum Handeln zu bewegen, war er überzeugt, die Initiative zurückgewonnen zu haben. Für den Oberstleutnant gab es kaum etwas Schlimmeres als zum Spielball der Ereignisse verdammt zu sein und tatenlos herumzusitzen. Solange man in Bewegung blieb, war alles möglich.
Inbrünstig hoffte er, Werner von Fritsch möge diesen verfluchten »Reichsheini«, wie Himmler in der Bevölkerung hinter vorgehaltener Hand spöttisch genannt wurde, über den Haufen schießen. So viele Probleme wären mit nur einer einzigen Kugel gelöst und niemand würde an der Rechtmäßigkeit dieses Ehrenhandels auch nur den geringsten Zweifel hegen.
***
Zu allen Zeiten fiel den Überbringern von Botschaften und Nachrichten eine wichtige Aufgabe zu. Schon in der Antike konnte ein zuverlässiger und schneller Bote den Ausschlag geben zwischen Reichtum oder Bankrott, Sieg oder Niederlage, Leben oder Tod. Handelte es sich beim Inhalt einer Nachricht um eine Hiobsbotschaft für den Empfänger, lief der Sendbote, obschon er lediglich der Überbringer, nicht aber der Verfasser derselben war, häufig sogar selbst Gefahr, persönlichen Schaden zu nehmen. Die Aufgabe des Boten war daher sehr riskant, unter Umständen lebensgefährlich und wenig beliebt.
General Gerd von Rundstedt musste zwar nicht um seine persönliche Unversehrtheit fürchten, liebte die ihm anvertraute Botentätigkeit aber ebenfalls überhaupt nicht. Gleichwohl nutzte er die damit einhergehende Einflussmöglichkeit aus, wie er es für richtig hielt – hätte sich Werner von Fritsch doch nur jemand anderes als Überbringer seiner Herausforderung auserkoren.
General Rundstedt war durchaus nicht als Nazi zu bezeichnen; weder war er Antisemit noch glaubte er in Adolf Hitler eine Art Messias zu erkennen. In jedem Fall aber konnte man ihn einen geradezu bedingungslos unpolitischen, ja alles Politische wie der Teufel das Weihwasser scheuenden preußischen Offizier nennen. Er hielt es für ein unumstößliches Gesetz, dass sich ein Soldat nicht mit Fragen der Politik zu befassen habe. In Rundstedts Vorstellungswelt, wie auch in derjenigen vieler anderer altgedienter Offiziere, war dieses Metier allein den Zivilisten und in vergangenen Zeiten einem König oder Kaiser vorbehalten. Dem Staatsoberhaupt, sei es nun Kaiser oder Reichskanzler, habe man als Soldat unbedingt und ohne Widerspruch Folge zu leisten. Eine eigene Meinung, und davon war Rundstedt unverrückbar überzeugt, stand dem Soldaten in sämtlichen Entscheidungen, die eine Regierung treffen mochte, nicht zu. Und noch eine Bezeichnung musste sich der General gefallen lassen: er war im Offizierskorps als eitler Karrierist bekannt.
Als Werner von Fritsch das für Heinrich Himmler bestimmte Schreiben an General Rundstedt übergab, versuchte der zunächst Fritsch diese Schnapsidee – denn als eine solche bezeichnete er sie rundheraus – auszureden. Ein Duell, dieses Relikt aus dem letzten Jahrhundert, sei längst nicht mehr zeitgemäß. Zudem habe der Führer persönlich das Duellieren erst im vergangenen Jahr ausdrücklich verboten, nachdem es zu folgendem, landesweit beachteten Vorfall gekommen war: Der Adjutant des Reichsjugendführers Baldur von Schirach, Horst Krutschinna, hatte den auch international angesehen Kriegsreporter, Schriftsteller und Militärkorrespondenten Roland Strunk, mit dessen Frau Krutschinna angeblich eine Liebesaffäre unterhalten haben soll, während eines Duells getötet. Das Vorhaben sei also nicht nur unvernünftig, sondern darüber hinaus illegal und verstoße außerdem gegen eine ausdrückliche Anweisung des Führers.
Fritsch beharrte auf seinem Vorhaben und ließ sich auch durch den Verweis auf den Führerbefehl nicht davon abbringen.
Schließlich nahm Rundstedt das Papier widerwillig entgegen – um es sodann eine ganze Woche lang unverrichteter Dinge einfach mit sich herumtragen.
Am letzten Tag des Monats März erhielt der ehemalige Oberbefehlshaber des Heeres Werner von Fritsch daher gleich zwei Schreiben: zum einen seine eigene Aufforderung an Himmler zum Duell, die ihm Rundstedt kurzerhand wieder zurückgab; zum anderen einen Brief Hitlers. Der Diktator bestätigte darin das Urteil des Kriegsgerichtes, das die Unschuld von General Fritsch festgestellt und ihn von der Anklage freigesprochen hatte. Was der Brief allerdings nicht enthielt, war ein Ausdruck des Bedauerns, von einem Wort der Entschuldigung ganz zu schweigen. Damit waren alle Bemühungen zum Fall Fritsch endgültig gescheitert.