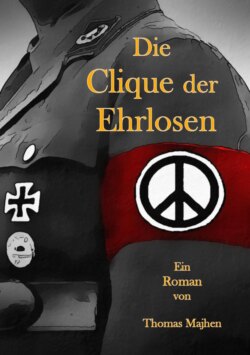Читать книгу Die Clique der Ehrlosen - Thomas Majhen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 5
Christoph nahm seine Jacke vom Kleiderhaken und wollte schon die Tür öffnen, als er bemerkte, dass seine Mutter mit vor der Brust verschränkten Armen im Türrahmen der Küche stand und ihn fragend ansah. Sie war keine allzu strenge Mutter, aber gewisse Regeln mussten eingehalten werden. Dazu gehörte auch, sich abzumelden, bevor man das Haus verließ.
Ertappt erwiderte er ihren Blick. »Ich gehe rüber zu Försters.«, erklärte er, musste feststellen, dass sich seine Mutter damit noch nicht zufrieden gab, und fügte hinzu: »Wir wollen uns heute Nachmittag im Kino einen Film ansehen.« Seine Hand ruhte auf der Türklinke.
»So? Was zeigen sie denn?«, wollte die Mutter wissen.
Christoph, der die Klinke eben herunterdrücken wollte, stockte. Mit weiteren Fragen hatte er nicht gerechnet. »Das weiß ich auch nicht so genau. Wir lassen uns überraschen.«
Die Mutter seufzte. Ein verträumter Glanz trat in ihre Augen. »Im Lichtspielhaus bin ich seit einer Ewigkeit nicht mehr gewesen. Dein Vater ist in dieser Hinsicht ein richtiger Muffel. Wenn es nach ihm geht, ist das bloß sinnlose Zeit- und Geldverschwendung.« Sie Seufzte erneut, dann endlich entließ sie ihren Sohn. »Geh nur, ich wünsche euch viel Spaß. Und grüß Jan von mir.«
Christoph nickte, verlor nicht eine weitere Sekunde und entschwand in den Flur.
Familie Förster wohnte etwa zwanzig Fußminuten von den Goebens entfernt. Obwohl es an diesem Samstag recht kalt war und die Temperatur einige Grad unter null lag, machte Christoph der Marsch dorthin nichts aus. Er war es gewohnt, zu Fuß zu gehen, und auch wenn es ihn zu anfangs noch ein wenig fror, so wusste er, dass sich das durch die Bewegung zügig ändern würde.
Als er aus dem Haus trat, schlug er den Weg in südlicher Richtung ein und folgte der Straße. Nach wenigen hundert Metern stieg ihm ein seltsamer, würzig-süßer Geruch in die Nase. Er kannte den Duft sehr gut, schließlich war er diesen Weg schon unzählige Male entlang marschiert. Dennoch wunderte er sich immer wieder aufs Neue, ob er den Geruch nun appetitlich, einfach nur komisch oder ekelerregend finden sollte, denn es roch nach einer sonderbaren Mischung, die an frisch gemähtes Gras, Grießbrei und Urin erinnerte. In Kürze erreichte er den Ursprung des verwirrenden Aromen-Gemischs: Vor ihm lag das dreiecksförmige Gelände der Brauerei Riegele.
Das zugehörige Wirtshaus rechts liegen lassend, betrat Christoph die tunnelartige Unterführung, die unter den Gleisanlagen, die direkt an die Brauerei anschlossen, hindurchführte. Als er auf der anderen Seite wieder ins Tageslicht trat, bog er links ab und folgte eine Weile den Gleisen. Pfeifend und dampfend fuhr ein Zug in den Hauptbahnhof ein, den er durch Büsche und Bäume hindurch nicht weit entfernt zu seiner Linken sehen konnte. Bald darauf erreichte er den Wittelsbacher Park, der mit seinen blattlosen Bäumen und den braunen Grasflächen recht trostlos aussah. Nicht viele Menschen hatten sich in den Park verirrt, er befand sich fest in der Hand zahlloser Krähen, die auf den abgestorbenen Flächen nach etwas Essbarem stocherten.
Lange, bevor Christoph durch die Grünanlagen hindurch war, konnte er die Kirche St. Anton sehen. Sie gab dem um sie herum gewachsenen Antonsviertel seinen Namen. Von hier aus waren es nur noch ein paar Querstraßen, bis er an einem hübschen Mietshaus ankam. Dort wohnten die Försters nicht nur, das Gebäude gehörte der Familie auch.
Die Haustür stand offen und Christoph betrat den prächtigen, ganz in Rot gehaltenen Eingang. Über ihm schwebte ein strahlender Leuchter, seine Schritte hallten von dem glänzenden roten Marmorboden wider. Er erklomm die Treppe in den dritten Stock, vorbei an mehreren untervermieteten Wohneinheiten. Oben angekommen, klingelte Christoph an der Wohnung, die Familie Förster selbst bewohnte.
Jan öffnete die Tür. »Tut mir leid, wir kaufen nichts.«, sagte der, als wäre Christoph ein Vertreter und er in Eile. Schon machte er Anstalten, seinem Freund die Tür vor der Nase zuzuschlagen.
»Lass den Quatsch!«, sagte Christoph, hob abwehrend die Hände, um die Tür nicht ins Gesicht zu bekommen, und drängte sich in den Eingang.
Grinsend versperrte Jan seinem Freund den Weg und provozierte eine kleine Rangelei.
Halb im Treppenhaus, halb im Wohnungsflur stemmten sich die beiden gegeneinander und mühten sich, den anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Jan war stark und packte Christoph bei den Schultern, doch auch Christoph wehrte sich verbissen und ergriff die Arme des anderen. Es wurde geschoben und gedrückt, gezogen und gezerrt, und während beide vor Anstrengung stöhnten, mussten sie dazwischen immer wieder lachen.
Auf einmal ließ Jan ohne Vorwarnung von seinem Freund ab und machte einen großen Schritt zurück.
Christoph stolperte nach vorn, wäre beinahe der Länge nach auf den Fußboden gestürzt und stieß dabei mit der linken Schulter heftig gegen die halb geöffnete Tür. Mit einem lauten Krachen schlug diese gegen die Wand und hätte um ein Haar ein dort hängendes Bild zerschmettert, verfehlte es nur um wenige Zentimeter.
Erschrocken vergewisserte sich Christoph, dass nichts zu Bruch gegangen war.
Jan hingegen stand unbekümmert und immer noch feixend da. Er schien sich prächtig zu amüsieren.
Mit schnellen Schritten kam Jans Mutter in den Wohnungsflur gelaufen, die Hände an ihrer Schürze abwischend. Als sie die beiden in der Diele stehen sah, verlangsamte sie ihren Gang und blieb schließlich stehen. »Christoph, du bist das. Was macht ihr beiden denn bloß? Man könnte meinen, das ganze Haus stürzt in sich zusammen.«, sagte sie. »Nun lass den armen Kerl schon rein, im Hausflur ist es eisig kalt.«, fügte sie an ihren Sohn gewandt hinzu.
Unverändert frech grinsend, trat Jan einen Schritt zur Seite und ließ seinen Freund passieren. Als die Mutter wieder in der Wohnung verschwunden und außer Sichtweite war, versuchte er noch, Christoph einen Hieb gegen den Oberarm zu verpassen. Der jedoch hatte den Schlag kommen sehen, wich geschickt aus und versuchte seinerseits einen Treffer zu landen. Er verfehlte sein Ziel ebenfalls, denn Jan war auf der Hut und tänzelte spielerisch aus dem Weg.
»Werden alle eure Gäste so begrüßt?«, fragte Christoph und rieb sich die Schulter an der Stelle, wo er gegen die Tür geknallt war.
»Nicht alle, nur die hässlichen.«, erwiderte Jan und klopfte seinem Freund lachend auf den Rücken.
Die Wohnung der Försters war geräumig und sehr geschmackvoll eingerichtet. Jans Vater war Inhaber einer Importfirma für italienische Feinkostwaren und verdiente dabei offenbar prächtig. Jedenfalls empfand Christoph den Kontrast mehr als deutlich, wenn er aus der bescheidenen Mietwohnung seiner Eltern hierher in diesen Palazzo seines besten Freundes kam. Jan ließ sich zwar nur selten anmerken, dass auch er sich dieses Unterschieds bewusst war, wenn er Christoph zu Hause besuchte. Gelegentlich konnte er aber nicht an sich halten, zog seine Freunde auf und gab mächtig an. Christoph ärgerte sich manchmal darüber, musste aber zugeben, dass er hin und wieder durchaus ein wenig Neid verspürte.
Als Jan voranging und seinen Freund durch den Flur geleitete, bemerkte Christoph, dass es in der Wohnung ganz wunderbar nach Kuchen und Kaffee duftete. Sie kamen an der Küche vorbei, wobei Christoph nicht entging, wie die Haushälterin gerade dabei war, ein Blech Mohnkuchen aus dem Ofen zu nehmen, während Jans Mutter den Kaffee zubereitete. Sofort lief ihm das Wasser im Mund zusammen, mit einem gierigen Knurren meldete sich auch sein Magen zu Wort. Christoph liebte Kuchen und Backwaren über alles, zu seinem Leidwesen war seine eigene Mutter jedoch eine nicht sonderlich begabte Konditorin.
Jan führte Christoph in die angenehm warme Wohnstube. Dort lehnte er sich wie zufällig an die Wand neben dem Kachelofen und tat so, als wolle er sich lediglich ein wenig aufwärmen.
Unweit neben dem Ofen bemerkte Christoph eine Art Schrank, den er an dieser Stelle noch nie zuvor gesehen hatte. Das Möbelstück war etwas kleiner als er selbst und nur wenig breiter. Sowohl für einen Bücherschrank als auch für ein Buffet war das Ding viel zu klein und hätte allenfalls noch als Schnapsschrank dienen können. Dennoch sah es für Christophs Begriffe seltsam aus und anders als alle Möbel, die er bisher gesehen hatte. Er ahnte bereits, dass es sich um eines von Jans Spielchen handeln mochte. Nur zu gerne hätte er den Schrank einfach ignoriert und Jan schmoren lassen, doch zwang ihn seine eigene Neugierde dazu, sich darauf einzulassen. Fragend deutete er auf das neue Möbelstück.
Sein Freund mimte den Überraschten, gerade so, als sei er soeben auf etwas aufmerksam gemacht worden, das er bislang selbst noch nicht entdeckt hatte. »Na sowas, wo kommt das denn auf einmal her?«, spielte er mit weit geöffneten Augen und offenstehendem Mund den Ahnungslosen. Er trat an den Schrank, strich mit der Hand über die glatte Oberfläche und schien das Möbel zu untersuchen. Dann, als wäre ihm ein Licht aufgegangen, öffnete er eine Klappe an der Vorderseite und trat zur Seite, damit Christoph auch gut sehen konnte, was sich im Inneren verbarg.
Der staunte nicht schlecht, als ihm dämmerte, was Jan ihm da gerade so theatralisch vorführte. »Ihr habt euch einen Fernseh-Empfänger zugelegt?«, staunte Christoph ungläubig. »Das Ding muss ja ein Vermögen gekostet haben.«
Jan stellte sich breitbeinig hin und stemmte die Arme in die Hüfte. Immer noch so tuend, als sei das alles für ihn ebenso neu wie für seinen Freund, sagte er: »Ach, darum handelt es sich dabei also! Dann wollen wir doch mal sehen.« Prüfend drehte er an einem Knopf.
Ein Klicken war zu hören, woraufhin das Gerät ein sanftes Rauschen von sich gab. Der Bildschirm wurde heller, begann zu flimmern, zu sehen gab es indes nichts. Auch Sekunden später nichts als Flimmern.
»Ist ja toll. So etwas brauchen wir zu Hause auch unbedingt.«, spottete Christoph und verschränkte befriedigt die Arme.
Jan schaltete das Gerät aus, schloss die Klappe, hinter der sich der Bildschirm versteckte, und verwandelte den Fernseh-Empfänger wieder in einen unscheinbaren, nutzlosen Schrank. »Gesendet wird nur zwischen 20 und 22 Uhr, du Schlaumeier.«, sagte Jan, ein wenig enttäuscht darüber, dass seine Vorführung nicht den gewünschten Effekt erzielt hatte. »Manchmal läuft tagsüber Musik.«
In diesem Augenblick kamen Jans Mutter und die Haushälterin in die Stube, um den Kaffeetisch zu decken. Erstere warf einen düsteren Blick in Richtung des neuartigen Geräts neben dem Ofen. Es war nur allzu offenkundig, dass sie über die neueste Anschaffung ihres Mannes nicht besonders glücklich war.
Christoph bemerkte davon allerdings nichts, da seine ungeteilte Aufmerksamkeit dem Kuchen galt, der vorsichtig in der Mitte des Tisches platziert wurde.
»Setzt euch, Kinder, Vati kommt auch gleich.«, sagte Jans Mutter, die konsequent zu ignorieren schien, wie erwachsen ihr Sohn längst geworden war. »Christoph, du bleibst doch zum Kaffee?«
Der Angesprochene machte ein trauriges Gesicht. »Das würde ich sehr gerne, Frau Förster. Aber wir sind mit Peter und Michel verabredet und es ist schon spät. Ich fürchte, wir müssen gleich los.«
»Das ist aber schade.«, sagte sie, trat in den Flur hinaus und rief nach dem Herrn des Hauses, der sich vertieft in seine Geschäfte in seinem Arbeitszimmer befinden musste.
Christoph warf noch einen letzten wehmütigen Blick auf den Mohnkuchen. Dann wurde er von Jan in Richtung Tür geschoben und verabschiedete sich in einem Ton, als würde er sich auf eine lange Auslandsreise begeben. »Danke nochmal für die Einladung. Auf Wiedersehen, Frau Förster.«
Beim Hinausgehen kam Jans Vater den Flur entlang und blieb vor den beiden stehen. Er war ebenso blond und hochgewachsen wie sein Sohn, dieselben eisblauen Augen lugten hinter einer Brille hervor, doch besaß er ganz im Gegensatz zu seinem Sprössling einen Bauch. Das war wohl zu einem Teil auf seine Tätigkeit als Importeur für Feinkostwaren zurückzuführen, zu einem anderen auf die Koch- und Backkünste seiner Frau.
»Tag, Herr Förster.«
»Tag, Christoph.«, erwiderte Jans Vater etwas kratzig.
Jan schob seinen Freund weiter zum Ausgang.
»Wiedersehen, Herr Förster.«
»Wiedersehen, Christoph.«, echote die Kratzstimme.
Draußen schlugen Jan und Christoph den Weg in Richtung Stadtmitte ein. Mit Peter und Michel waren sie an ihrem üblichen Treffpunkt am Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße verabredet. Bis dorthin waren es etwa fünfundzwanzig Minuten zu Fuß.
»Also«, begann Jan unterwegs das Gespräch, wobei sein Atem in der kalten Luft Wolken bildete, »hast du dir schon überlegt, wie es nächstes Jahr weitergehen soll?«
Mit seiner Frage spielte Jan auf das Ende der Schulzeit an, wenn sich jeder für einen Beruf würde entscheiden müssen, sofern dies noch nicht geschehen war.
Christoph machte einen ratlosen Eindruck, wie stets, wenn es um dieses Thema ging. Er schüttelte den Kopf.
»Geh doch zur Müllabfuhr, da gibt es auf jeden Fall immer was zu tun.«, scherzte Jan. Der hatte auch leicht reden, sein Berufsweg war längst vorgezeichnet. Natürlich würde er nach einem kaufmännischen Studium in das Unternehmen seines Vaters einsteigen und eine Karriere als Importeur beginnen.
»Damit ich dich jedes Mal verjagen muss, wenn ich dich beim Durchwühlen der Mülltonnen erwische?«, versetzte Christoph. »Bestimmt nicht. Da käme ich ja kaum mehr dazu, meiner eigentlichen Arbeit nachzugehen.«
Beide lachten.
»Vielleicht kann ja dein Vater bei sich in der Firma eine Lehrstelle für dich organisieren.«, meinte Jan. »Das wäre immerhin etwas und sicher nicht das Schlechteste.«
Wenig überzeugt nickte Christoph. Auf eine Beschäftigung in der Fabrik hatte er überhaupt keine Lust, zumal er handwerklich nicht sonderlich geschickt war und sich auch nicht vorstellen konnte, den ganzen Tag in einer dunklen Halle verbringen zu müssen. Andererseits musste er sich natürlich bald für einen Beruf entscheiden, damit man sich frühzeitig nach einem freien Ausbildungsplatz für ihn umsehen konnte. An ein Studium, wie er es ursprünglich im Sinn gehabt hatte, war nicht zu denken, da seine Noten dies kaum erlaubten. Stets vertröstete Christoph sich selbst damit, dass ihm noch etwas Zeit bliebe und ihm das Passende schon noch in den Sinn kommen würde. So hoffte er jedenfalls.
Mittlerweile dämmerte es. Mit der Sonne, die blass und träge allmählich hinter den Häusern verschwand, sanken auch die Temperaturen. Die Hände tief in den Jackentaschen vergrabend, stapften Jan und Christoph eine Weile schweigend dahin. Die Kälte verleidete ihnen die Lust an jeder weiteren Unterhaltung, eiskalte Backen und trockene Lippen gestalteten das Sprechen nicht gerade angenehmer.
Sie beschleunigten ihre Schritte und erreichten bald die Gleisanlagen, die die Stadt von Nordwest nach Ost in zwei Hälften zerteilten. Nachdem sie die Schienen an einem Übergang überquert hatten, ging es an einem katholischen Friedhof entlang, bis sich die Straße zum Adolf-Hitler-Platz – der bis 1933 den Namen »Königsplatz« getragen hatte und von den Augsburgern, die sich an manche Veränderungen nur schwer gewöhnen konnten, noch immer kurz »Kö« genannt wurde – hin öffnete. In einem flachen Winkel kreuzten sie den Kö, bogen rechts in die Katharinengasse ein und befanden sich sodann in einem Teil der Altstadt, der in weiten Bereichen noch immer recht mittelalterlich anmutete.
Die Bauten hier waren alt, die Mauern oft schief, an vielen Stellen war der Putz abgebröckelt und gab den Blick auf das darunterliegende Mauerwerk frei. In der Mitte der schmalen Gasse ragte ein langes Gebäude mit spitzem Giebeldach und großen Rundbogenfenstern auf. Gekrönt wurde der Bau von einem kleinen Glockendrum, wodurch der Eindruck, hierbei handle es sich um eine Kirche, noch verstärkt wurde. In Wahrheit befanden sich Jan und Christoph auf der Rückseite ihrer Schule, das kirchenartige Bauwerk bildete die Kapelle des ehemaligen Nonnenklosters.
Die Freunde folgten der Gasse bis zu deren Ende. Dort angekommen, öffnete sie sich zu einer weiten, großzügigen Straße. Damit hatten sie ihr Ziel erreicht und befanden sich mitten auf der berühmten Maximilianstraße im Zentrum von Augsburg. Direkt vor ihnen thronte auf einer Insel, auf zwei Seiten von Fußgängern und Fahrzeugen aller Art umspült, der Herkulesbrunnen. Um ihn vor der Witterung zu schützen, hatte man den prächtigen Brunnen mit einer plumpen hölzernen Verkleidung versehen, was ihm das Aussehen einer skurrilen Jahrmarktsbude verlieh. Vor dem so unwürdig verpackten Brunnen warteten Michel und Peter.
»Servus, Jungens. Da seid ihr ja endlich.«, wurden sie von Peter begrüßt. »Ich hatte schon Sorge, dass unser Michel hier gleich zur Eismumie wird, wenn ihr nicht gleich auftaucht.«
In der Tat sah Michel so aus, als würde er den beschriebenen Zustand demnächst erreicht haben. Der Junge hatte den Kragen seines Mantels hochgeklappt, trug Wollmütze und Handschuhe, dennoch war das übliche Weiß seines Gesichts einem ungesunden Blauton gewichen, der in seiner Farbpracht nur noch von den lilafarbenen Lippen übertroffen wurde. Michels Zittern war schon aus einigen Metern Entfernung zu erkennen, sobald man näherkam, konnte man es sogar hören: seine Zähne klapperten im Stakkato. Das Sprechen schien ihm kaum möglich, steif trat er von einem Fuß auf den anderen. »Wäre ... ich ... doch bloß ... zu Hause ... geblieben.«, bibberte er.
Christoph war vom Anblick seines Freundes ehrlich betroffen, selbst Jan wirkte besorgt.
Augenblicke später setzte letzterer sein übliches Grinsen auf und packte Michel am Arm. »Für solche Situationen gibt es nur ein einziges Hilfsmittel.«, sagte er mit erhobenem Zeigefinger im gleichen Tonfall, wie ein Arzt eine Diagnose stellen würde. »Ins Luli schaffen wir es mit unserer Frostbeule hier sowieso nicht, bleibt also nur noch das Pali.«, fügte er an Christoph und Peter gewandt hinzu.
»Dann eben das Pali.«, bestätigte Christoph. Er und Jan nahmen Michel zwischen sich in die Mitte.
Den völlig durchgefrorenen Jungen flankierend, folgten die Freunde der breiten Maximilianstraße in nordöstlicher Richtung. Trotz der Kälte war die Straße belebt, wobei viele der Passanten zusahen, dass sie schleunigst in die Wärme eines Geschäfts oder Wirtshauses kamen. Niemand würde an einem solch eisigen Tag mehr Zeit im freien verbringen als unbedingt nötig.
Nach etwa zweihundert Metern öffnete sich die Straße nach rechts und nahm eine platzartige Gestalt an. Eine Reihe Patrizierhäuser gegenüber der Kirche St. Moritz dominierte hier das Straßenbild. Links, zwischen Kirche und dem sogenannten Weberhaus, das vor allem aufgrund seiner bunten Bemalung auffiel und als eines der schönsten Bauwerke der Stadt galt, lag der langgezogene Moritzplatz. Mit seinen Plätzen und verwinkelten Gassen, den Kirchen und prächtigen mittelalterlichen Bürgerhäusern, mit seinen zahllosen Geschäften und Lokalen war dieser Ort der vielleicht belebteste in ganz Augsburg.
Das letzte der vier Patrizierhäuser vis-à-vis dem Weberhaus besaß einen abgerundeten Giebel und war etwas breiter als die benachbarten Gebäude. Dieses beherbergte die Palast-Lichtspiele, die im Volksmund einfach nur »Pali« genannt wurden. Das Gebäude, in dem sich um die Jahrhundertwende eine berüchtigte Kaschemme befunden hatte, war schon allein aufgrund der baulichen Gegebenheiten weder das größte noch das modernste Lichtspielhaus der Stadt. Was es auszeichnete, war allein der Umstand, dass es vom Herkulesbrunnen aus am schnellsten zu erreichen war und sich daher, unter Rücksichtnahme auf den halberfrorenen Michel, als das Kino der Wahl aufnötigte.
Zielstrebig betraten die vier das Pali, steuerten umgehend das dort untergebrachte Café an und fanden zu ihrem Glück auch gleich einen freien Tisch.
Während Michel, Christoph und Peter Platz nahmen, begab sich Jan zur Theke. Er wechselte ein paar Worte mit der Bedienung, kehrte dann zum Tisch zurück und setzte sich ebenfalls.
Michel, der noch immer bibberte, als wäre er soeben von einer Antarktis-Expedition heimgekehrt, sah ihn mit seinen blassen Augen bittend an. »Ich hoffe, du hast eine extra heiße Tasse Tee für mich bestellt.«
Jan schlug auf den Tisch und schüttelte den Kopf. »Tee, pah! Vielleicht noch einen Bisquit für die Dame? Da weiß ich was viel Besseres, du wirst schon sehen.«
Kurz darauf eilte auch schon die Bedienung mit einem Tablett voller Getränke herbei. Nacheinander stellte sie vor jeden der Freunde eine Tasse mit unbekanntem, dampfend heißem Inhalt ab. Sie wechselte einen geheimnisvollen Blick mit Jan, dann verschwand sie wieder in Richtung Tresen.
»Du hast Kakao für uns bestellt?«, stellte Peter enttäuscht fest, während er ungläubig in seiner Tasse herumrührte. Mit einem angewiderten Gesichtsausdruck beugte er sich über sein Getränk, rührte und rührte, als suche er nach etwas. »Und ich dachte, aus dem Alter wären wir raus.«
»Einen ganz besonderen Kakao.«, sagte Jan und setzte eine vielsagende Miene auf.
Daraufhin beugte sich Peter noch tiefer über seine Tasse, hätte um ein Haar seine Nase in die Flüssigkeit getunkt, schnupperte und sog den Dampf durch seine aufgeblähten Nüstern. Als er sich aufrichtete, verzogen sich seine Mundwinkel langsam zu einem Grinsen. »Ich verstehe – sooo ein Kakao ist das!« Nach dieser Feststellung schien er es auf einmal gar nicht mehr erwarten zu können. Noch bevor der Trunk eine Temperatur erreichte, die eine verbrennungsfreie Kostprobe gestattete, begann er gierig aus der Tasse zu löffeln.
Christoph staunte nicht schlecht. Schließlich senkte auch er neugierig seinen Kopf, atmete ein und verstand. »Na, hoffentlich bekommt unser Michel danach überhaupt noch was vom Film mit.«, sagte er freudig und begann vorsichtig zu schlürfen.
Michel, der bislang lediglich seine kalten Finger an der Tasse gewärmt hatte, wollte ebenfalls an seinem Getränk schnuppern. Seine eingefrorene Nase zeigte sich allerdings noch nicht wieder voll funktionsfähig und so blickte er nur ratlos in die Runde. Schließlich zuckte er mit den Schultern, nahm schlürfend eine Kostprobe – und verschluckte sich sofort. »Was für ein Teufelszeug … ist das bloß?!«, brachte er gepresst zwischen zwei Hustenanfällen hervor.
Die anderen drei lachten.
»Hast wohl noch nie was von Russischer Schokolade gehört, was?«
Nachdem er wieder zu Atem gekommen war, rief Michel empört: »Aber wir sind doch noch minderjährig!«
»Wirst du wohl die Klappe halten!«, zischte Jan. »Ich kenne die Bedienung.«
Am Nachbartisch saß ein Pärchen mittleren Alters und nahm regen Anteil an dem Geschehen. Die Frau schüttelte missbilligend den Kopf, der Mann sah so aus, als wolle er gleich herüberkommen und den Jungen den Hintern versohlen.
»Man wird ja wohl noch in der Öffentlichkeit einen Kakao trinken dürfen.«, sagte Jan in gespielt wehleidigem Ton, als er bemerkte, dass sie beobachtet wurden.
»Woher kennst du die holde Maid?«, wollte Peter wissen und schielte zur Bedienung hinüber.
Auch Christoph wandte sich um und nahm die Kellnerin etwas genauer unter die Lupe.
Sie mochte um die dreißig sein, ihr Gesicht war ein wenig aufgedunsen, unter ihren Augen zeichneten sich dicke Tränensäcke ab. Um die Makel zu verdecken, hatte sie großzügig Schminke aufgetragen, was alles nur noch schlimmer machte.
Christoph klappte die Kinnlade herunter. »Jetzt weiß ich – letztes Jahr im Bierzelt auf dem Plärrer! Du warst auf einmal verschwunden, auch die Bedienung war wie vom Erdboden verschluckt. Uns hast du damals weißmachen wollen, du hättest den Weg zur Toilette nicht gefunden.« Er drehte sich noch einmal um, blinzelte ungläubig und meinte dann: »Du musst wohl betrunkener gewesen sein als ich dachte.«
»Ein Mann muss eben seine Erfahrungen sammeln.«, bemerkte Peter beiläufig. »Ich würde sie nehmen.«
»Schon gut, ihr Spanner.«, sagte Jan, dem die Situation unangenehm war. »Trinkt aus, dann holen wir uns die Karten.«
»Was wird heute überhaupt gezeigt?«, fragte Michel, dessen Kopf mittlerweile eine rosarote Färbung angenommen hatte.
Jan versuchte sich an das Plakat zu erinnern, an dem sie beim Betreten des Cafés vorbeigekommen waren. »Ich glaube, der Film heißt 'Urlaub auf Ehrenwort' oder so ähnlich.«
Heiter und aufgewärmt gingen die vier zur Kasse, lösten Karten für die Vorstellung und betraten den Saal.
Obwohl es über eine erhöhte Galerie verfügte, war das Lichtspielhaus nicht besonders groß, tatsächlich handelte es sich dabei sogar um das kleinste in der ganzen Stadt. Aufgrund seiner zentralen Lage war es trotz dieses Umstands stets gut besucht, an diesem Tag verhielt es sich damit nicht anders.
Um nebeneinander sitzen zu können, mussten die Freunde mit Randplätzen vorliebnehmen, die sich zudem ziemlich weit vorne befanden. Christoph hasste es, wenn er zu nah an der Leinwand saß, und bekam vom Schräg-nach-oben-Gucken immer Nackenschmerzen. Die anderen schienen sich daran weniger zu stören, was wohl nicht zuletzt der Russischen Schokolade geschuldet sein durfte.
Vor allem Michel war die Wirkung des Alkohols deutlich anzumerken, denn er zappelte und war geschwätziger als sonst. Auch als das Licht ausging, der Vorhang sich öffnete und wie bei Kinovorstellungen üblich eine Folge der aktuellen Wochenschau gezeigt wurde, fiel der ansonsten stille Michel durch ein ungewöhnliches Redebedürfnis auf. »Sag mal, Jan, diese Frau im Café – hast du sie geküsst?«, wollte er wissen und sprach dabei viel zu laut.
»Geküsst und noch einiges mehr.«, beantwortete Peter, ebenfalls nicht gerade leise, die Frage für Jan.
»Pssst!«, war es auch schon aus den Reihen hinter ihnen zu hören.
»Ist doch egal.«, druckste Jan herum. »Ist auch schon ewig her.«
»Letzten Sommer nennst du also ‚ewig her‘?«, mischte sich erneut Peter ein. »Dass du sowas auch für dich behalten musst. Hast du dabei auch nur für eine Sekunde an uns gedacht?«
Jan gab vor, sich auf die Leinwand zu konzentrieren und blieb eine Antwort schuldig.
Michel erwies sich als ungewöhnlich hartnäckig und ließ nicht locker. »Wie ist das so? Mit einer Frau, meine ich.«
»Ja, wie muss man sich das eigentlich vorstellen?«, bohrte Peter nach, beleidigt darüber, dass Jan ihm die Details seiner Liebschaft monatelang vorenthalten hatte.
Christoph vermied es sorgsam, etwas zur Unterhaltung beizutragen, musste insgeheim aber zugeben, dass er gespannt lauschte, wie Jan reagieren würde.
»Ruhe, verdammt nochmal!«, beschwerte sich erneut ein Zuschauer in den hinteren Sitzreihen. »Wenn ihr quasseln wollt, dann geht gefälligst raus!«
Ruckartig drehte sich Jan um, richtete sich dabei zur Hälfte auf. Sein Gesichtsausdruck ließ keinen Zweifel daran, in welch gereizter Gemütsverfassung er sich gerade befand. Vermutlich war er gar nicht so sehr wegen des missmutigen Kinobesuchers wütend, als vielmehr aufgrund von Michels und Peters nervenden Fragen. »Wenn dich die Wochenschau so interessiert, dann lern gefälligst lesen und kauf dir eine Zeitung!«, schimpfte Jan in die ungefähre Richtung, aus der die Beschwerde gekommen zu sein schien. Einige Sekunden lang ließ er herausfordernd seinen Blick über die vom Flimmern der Leinwand angestrahlten Gesichter wandern und wartete darauf, dass sich der Zwischenrufer zu erkennen gab. Niemand meldete sich. Beinahe enttäuscht drehte sich Jan nach vorne und ließ sich wie ein Sack Kartoffeln auf den Sitz plumpsen.
Im Saal kehrte allgemeine Ruhe ein. Der Mann im Publikum, offenbar nicht angetan von der Aussicht, sich mit vier Halbstarken anzulegen, hielt sich zurück. Man musste ihm zugutehalten, dass man im fahlen Zwielicht des Kinosaals den blonden und hochgewachsenen Jan aber auch leicht für einen SS-Mann in Zivil halten konnte. Peter hielt seine freche Zunge ebenfalls im Zaum, weil er es augenblicklich für unklug hielt, Jan weiter zu provozieren. Michel sagte nichts, weil er in seinem trunkenen Zustand darüber nachgrübelte, wie sich das mit den Frauen verhielt. Christoph schwieg, weil er glaubte, vor sich in der ersten Sitzreihe Teresa entdeckt zu haben.
Eben dort hatte sich Augenblicke zuvor ein dunkelblondes Mädchen zur Seite gedreht, um ihrem Sitznachbarn etwas zuzuflüstern. Ihr Gesicht hatte Christoph zwar nicht genau erkennen können, aber dieses Profil, die sanft gewölbte Stirn, die markante Nase mit dem ebenmäßigen Rücken, die schmalen, geschwungenen Lippen und dieses zarte Kinn – das alles hatte er vor der hellen Kinoleinwand wie bei einem Schattenspiel deutlich gesehen. Christophs Herz fing an zu klopfen, wenngleich er sich nicht sicher sein konnte, ob es wirklich sie war, die nur wenige Meter von ihm getrennt saß.
»Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler hat in seiner Rede vor dem deutschen Reichstag die westlichen Demokratien dazu aufgefordert, die Presse in ihren jeweiligen Ländern zu zügeln. Eine Berufung auf die Pressefreiheit wolle er nicht länger als Entschuldigung dafür gelten lassen, dass das Reich in ungebührlicher Weise diffamiert werde.«, sagte gerade der Sprecher der Wochenschau. Weiterhin wurde verlautbart, dass Hitler den wirtschaftlichen Aufbau des Landes und die Aufrüstung des Heeres gelobt habe, was allein der Verdienst des deutschen Volkes und der Partei sei, das Ausland habe daran nicht den geringsten Anteil. Freudig erwähnt habe der Führer außerdem, dass durch den Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Schuschnigg die Differenzen mit dem Nachbarland beigelegt werden konnten. Das Verbot der dortigen NSDAP sei aufgehoben und eine Generalamnestie erlassen worden. In der Folge sei es in Graz und Linz zu nationalsozialistischen Kundgebungen gekommen, am Rathaus in Graz habe man mit Zustimmung des Bürgermeisters die Hakenkreuzfahne gehisst.
Daneben wusste die Wochenschau von weiteren Begebenheiten zu berichten: Der britische Außenministers Anthony Eden war zurückgetreten und durch Viscount Halifax ersetzt, ein Misstrauensvotum gegen den britischen Premierminister Neville Chamberlain hingegen abgelehnt worden; in Berlin hatten der Österreicher Felix Kaspar im Einzellauf und die Deutschen Maxi Herber und Ernst Baier im Paarlauf – letztere bereits zum dritten Mal in Folge – den Weltmeistertitel im Eiskunstlauf geholt; in Prag hatte das kanadische Team England mit 3:1 im Endspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft geschlagen; in New York konnte der Schwarze Joe Louis seinen Weltmeistertitel im Schwergewichtsboxen gegen Nathan Mann durch K.o. in der dritten Runde erfolgreich verteidigen; eine Gegenoffensive der Nationalen zwang die Republikaner, sich aus der erst im Januar eroberten spanischen Stadt Teruel wieder zurückzuziehen; zum zwanzigjährigen Bestehen der Roten Armee wurde in Moskau eine große Militärparade abgehalten.
Christoph bekam von alldem nur wenig mit, zu sehr war er darum bemüht, einen weiteren Blick auf das Mädchen in der ersten Reihe zu erhaschen. Glück hatte er indes keines, sie drehte sich nicht noch einmal zur Seite, sondern hatte sich tief in den Sessel sinken lassen.
Jan stieß ihn mit dem Ellenbogen an. »He, was gibt’s da zu sehen?«, wollte er wissen. Sich derart weit vorlehnend und verrenkend, dass er seinem Vordermann auf den Kopf hätte spucken können, versuchte er herauszufinden, was die Aufmerksamkeit seines Freundes gefesselt haben mochte.
Aus den hinteren Reihen war ein missmutiges Grunzen zu hören, doch niemand sagte etwas.
Jan, der ebenso wenig wie Christoph etwas erkennen konnte, setzte sich wieder, sah seinen Freund fragend an und schüttelte schließlich den Kopf. »Bist wohl am Träumen.«, sagte er und hatte offenbar seine gute Laune wiedergefunden. »Wir sind hier nicht in der Schule. Hier ist Konzentration gefragt.«
»Leise, der Film geht los.«, zischte jemand.
Anders als zuvor erhob Jan dieses Mal keinen Widerspruch. Stattdessen lehnte er sich still zurück und verfolgte den Vorspann.
Auch Michel schien sich mittlerweile beruhigt zu haben, stellte keine weiteren Fragen und rutschte auch nicht auf seinem Platz herum. Vielleicht war er aber auch einfach nur eingeschlafen.
Der Spielfilm begann mit einer Szene im Zug: Eine Ersatzkompanie deutscher Soldaten legt im Jahr 1918 auf dem Weg zur Westfront einen Zwischenstopp in Berlin ein. Die Millionenstadt gilt als revolutionärer Unruheherd, das Klima ist angespannt. Für kriegsmüde Fahnenflüchtige wäre es ein Leichtes hier unterzutauchen und das baldige Ende des Krieges einfach auszusitzen. Aufgrund dessen wird dem Befehlshaber der Kompanie, einem Leutnant Prätorius, von seinen Vorgesetzten dringend dazu geraten, den Männern für die Zeit des Aufenthalts in Berlin keinen Urlaub zu gewähren. Dennoch entscheidet sich der Leutnant, diesen Rat zu ignorieren und stattdessen auf Vertrauen zu setzen. Er gibt den Soldaten, von denen viele aus Berlin stammen, sechs Stunden frei, nimmt ihnen zuvor das Ehrenwort ab, sich pünktlich zur Weiterfahrt am Potsdamer Bahnhof einzufinden. Prätorius weiß, dass er mit seiner Entscheidung ein großes Risiko eingeht, denn sollte sich auch nur ein einziger seiner Männer absetzen, würde man ihn als den verantwortlichen Vorgesetzten vor ein Kriegsgericht stellen.
Nach der Zugszene begleitete die Kamera vier Infanteristen, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten stammten, während ihres sechsstündigen Urlaubs:
Einer von ihnen ist Komponist und besucht seinen alten Musiklehrer, der ihm nähersteht als irgendjemand sonst. Dieser bittet seinen ehemaligen Schüler inständig, sein Talent nicht für einen ohnehin verlorenen Krieg zu verschwenden.
Ein anderer Soldat ist Familienvater von vier Kindern, deren Ernährung und Erziehung aufgrund der Abwesenheit des Vaters allein auf den Schultern der Frau lastet. Um überhaupt genug zum Leben zu haben, hat sich die Frau als Straßenbahnfahrerin dienstverpflichtet, weshalb die Kinder oft sich selbst überlassen bleiben.
Ein Dritter erfährt, dass in der Zwischenzeit seine einzige verbliebene Verwandte verstorben ist. Während er dem deprimierenden Gedanken nachhängt, dass es sich bei ihm nunmehr um den einzigen Lebenden der Familie handelt, trifft er durch Zufall ein Mädchen. Zum ersten Mal in seinem Leben verliebt er sich und spürt die vage Hoffnung in sich aufkeimen, eine eigene Familie gründen zu können.
Ein vierter Infanterist schließlich gehört schon seit längerem der linken Intelligenz an. Er hat die Nase vom Krieg gehörig voll und sieht die einfachen Soldaten als hilflose Marionetten in einem blutigen Machtspiel der etablierten Eliten. Seine Freundin hat sich mittlerweile radikalisiert und ist einer revolutionären Gruppe beigetreten, die Flugblätter gegen den Krieg verbreitet.
Die Soldaten sehen sich im Verlauf des Films – ein jeder auf seine eigene Weise – mit der Frage konfrontiert, ob sie die Gelegenheit nutzen und fahnenflüchtig werden sollen. So unterschiedlich die privaten Umstände auch sind, die Antwort fällt bei allen gleich aus. Obwohl die Versuchung groß ist und die Männer ins Wanken geraten, treffen alle wie versprochen zur gebotenen Stunde am Bahnhof ein. Letztlich hat das Pflichtgefühl über persönliche Nöte oder Sehnsüchte gesiegt.
Leutnant Prätorius stellt am Ende des Films befriedigt fest, dass er seine Männer richtig eingeschätzt hat und sein Vertrauen in sie nicht missbraucht worden ist.
Als die Vorstellung vorbei war, erhoben sich Jan, Christoph, Peter und Michel nicht sofort von ihren Plätzen, um den Saal zu verlassen. Es war so etwas wie eine Tradition, noch ein Weilchen in den bequemen Kinosesseln sitzen zu bleiben und zu entspannen.
Während die anderen Besucher wie ein aufgeschreckter Ameisenhaufen dem Ausgang zustrebten, nutzte Christoph die Gelegenheit und behielt gespannt die erste Sitzreihe im Auge. Auch das Mädchen erhob sich unmittelbar nachdem sich der Vorhang vor der Leinwand geschlossen hatte. Zu seinem Unglück versperrte jedoch ständig jemand die Sicht, sodass Christoph außer einem Haarbüschel, einem Teil des Rückens und einer schmalen Hand nichts weiter von ihr sehen konnte. Am liebsten wäre er aufgesprungen und dem Mädchen nachgeeilt, um herauszufinden, ob es sich wirklich um Teresa handelte. Vor seinen Freunden wollte er sich eine derartige Blöße aber nicht geben und so blieb der Gequälte widerwillig auf seinem Platz sitzen.
Unterdessen kreiste das Gespräch der anderen um den soeben gesehenen Film.
Michel, der wider Erwarten doch nicht geschlafen hatte und mittlerweile wieder halbwegs nüchtern geworden war, sagte gerade: »Was hättet ihr gemacht? Wenn ihr an Stelle der Soldaten gewesen wärt, meine ich. Glaubt ihr, ihr hättet der Versuchung widerstehen können und wärt pünktlich am Bahnhof gewesen?«
»Pünktlich schon mal gar nicht.«, gab Peter unumwunden zu. Er überlegte, fügte dann hinzu: »Nein, ich wäre auf jeden Fall getürmt, keine Frage. Wie bescheuert muss man sein, um so eine einmalige Gelegenheit nicht zu nutzen? Der Krieg war doch eh schon verloren, und sich da noch verheizen lassen? Nein, danke. Dann doch lieber mit der kleinen Kommunistin Flugblätter verteilen.«
Michel sah zu Christoph. »Was ist mit dir, was hättest du gemacht?«
Christoph musste sich besinnen, wovon gerade die Rede war, hatte das Gespräch gar nicht richtig mitverfolgt, bis er bemerkte, dass ihn die anderen drei ansahen. »Ich, ja … vermutlich würde ich es wie Peter machen.«, antwortete er, ohne recht zu wissen, was der eigentlich gerade gesagt hatte. »Und was ist mit dir?«, stellte er die Gegenfrage, vor allem deshalb, um von sich abzulenken.
»Hmm, wer weiß. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht den Mut gehabt, zurückzukehren. Andererseits hätte ich aber auch Angst davor, erwischt zu werden. So genau wüsste ich nicht mal, wovor ich mich mehr fürchten würde.«
Jetzt blickten alle auf Jan, der als letzter noch nicht offenbart hatte, was er an Stelle eines der Soldaten getan hätte.
Zunächst schien es, als denke er gar nicht daran, die Frage zu beantworten. Er wirkte mürrisch und schaute böse. »Ihr gebt also geradeheraus zu, dass ihr allesamt Feiglinge seid?«, brach es schließlich aus ihm heraus. »Ihr würdet bei der ersten Gelegenheit abhauen und eure Kameraden an der Front im Stich lassen? Ganz große Helden seid ihr. Ich hoffe, ich muss nie an eurer Seite in den Krieg ziehen. Wenn alle Deutschen solche Feiglinge gewesen wären, hätten wir den Krieg schon 1914 verloren.« Damit stand er auf und schickte sich an, das Kino zu verlassen, ohne auf seine Freunde zu warten. Grob drängelte er sich an ihnen vorbei, stieß gegen ihre Knie und trat ihnen auf die Füße.
Völlig perplex wussten Christoph, Peter und Michel nicht wie ihnen geschah. Dann sprangen auch sie von ihren Plätzen auf und eilten ihrem Freund hinterher. Draußen, vor dem Eingang zum Palast-Lichtspielhaus, holten sie ihn ein.
Die Kirchturmuhr von St. Moritz schlug 19:30 Uhr. Die Nacht war bereits hereingebrochen, hatte sich mit der Kälte verbündet und stellte sich ihnen wie eine eisige Wand entgegen.
»Warte doch mal, nicht so schnell.«, rief Christoph und hielt Jan am Arm fest. »Das ist doch alles bloß Gerede. Woher soll denn irgendwer wissen können, wie er sich in so einer Situation verhalten würde?«
Die beruhigenden Worte schienen Wirkung zu zeigen, denn Jan blieb stehen, an seinen Schultern konnte man erkennen, wie er sich entspannte.
Diese Gelegenheit nutzte Christoph, um durch einen Scherz die Wogen vollends zu glätten. »Wenn du dieser Leutnant Prätorius wärst, würdest du uns sowieso nicht für eine Sekunde aus den Augen lassen. Mit dir als Vorgesetzten hätten wir sicher nichts zu lachen, geschweige denn die Aussicht auf ein paar Stunden Urlaub.«
Das Lausbubenhafte kehrte in Jans Gesicht zurück. »Euch als Untergebene? Na, Prost Mahlzeit. Da würde ich mich lieber gleich freiwillig für das nächste Himmelfahrtskommando melden.«
Obwohl er noch keine zwei Minuten im Freien verbracht hatte, begann Michel bereits vor Kälte zu schlottern. Das leise, rhythmische Klappern seiner Zähne fassten die Freunde als Stichwort auf und so verabschiedeten sie sich voneinander.
»Wir sehen uns dann am Montag in der Schule.«, sagte Jan, drehte sich um und ging in Richtung Straßenbahn davon.
»Ich bringe den Kleinen hier besser persönlich nach Hause. Nicht, dass er unterwegs noch irgendwo anfriert.«, meinte Peter.
Michel und er wohnten nicht weit voneinander entfernt, sodass es nicht leichtfiel, in Peters Vorhaben ausschließlich einen uneigennützigen Freundesdienst zu erkennen. Dennoch war es gut, dass Michel den Rückweg nicht alleine würde antreten müssen.
Auch Christoph hätte ein Stück mit der Tram fahren können, um schneller nach Hause zu gelangen und der Kälte zu entkommen. Doch er entschied sich anders, machte sich stattdessen zu Fuß auf den Weg und wollte den rund dreißigminütigen Marsch zum Nachdenken nutzen. Also vergrub er die Hände in den Jackentaschen, ließ das Weberhaus rechts liegen und überquerte den Moritzplatz.
Er dachte an Jans übertriebene Reaktion auf ein paar harmlose Kommentare. Der Film musste einen starken Eindruck auf seinen Freund gemacht haben, anders ließ es sich nicht erklären. Jan konnte manchmal recht impulsiv sein, das war nichts Neues. In letzter Zeit schien er allerdings noch dünnhäutiger zu sein als üblich. Vielleicht war aber auch überhaupt nichts dabei und ihn machte lediglich der Umstand nervös, dass im kommenden Jahr der Ernst des Lebens beginnen würde – was niemand so gut nachvollziehen konnte wie Christoph.
Darüber wollte er im Augenblick nicht nachdenken, darum schob er den Gedanken beiseite, oder vielmehr: der Gedanke wurde durch einen anderen verdrängt. Christoph kam das Mädchen aus dem Lichtspielhaus in den Sinn, unwillentlich hatte er sofort Teresas Gesicht vor Augen. War wirklich sie es gewesen, die vor ihm in der ersten Reihe gesessen hatte? Wenn ja, so stellte sich die Frage, wer ihre Begleitung gewesen sein mochte. Inständig hoffte er, dass es kein Junge gewesen war.
In seiner Magengegend machte sich ein Grummeln breit. »Es war bestimmt irgendein Kerl, ganz sicher.«, redete er sich ein. Hätte er doch nur am Ende der Vorstellung besser aufgepasst und darauf geachtet. Er war so auf das Mädchen fixiert gewesen, dass er nichts anderes um sich oder sie herum wahrgenommen hatte. Und doch blieb es ein Rätsel, ob es Teresa war oder nicht.
Die Straßen und Plätze, die Christoph auf seinem Weg nach Hause passierte, waren mittlerweile menschenleer. Es war, als habe die Kälte die Stadt reingefegt und die Bevölkerung in ihre Häuser getrieben. Allein mit sich und den trübsinnigen Ausgeburten seiner Phantasie, stapfte Christoph mit gesenktem Kopf dahin.
Dieser Bursche, mit dem Teresa ausgegangen war, musste ihr Freund sein. Warum sonst sollte sie sich im Kino mit einem Jungen verabreden? Christoph malte sich aus, wie die beiden miteinander tuschelten und lachten. Höchstwahrscheinlich geleitete sie der Kerl in diesem Moment nach Hause, vielleicht küssten und umarmten sie sich auf dem Weg dorthin heimlich in einer dunklen Gasse. Ein schrecklicher, ein grausamer Gedanke. Christoph wurde davon übel.
Andererseits war er aber auch selbst schuld an der Misere, wie er sehr wohl wusste. Es hatte in der Vergangenheit mehr als genug Gelegenheiten gegeben, Teresa um eine Verabredung zu bitten, schließlich waren sie über Jahre hinweg Klassenkameraden gewesen. Er hatte sich bloß nie überwinden und seinen Mut zusammennehmen können, hatte sich nicht einmal getraut, mit ihr zu sprechen. Und nun war es vermutlich zu spät. Was für ein feiger Dummkopf er doch war.
Übel gelaunt und durchgefroren kam Christoph zu Hause an. Als er durch die Türe trat, war seine Mutter gerade dabei, das Abendessen aufzutragen. Betrübt zog er Mantel und Schuhe aus, setzte sich auf seinen Platz am Esstisch, starrte auf seinen Teller und schwieg.