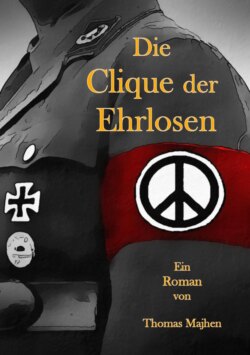Читать книгу Die Clique der Ehrlosen - Thomas Majhen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 3
Der Flaggenmast wies zwei Besonderheiten auf. Zum einen hatte man den hölzernen Mast etwa auf Schulterhöhe mit einem Metallring verstärkt, um ihm dadurch eine größere Stabilität zu verleihen. Zum anderen war die Flagge zum Aufziehen nicht an einem Hanfseil befestigt, sondern an einem Drahtseil. Letzteres konnte durchaus als ungewöhnlich angesehen werden, denn zwar besaß Draht eine wesentlich höhere Zugfestigkeit als Hanf, ein solches Seil war aber auch deutlich teurer in der Anschaffung. Aus diesem Grund gab es im gesamten Reich nur ganz wenige Fahnen, die an einem Seil aus Metall gehisst wurden. Dieses Drahtseil nun, von dem an dieser Stelle die Rede ist, war von einem ortsansässigen Unternehmen gespendet worden, da man dort der Ansicht war, das Seil zum Hissen der Reichsflagge müsse symbolisch für die Stärke und Festigkeit der Nation stehen. Hanf kam für diese Symbolhaftigkeit natürlich nicht in Frage. So war es letztlich gekommen, dass die Augsburger Kreisoberrealschule eines von diesen äußerst seltenen Seilen ihr Eigen nennen durfte. Manch einer war sehr stolz auf diese Besonderheit, andere hingegen – so etwa die große Mehrheit der Schüler – nahm davon nicht einmal Notiz.
Beim Aufhissen der Fahne neigte das dünne Drahtseil dazu, gegen den verstärkenden Stahlring zu schlagen und dabei einen hellen metallischen Klang zu erzeugen. Das sodann rhythmisch auftretende Geräusch erinnerte entfernt an eine kleine Handglocke, wie sie etwa üblicherweise in Form von Altarschellen bei der heiligen Messe in Gebrauch waren. Während der Schülersprecher an dem Seil zog und dabei immer wieder ungewollt dieses Ping! Ping! Ping! Ping! verursachte, fühlte sich der siebzehnjährige Christoph Goeben jedoch nicht an seinen letzten Kirchenbesuch erinnert. Vielmehr musste er unwillkürlich an den italienischen Eisverkäufer denken, der im Sommer täglich seinen Handwagen über das Kopfsteinpflaster der nahen Maximilianstraße rumpeln ließ und sein Kommen mit einem ähnlich grellen, trotz der großen Ähnlichkeit allerdings wunderschönen Klingeln ankündigte.
Was war das doch jedes Mal für ein besonderes Ereignis, sinnierte Christoph, wenn man sich an einem heißen Tag, wenn sich die warme Luft dick und unbeweglich in den engen Gassen der Stadt staute, mit dieser eiskalten Köstlichkeit eine Erfrischung verschaffen konnte! So oft sich ihnen die Gelegenheit dazu bot – und es ihre finanziellen Mittel erlaubten – ließen sich Christoph und seine Freunde von Valerios fahrendem Speiseeis nur allzu gern verführen, setzten sich auf den Rand des Herkulesbrunnens und machten sich genüsslich über ihre Erfrischungen her. Leider würden noch mehrere Monate vergehen, bevor sich endlich wieder derartige Gelegenheiten ergeben würden. Es war erst Anfang Februar und in den vergangenen Tagen schienen sich eisige Winde dazu verschworen zu haben, wütend durch die Straßen zu pfeifen, um die Bewohner von Augsburg in ihre Häuser zu treiben. Als er sich der unangenehmen Kälte bewusst wurde, zog Christoph seinen Mantel enger um sich. Bei den Gedanken an die Vorzüge des Sommers musste er schmunzeln, während er wie durch einen Nebel seltsam unbeteiligt dabei zusah, wie der Schülersprecher mit feierlichem Ernst die Fahne hinaufzog.
Als er sie bis ganz nach oben gezogen hatte und das Ping! Ping! Ping! Ping! dadurch sein Ende fand, trat der nur wenig ältere Schülersprecher in seiner HJ-Uniform einen Schritt zurück, nahm Haltung an und hob ehrfürchtig und feierlich seinen rechten Arm zum Hitlergruß.
Christoph interessierte diese tägliche, vom Staat verordnete Zeremonie nicht besonders. Er blickte umher und betrachtete die umherstehenden Schüler und Lehrer, die auf dem kleinen Vorplatz der Schule in unordentlichen Trauben versammelt waren. Manche tuschelten untereinander, andere glotzten teilnahmslos und verschlafen vor sich hin, einige wenige schenkten dem Spektakel andächtig ihre volle Aufmerksamkeit. Unter der anwesenden Lehrerschaft verhielt es sich übrigens ganz ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass sich unter ihnen ebenfalls einige fanden, die die rechte Hand wahlweise zum militärischen Gruß an die Braue hefteten, oder aber gleich den ganzen Arm zum sogenannten »Deutschen Gruß« emporreckten. Besonders hervor tat sich dabei Ulrich Neumann, der wie zur Salzsäule erstarrt seinen rechten Arm derart unnatürlich gen Himmel schob, als wollte er nach dem Ende der Fahnenstange greifen. Belustigt folgte Christophs Blick dem Arm des Lehrers, bis hin zu dem Objekt, das sein Klassenvorstand dem Anschein nach voller Begierde packen und sodann – wie sich Christoph gehässig ausmalte – liebkosen und wie ein ausgehungerter Liebhaber an seinen krummen kleinen Körper pressen wollte: In einer sanften Brise offenbarte sich die Hakenkreuzfahne in ihrer ganzen blutroten Pracht und flatterte wie zum erhabenen Gegengruß hochmütig über den Köpfen der Angetretenen.
Unmittelbar neben Christoph Goeben wohnte dessen bester Freund Jan Förster dem Pflichtappell bei. Der, schlank und hochgewachsen wie er war, stand kerzengerade da und sah ernst zur Flagge hinauf. Seine Miene ließ nicht erkennen, woran er dabei dachte, doch bezweifelte Christoph, dass es sich ebenfalls um Valerios Eisspezialitäten handeln mochte. Für einen Moment beobachtete er seinen Freund und musterte das wie versteinert wirkende Gesicht. Es war noch nicht lange her, da waren Christoph und Jan gleich groß gewesen. Irgendwann hatte Christophs Körper dann beschlossen, dass es mit dem Wachstum nun genug sei, wohingegen Jan noch einmal einen kräftigen Schub erhalten und in die Höhe geschossen war. So kam es, dass Jan etwa einen dreiviertel Kopf größer war als Christoph. Mit seinen strohblonden Haaren und eisblauen Augen wirkte es schon beinahe, als wolle sich Jan über das von der Partei proklamierte Idealbild eines deutschen Mannes lustig machen. Ohne Zweifel zählte er zu den bestaussehenden Schülern an der Kreisoberrealschule, was ihn bei Lehrern wie auch den Mädchen gleichermaßen beliebt machte. Hinzu kam, dass Jan ein hervorragender Ringer war und zu den besten Sportlern seines Jahrgangs zählte. Viele seiner männlichen Mitschüler eiferten ihm nach, doch spätestens, wenn er sie mit seinem schraubstockartigen Griff auf die Matte presste, mussten sie erkennen, dass sie ihren Meister gefunden und sich nicht ernsthaft mit ihm messen konnten. Auch Christoph zog beim Ringkampf gegen Jan meist den Kürzeren, wenngleich er sich schon das eine oder andere Mal gegen ihn behaupten konnte, worauf er sehr stolz war.
Ohne Vorwarnung stieß Christoph seinen Freund mit dem Ellbogen in die Seite.
Vor Schreck zuckte Jan zusammen, wandte den Kopf und blickte Christoph mit seinen blauen Augen böse an. Nicht einmal eine Sekunde später verwandelte sich der anklagende Blick in das für ihn typische, gewinnende, etwas lausbubenhafte Grinsen. »Pass bloß auf, dass ich nicht deinen ausgetrockneten Kadaver am Mast aufhisse, du Aas!«, sagte er und tat wenig überzeugend so, als meine er es.
»Warum eigentlich nicht? Ob sich der Neumann vor mir dann wohl genauso inbrünstig aufbauen würde wie jetzt gerade?«
»Davon träumst du. Der würde dich eher dafür tadeln, dass du so schlaff und undeutsch wie ein nasser Sack da oben rumbaumeln würdest.«
Beide lachten leise.
Das veranlasste Michel Obermayer, einen schüchternen, blassen Jungen, der etwas abseitsstand, sich zu ihnen herüber zu beugen. »Worüber lacht ihr beide denn?«, wollte er wissen. Die Kälte setzte Michel sichtlich zu, denn er schlotterte und bibberte und trat steif von einem Fuß auf den anderen. Eine Antwort auf seine Frage wartete er nicht ab, stattdessen sagte er: »Können wir das Ganze nicht endlich hinter uns bringen und rein gehen? Ich friere mir hier draußen echt den Arsch ab.«
Tatsächlich wirkte der Junge, als könne er jeden Augenblick zu einem blauen Eiszapfen erstarren, und so blickten sich die Freunde zustimmend an und suchten mit wachsender Ungeduld nach der korpulenten Gestalt des Schuldirektors.
Der stand gleich nach dem Schülersprecher dem Fahnenmast am nächsten und versuchte, soweit ihm dies anatomisch möglich war, stramm zu stehen. Dabei wölbte sich sein Bauch derart weit hervor, dass es schien, als müsse man jeden Augenblick mit dem Abplatzen einiger Mantelknöpfe rechnen. Sekunden später entspannte sich der Direktor und die Gefahr umherfliegender Knöpfe war gebannt. Wippend trat er vor den Flaggenmast, rückte die Brille über der breiten Nase zurecht und verkündete mit näselnder Stimme: »Also gut, alle Schüler in die Klassenzimmer. Der Unterricht beginnt in zehn Minuten!« Mit diesen Worten blickte der Mann noch einmal zur trotzig im Wind hängenden Fahne hinauf. Sein Gesichtsausdruck verriet so etwas wie Ehrfurcht, vielleicht auch ein leichtes Unbehagen, dann machte er kehrt und wippte mit gutem Beispiel voran durch das Hauptportal der Schule.
Lehrerschaft und Schüler folgten ihm nur allzu gern, denn wie um sie vom Vorplatz der Schule zu vertreiben, frischte der Wind auf und kroch in jede noch so winzige Kleidungsritze. Drinnen war es zunächst nicht viel besser. Die Mauern des ehemaligen Nonnenklosters waren zwar dick, ließen sich aber nur schlecht beheizen. Die zahlreichen Flure und offenen Kreuzgänge wirkten zudem in manchen Bereichen der Schule wie Windkanäle, sodass es dort manchmal noch schlimmer blies und pfiff als draußen. Erst in den Klassenzimmern konnte man sich vor Wind und Kälte in Sicherheit wähnen. Dort lungerten die Schüler wenige Minuten vor Ertönen des Gongs wie gewohnt in Grüppchen umher und unterhielten sich.
Christoph stand zusammen mit Jan und Michel am Fenster, als der schlaksige Peter Schießer wie üblich erst kurz vor Beginn des Unterrichts den Raum betrat, einen Augenblick lang nach ihnen suchte und endlich zu ihnen stieß. »Na Leute, habe ich was verpasst?«, fragte er gutgelaunt.
»Allerdings. Wir haben beim Fahnenappell offiziell den Antrag eingereicht, zukünftig Christoph aufhissen zu dürfen, was leider mit knapper Mehrheit abgelehnt worden ist.«, antwortete Jan mit einem Grinsen.
»Schade eigentlich.«, drückte Peter sein Bedauern aus und schüttelte sein pechschwarzes, wildes Haar. Er war ungefähr so groß wie Jan, neigte aber zu einer krummen Körperhaltung, weshalb er etwas kleiner wirkte. In seinem Freundeskreis wie auch innerhalb der Klasse war Peter zudem der älteste, denn seine schon legendäre Faulheit hatte ihm einige Jahre zuvor eine »Ehrenrunde« beschert. »Wäre der Antrag angenommen worden, hätte ich mich vielleicht ab und an beim Appell blicken lassen. Recht verdächtig finde ich jedoch deine Behauptung, an diesem Ort der einstimmigen Uneinigkeit würden mehrstimmige Abstimmungen abgehalten.«
Christoph folgte den hin und her geworfenen Scherzen nur mit halbem Ohr. Seine Aufmerksamkeit galt einem verwaisten Platz in der zweiten Bankreihe.
Dort hatte noch bis zum Ende des vergangenen Schuljahres Teresa gesessen. Dann jedoch hatten sich die von der Reichsregierung verordneten Änderungen im Schulwesen immer stärker bemerkbar gemacht. So sah sich die Schulleitung neben einigen Anpassungen des Lehrplanes im vergangenen September dazu veranlasst, Mädchen und Jungen in voneinander getrennten Klassen zu unterrichten.
Im Schulalltag war es aufgrund dieses Beschlusses seither wesentlich langweiliger geworden als zuvor. Zwar hatte Christoph nie den Mut aufgebracht, Teresa um eine Verabredung zu bitten. Aber schon die bloße Gewissheit, dass sie sich zusammen im selben Raum befanden, hatte ihm den Tag versüßt. Zudem hatte stets die aufregende Möglichkeit bestanden, dass sich ihre Blicke zufällig trafen – nicht, dass er einem solchen Blickkontakt allzu lange standgehalten hätte, doch damit war es ohnehin schon seit einigen Monaten vorbei. Nun konnte er lediglich auf eine Begegnung in der Pause oder nach Unterrichtsschluss hoffen. Wenn auch eine solche »Begegnung« lediglich in einem verstohlen nach der ehemaligen Mitschülerin schielenden Christoph bestand.
Abrupt hielt Peter, der quasseln konnte wie ein Kolibri mit den Flügeln schlagen, inne. Irritiert bewegte er seinen Kopf ruckartig hin und her wie ein Huhn, das einem schlüpfrigen Wurm, der ihm kurzzeitig im hohen Gras aus dem Blickfeld entwischt war, nachspürte. »Da soll mich doch ... Wo zum Henker ist eigentlich dieser Schönfeld? Der ist doch noch nie zu spät gekommen, krank war der seit er in der dritten Klasse die Masern hatte auch noch nie!«
Angesichts dieser Feststellung wandten auch die anderen nicht wenig verwundert die Köpfe um, wenngleich sie August Schönfelds Abwesenheit bislang noch gar nicht bemerkt hatten. Vergeblich suchten sie das Klassenzimmer nach den Gesichtszügen des fraglichen Schülers ab. Er war nirgends zu sehen.
»Vielleicht hat es in der Familie einen Todesfall geben.«, mutmaßte Michel mit schwacher Stimme, so als könnte allein das bloße Aussprechen dieser schwarzmalerischen Vermutung ein Unglück heraufbeschwören.
Peter schien ihn gar nicht zu hören. »Wenn mir jetzt schon die Streber beim Zuspätkommen Konkurrenz machen, dann ist alles aus.« Ungläubig und mit beleidigtem Ausdruck fahndete er weiter nach dem Vermissten. »Das kann der doch nicht machen …«
Von der Tür ertönte der Ruf eines Mitschülers: »Der Neumann kommt!«
Auf dieses Alarmsignal hin setzte im Klassenzimmer routinierte Hektik ein. Die Schüler sortierten sich, stellten die Unterhaltungen ein und nahmen vor ihren Sitzplätzen Aufstellung.
Schon waren vom Korridor her Stiefelschritte zu hören, die auf dem Linoleumfußboden ein volltönendes Echo erzeugten, das an Lautstärke zunahm. Sekunden später erschien die kleine, bucklige Gestalt von Klassenvorstand Ulrich Neumann in der Tür. Der hatte es sich seit einiger Zeit angewöhnt, auch im Unterricht eine braune SA-Uniform zu tragen, darüber hinaus war neuerdings so etwas wie ein schmaler Oberlippenbart an ihm zu sehen. Vor dem Hitlerportrait am Eingang zum Klassenzimmer blieb er stehen, schlug krachend die Hacken zusammen und wartete mit strenger Miene auf den Gruß der Schüler.
»Heil Hitler!«, erklang es wie auf ein unsichtbares Zeichen hin mustergültig im Chor. Christoph glaubte allerdings gehört zu haben wie Peter, dessen Sitzplatz sich direkt hinter dem seinen befand, stattdessen schnell und undeutlich »Drei Liter!« gebrüllt hatte.
Klassenvorstand Neumann indessen merkte von diesem Affront nichts. Er erwiderte den Gruß, indem er sich wie eben beim Fahnenappell unnatürlich versteifte und seine schiefgewachsene Gestalt geradezubiegen versuchte. Gemessenen Schrittes marschierte er sodann zum Pult und nahm umständlich Platz, in etwa so wie ein gefeierter Konzertpianist, der sich vor seinem erwartungsfrohen Publikum an den glänzend polierten Flügel setzt. Erst nachdem er seinen eigenen Stuhl in eine bequeme Position zurechtgerückt hatte, erhielten die Schüler die Erlaubnis ebenfalls Platz zu nehmen. Als richte er ein Notenblatt aus, um bequem davon ablesen und sodann in die Klänge eines Klaviers verwandeln zu können, ordnete Ulrich Neumann das Klassenbuch so an, dass es symmetrisch zu den Kanten des Pultes lag. Danach begann er die Namen der Schüler in alphabetischer Reihenfolge vorzulesen. Sobald jemand aufgerufen wurde, bestätigte dieser mit einem lauten »Hier!« die eigene Anwesenheit.
»Aalbek?«
»Hier!«
»Bauer?«
»Hier!«
»Dietz?«
»Hier!«
»Emil?«
»Hier!«
»Förster?«
»Hier!«
»Goeben?«
»Hier!«
»Obermayer?«
»Hier.«
»Preuß?«
»Hier!«
»Radler?«
»Anwesend!«
»Rotbusch?«
»Hier!«
»Schießer?«
»Jawohl!«
»Schönfeld?«
Keine Antwort.
Durch die unerwartet auftretende Unterbrechung aus dem Takt gebracht, hielt der Klassenvorstand inne und sah vom Klassenbuch hoch. Seine Augen suchten den Missetäter, in freudiger Erwartung, diesen sodann vor versammelter Klasse für seine Unachtsamkeit zurechtweisen zu können.
Neugierig suchten die Schüler nach dem Frevler, schauten sich gegenseitig fragend an, starrten dann zum Pult und fieberten mit Spannung der Aufklärung dieses merkwürdigen Rätsels entgegen: Schönfeld nicht anwesend – ein Ding der Unmöglichkeit! Es war vollkommen still, niemand wagte es auch nur zu atmen.
Neumanns Blick klärte sich, nun fiel es ihm wieder ein. Noch nicht bereit, diesen Moment seiner Überlegenheit aus der Hand zu geben, zog er die entstandene Pause mit sichtlichem Genuss in die Länge. Langsam und andächtig wie ein Priester auf der Kanzel ließ er seinen Blick durch die Reihen der Schüler wandern. Meisterhaft verstand er es, selbst das kleinste bisschen Macht, die ihm jede noch so unbedeutende Gelegenheit seiner Lehrtätigkeit darbot, in sich aufzusaugen und auszukosten, so wie ein Feinschmecker einen Bissen Tartar auf der Zunge zergehen lässt. Ein kaum merkliches Lächeln umspielte seine schmalen Lippen, als er unschuldig sagte: »Ach, das hatte ich ja völlig vergessen. August Schönfeld ist nicht länger Schüler dieser Anstalt.«
Vereinzeltes Gemurmel machte sich breit. Jedermann schien fassungslos ob dieser völlig absurden Offenbarung. »Nicht mehr Schüler dieser Anstalt« – was sollte das bedeuten?
»Ich darf wohl um Ruhe bitten!«, forderte der Lehrer. »Die Schulleitung hat sich beraten und ist letztendlich zu einer längst überfälligen Entscheidung gelangt. Alle Schüler, die das Blut der verderbten jüdischen Rasse in sich tragen, dürfen dieses Institut fortan nicht mehr besuchen.«
Ein Raunen lief durch die Klasse, das Getuschel schwoll zu allgemeiner Unruhe an. Diesmal ließ der Lehrer seine Schüler großmütig gewähren.
Jan drehte sich zu Christoph. »Irgendwoher habe ich schon gehört, dass Schönfelds Großmutter Jüdin sein soll. Jetzt ist es wohl offiziell.«
»Halbjüdin.«, warf Michel, der hinter Christoph und Jan saß und Peters Banknachbar war, mit bleichem Gesicht ein.
»Das macht ihn dann wohl zu einem Vierteljuden oder so.«, schlussfolgerte Christoph.
»Prima, erst nehmen sie uns die Frauen weg, und dann auch noch die Juden.«, nuschelte Peter vor sich hin. Ob er das scherzhaft meinte oder nicht, war ihm nicht anzumerken.
Jemand unterdrückte prustend ein Lachen.
Christoph fand das nicht lustig. Zwar konnte er sich nicht unbedingt als Freund von August Schönfeld bezeichnen, tatsächlich hatte er nie mehr als ein paar unbedeutende Worte mit dem als Streber bekannten Sonderling aus der ersten Reihe gewechselt. Dennoch beunruhigte ihn die Vorstellung, dass Schulkameraden, mit denen er seit Jahren gemeinsam die Schulbank drückte, ohne Vorwarnung mitten im Schuljahr und von einem Tag auf den anderen der Schule verwiesen wurden. Hinzu gesellte sich ein besonderer Umstand, der diese Willkür noch ungerechter erscheinen ließ. Dieses Schuljahr war nämlich für Christophs Klasse das letzte an der Kreisoberrealschule. Im kommenden Jahr 1939 würden sie alle ihr Abitur schreiben und in die Welt entlassen werden – alle bis auf August, der in diesem Moment vermutlich zu Hause saß und selbst nicht wusste, wie ihm geschah.
Natürlich war die Hetze gegen die Juden gerade in der Presse schon längst eines der vorherrschenden Themen. Gelegentlich spürte man davon auch etwas auf den Straßen der Stadt, so kam es immer wieder zu Sachbeschädigungen und Schmierereien. Einige Male hatte es auch schon handfeste Ausschreitungen gegeben, bei denen Schaufenster eingeworfen oder Personen zusammengeschlagen wurden. Am darauffolgenden Tag hieß es dann jedes Mal in den Zeitungen, der »Volkszorn« habe sich »spontan entladen«. Christoph und seine Freunde waren bereits Zeugen derartiger Übergriffe geworden. Schweigend und sicherlich auch bedrückt, zugegebenermaßen aber auch ein bisschen aufgeregt und fasziniert hatten die Jungen bei einer Gelegenheit dabei zugesehen, wie jemand Aufrufe wie »Kauft nicht bei Juden!« und ähnliches auf Schaufenster gemalt hatte. Die Abneigung gegen alles Jüdische war also durchaus nichts Neues für Christoph und seine Klassenkameraden. Nun aber zu erleben, wie sich die üblichen boshaften Phrasen vermehrt in greifbaren Veränderungen des Alltags manifestierten, das erschütterte zumindest Christoph zutiefst.
Es drängte ihn zu erfahren, wie Jan darüber dachte. Als er jedoch die ernste Miene seines Freundes bemerkte, zögerte er. Etwas schien seinen Freund zu beschäftigen, schon zum zweiten Mal an diesem Morgen machte der einen geistesabwesenden, nachdenklichen Eindruck, was ausgesprochen untypisch für den ansonsten lebhaften und nicht sehr zurückhaltenden Jungen war. Christoph beschloss, Jan bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit danach zu fragen, ob ihn etwas bedrücke.
Für den Augenblick musste er sich ohnehin gedulden, da Klassenvorstand Neumann die unter den Schülern aufgeflammten Diskussionen über das unerwartete Ausscheiden ihres Mitschülers mit einem Machtwort erstickte. Ohne weitere Erklärungen beendete der Lehrer sogar seine geliebte Anwesenheitskontrolle, obwohl noch nicht einmal der Buchstabe »S« erschöpfend abgefragt worden war. Mit Ausnahme von August Schönfeld schien aber sowieso niemand zu fehlen.
Die folgende Stunde wurde der deutschen Geschichte gewidmet, neben Erdkunde das zweite Fach, das Ulrich Neumann unterrichtete. Thematisch war man in der Mitte des 18. Jahrhunderts angekommen und behandelte derzeit den Siebenjährigen Krieg.
Heute erfuhren die Schüler, dass es sich bei diesem Konflikt tatsächlich um einen regelrechten Weltkrieg gehandelt habe, da er neben Preußen und Russland außerdem von den europäischen Großmächten Großbritannien und Frankreich geführt worden war, deren Kolonialreiche sich zu damaliger Zeit über den gesamten Erdball erstreckten. So bekriegten sich die teilnehmenden Parteien nicht nur in Europa, sondern auch in der Neuen Welt, in Indien, im Pazifik und auf den Weltmeeren. Demzufolge handelte es sich beim zurückliegenden Weltkrieg schon um den zweiten, der diese Bezeichnung verdiente. Allerdings, so versäumte es der Klassenvorstand nicht zu erwähnen, sehe die internationale Geschichtsforschung geflissentlich über diese Tatsache hinweg. Schließlich war den Siegermächten mehr als alles andere daran gelegen, Deutschland die alleinige Schuld am Krieg in die Schuhe zu schieben – und welche Schuld könne schwerer wiegen, so Neumann weiter, als den allerersten Weltkrieg der Menschheitsgeschichte entfesselt zu haben. Mittlerweile sei es gängige Praxis in der von den Westmächten dominierten Geschichtsforschung, selbst weit zurückliegende Ereignisse aus der Perspektive von 1918 zu beurteilen. Denn nur so sei es möglich, Deutschlands Ruf in der Welt auf Dauer zu schädigen und dem deutschen Volk dem ihm zustehenden Platz auch in Zukunft zu verwehren.
Nach diesem Seitenhieb gegen Briten und Franzosen veranschaulichte Klassenvorstand Neumann seinen Schülern vor einer an der Wand hängenden großen Karte von Europa, in welch verzweifelter Situation sich Preußen in den Jahren 1756 bis 1763 befunden hatte. Eine ganz ähnliche Situation übrigens, wie auch 1914 bis 1918, betonte er. Schon damals sei man nach demselben Muster vorgegangen, das hundertfünfzig Jahre später noch einmal zur Anwendung kommen sollte, um das aufstrebende Reich im Herzen Europas unter der Knute zu halten: es wurde eingekreist und von mehreren Seiten aus angegriffen. Der preußische König Friedrich der Große habe sich selbstredend nur deshalb solange gegen die geballte Übermacht seiner Feinde behaupten können, so der Klassenvorstand weiter, weil er neben seinem eigenen strategischen Genie auf hervorragend ausgebildete, bedingungslos gehorsame und vor allem arische Soldaten zurückgreifen konnte. Darüber hinaus galt aber auch das sogenannte »Mirakel des Hauses Brandenburg«, das Preußen vor der Niederlage bewahrte, als unumstößlicher Beweis der göttlichen Vorsehung, die dem absolutistischen Staat eine herausragende Rolle zusprach, die schließlich in der Gründung des Deutschen Reiches gut einhundert Jahre später münden sollte.
Eine Eigenart von Klassenvorstand Neumann bestand darin, recht schnell vom eigentlichen Unterrichtsthema abzuschweifen – eine der ausgesprochen wenigen Eigenschaften, die seine Schüler an ihm zu schätzen wussten. Nicht etwa, weil sie seine Erzählungen für interessant hielten, sondern vielmehr wegen der damit verbundenen kurzzeitigen Entfernung vom alltäglichen Lerndruck, die diese Episoden fernab des Lehrstoffes mit sich brachten. Mit besonderer Vorliebe begann Neumann sodann häufig von der eigenen glorreichen Zeit in der Armee zu erzählen. Folgerichtig driftete er auch diesmal in Anbetracht all der vermeintlichen Parallelen, Zeichen und Verschwörungen ganz unvermeidbar zur jüngeren deutschen Geschichte und seiner eigenen Rolle darin ab.
Nach eigener Aussage hatte sich Ulrich Neumann schon als junger Student 1914 freiwillig zur Armee gemeldet. Noch heute erfülle es ihn mit Stolz, an den verlustreichsten Schlachten der Westfront teilgenommen zu haben, wie er behauptete. Wenn man ihm nun bei seinen Erzählungen zuhörte, bekam man – nicht wörtlich zwar – in etwa das folgende Bild vermittelt: Heldenhaft und unerschrocken war er über die verwüsteten Landstriche Flanderns geprescht und hatte sich ungeachtet der eigenen Unversehrtheit der Übermacht seiner Feinde entgegengeworfen.
Und weiter: Auch dieser Krieg, der, wie gesagt, bei genauerer Betrachtung eigentlich bereits als der Zweite und nicht einfach nur als der Weltkrieg hätte bezeichnet werden müssen, wäre ohne den geringsten Zweifel zu Deutschlands Gunsten ausgefallen. Hätte es da nicht diesen unbeschreiblichen Verrat, diesen Dolchstoß in den Rücken des ruhmreichen, im Felde unbesiegten Heeres gegeben.
»Feige Sozialdemokraten, hinterlistige Kommunisten und andere vaterlandslose Zivilisten haben im Auftrag des internationalen Judentums die deutsche, unbesiegte Armee von hinten erdolcht.«, schwadronierte Neumann, wild mit den Händen herumfuchtelnd. »Das Deutsche Kaiserreich wird sich bis in alle Ewigkeit vorhalten müssen, dass es ihm nicht gelungen ist, dieses jüdisch-bolschewistische Ungeziefer rechtzeitig auszumerzen. Aber diesem Ungemach des deutschen Volkes wird nun endgültig ein Ende bereitet. Nie wieder wird es einem Juden gestattet sein, einen Deutschen ungestraft herum zu schubsen und ihm das Mark aus den Knochen zu saugen. Hätte schon früher ein Mann wie unser Führer an der Spitze des Staates gestanden, dann wäre der Verlauf der Geschichte ein anderer gewesen und nicht uns wären derart niederträchtige, jedweder Vernunft entbehrende Bedingungen in Versailles diktiert worden, oh nein, wir hätten sie unseren Feinden diktiert, und zwar nicht nur in Versailles, sondern außerdem im englischen Parlamentsgebäude oder im Palast von Buckingham!«
Von der hinteren Bank ließ sich flüsternd Peter Schießer vernehmen: »Jawohl, wir hätten diese unvernünftigen und niederträchtigen Bedingungen diktiert!«
Christoph musste ein Lachen unterdrücken.
Derlei Tiraden ihres Klassenvorstands kannten die Schüler bereits zur Genüge, dennoch fanden sich immer einige unter ihnen, die gebannt zuzuhören schienen oder jedenfalls sehr überzeugend so taten. Peter hingegen, da hegte Christoph nicht den Ansatz eines Zweifels, hörte nicht wirklich zu. Er besaß lediglich ein ausgeprägtes Talent dafür, nur die Dinge aufzuschnappen, die er sodann für seine Albernheiten verwenden konnte.
Dessen wiederholten Behauptungen zum Trotz ging jedenfalls schon seit längerem das hartnäckige Gerücht um, Klassenvorstand Neumann habe nach der militärischen Grundausbildung nie mehr auch nur einen einzigen Schuss abgegeben, geschweige denn an einer großen Schlacht teilgenommen. Stattdessen soll dieser – einer besonders üblen Nachrede zufolge – den Krieg abseits des Frontgeschehens in der Etappe verbracht haben. Stimmen, die behaupteten, Genaueres zu wissen, reduzierten des Lehrers Beteiligung am Kriege auf das Transport- und Nachschubwesen, wo er als Kraftfahrer die kämpfenden Truppen mit Munition, Proviant und sonstigem versorgt haben soll. Immerhin waren sich selbst seine größten Zweifler darin einig, dass er sich wirklich gleich zu Kriegsbeginn mit großer Begeisterung freiwillig gemeldet habe, also wohl zumindest in diesem Punkt die Wahrheit erzählte.
Während der Klassenvorstand laut aussprach, was ihn unentwegt zu beschäftigen schien, ging er mit hinter dem Rücken verschränkten Armen energisch vor der Tafel auf und ab. Gelegentlich, wenn er das eine Ende der Wand erreichte, blieb er vor dem Portrait Adolf Hitlers stehen und betrachtete es eingehend, als wolle er Fragen: »Habe ich das so zutreffend ausgedrückt, mein Führer?«. Die Wut, in die er sich bei solcherlei Reden jedes Mal steigerte, war ihm deutlich anzusehen; sein Gesicht lief rot an, auf seiner Stirn wölbte sich eine dicke pulsierende Ader hervor, Speichel verfing sich in seinem dünnen Schnurbart. Neumanns überaus emotionaler Auftritt erstickte jede Unterstellung, wie sie etwa ein unerfahrener Zuschauer dieses Schauspiels hervorbringen mochte, er würde nur die Wahlsprüche der Partei nachplappern. Es stand ganz und gar außer Frage, dass dieser Mann auch wirklich meinte, was er da laut und polternd von sich gab.
Abgesehen von den üblichen Strebern verfolgte die Mehrheit der Schüler das dargebotene Spektakel nur halbherzig. Stattdessen nutzten viele die Gelegenheit, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen oder im Flüsterton das eine oder andere Privatgespräch zu führen. Hierbei musste man jedoch Vorsicht walten lassen, da ein allzu forsch geführtes Schwätzchen den Lehrer aus seinem Monolog heraus und zurück in die Gegenwart reißen konnte. In einem solchen Fall war es mit der willkommenen Auszeit schnell vorbei.
Unerwartet wurde Christoph von einem zusammengeknüllten Stück Papier im Nacken getroffen. Als er sich nach hinten umdrehte, blickte er in Peters frech grinsendes Gesicht.
Dieses Gesicht jedoch schien seltsam verändert: Die Oberlippe war mit einem schwarz bemalten Fetzen Papier beklebt, sodass Peter aussah, als habe er sich in den vergangenen zehn Minuten ein Hitlerbärtchen wachsen lassen. Nachdem er sich der Aufmerksamkeit seiner Freunde sicher sein konnte, ballte er die Hand zur Faust und hieb sich mehrfach gegen die Brust, während er in einer überzeugenden Imitation des Führers die Augen weit aufriss und wie ein Wildgewordener, allerdings ohne auch nur den kleinsten Laut von sich zu geben, die Lippen synchron zur Rede des Klassenvorstands bewegte.
Die ungebändigten Haare Peters, die im scharfen Kontrast zum strengen Scheitel des Imitierten standen, taten ihr Übriges und so konnte Christoph nicht länger an sich halten und musste laut lachen.
Augenblicklich herrschte vollkommene Ruhe.
Christoph hielt sich die Hand vor den Mund, doch es war bereits zu spät. Alle starrten ihn an. Von Erstaunen über Entsetzen bis hin zu Belustigung war in den Gesichtern, von denen er umringt war, alles zu lesen.
Nur der Klassenvorstand, dessen Kopf in immer neuen Rottönen leuchtete, stellte unverhohlenen Hass zur Schau. Fast schien es, als wolle der Lehrer jeden Augenblick über die Schulbänke hinweg wie über die aufgerissenen und blutdurchtränkten Felder Flanderns auf ihn losstürmen, und Christoph am Kragen packen.
Auch alle anderen waren gespannt, was nun geschehen würde, und sahen aufgeregt zwischen Christoph und dem Klassenvorstand hin und her.
»Du Dummkopf, das hast du nun davon.«, flüsterte Jan wenig ermutigend.
Michel beobachtete die Szene mit offenem Mund, vergrub sein Gesicht dann in beiden Händen, als könne er nicht hinsehen.
Peter riss sich eilig das Hitlerbärtchen von der Lippe und ließ es so aussehen, als habe er sich lediglich unter der Nase gekratzt.
Neumann machte einige schnelle, bedrohliche Schritte in Christophs Richtung und blieb nur wenige Zentimeter, bevor er mit dem Pult seines Schülers zusammengestoßen wäre, stehen. Er ließ beide Arme an den Seiten herabhängen, ballte die Fäuste, bis die Knöchel weiß hervortraten, sein Bärtchen zuckte unkontrolliert. Nur mit Mühe bewahrte er die Fassung, am Ende aber gelang es ihm. Anstatt handgreiflich zu werden, wie es offenkundig sein erster, nur mit einiger Willensanstrengung unterdrückter Impuls war, öffnete sich sein Mund zu einer Standpauke. »Sie, Goeben, sind hier einer der letzten, der etwas zu lachen hat!«, spie er mit wutverzerrtem Gesicht. »Die Matura mag erst im kommenden Jahr sein, aber glauben Sie nicht, Sie hätten ihren Abschluss bereits in der Tasche!«
Damit machte er kehrt, und schon dachte man, er würde zur Tafel zurückkehren, als er sich besann und sich noch einmal, schon etwas ruhiger, an die Übeltäter wandte. »Und übrigens, Schießer: Wie mir zu Ohren gekommen ist, haben Sie es genauso wenig wie Goeben hier bislang für nötig gehalten der Hitlerjugend beizutreten.« Bedeutungsschwer und vorwurfsvoll schüttelte er den Kopf. »Sie beide sind wahrlich eine Schande für diese Schule, ja für die deutsche Jugend! Denken Sie an meine Worte, mit dieser Einstellung wird es für Leute wie Sie schon bald sehr düster aussehen!«
***
Nach Unterrichtsschluss waren die Freunde angesichts der Ereignisse des Tages noch immer viel zu aufgewühlt, um sofort nach Hause zu gehen. Stattdessen begaben sie sich daher in den nicht weit von der Schule entfernten »Ratskeller«. Die Gaststätte im Gewölbekeller des Augsburger Rathauses war nach umfangreichen Sanierungsarbeiten erst kürzlich wiedereröffnet worden und hatte sich seither zu einem beliebten Treffpunkt der Jugendlichen entwickelt. Hier konnte man in Ruhe sitzen, sich unterhalten oder Karten spielen – und was den Konsum von Bier und Tabak betraf, stellte die Bedienung für gewöhnlich nicht allzu viele Fragen. An einem Tisch, der sich direkt an einen der mächtigen Stützpfeiler anschmiegte, nahmen Jan, Christoph, Peter und Michel Platz.
Als nach wenigen Minuten die Bedienung angeschaukelt kam, um die Bestellungen entgegenzunehmen, hatte noch niemand auch nur ein Wort gesprochen. Michel hatte den Kopf auf die Brust gesenkt und spielte mit seinen Fingern; Peter ließ den Blick umherschweifen und besah sich die Gäste des Lokals; Jan zündete sich eine Zigarette an und beobachtete, wie der Rauch langsam zur Decke stieg und sich dort in blauen Schwaden sammelte; Christoph sah Jan beim Rauchen zu.
»Servus Buam.«, grüßte die Bedienung die Jungen. »Wissts scho, was ihr dringa megts?«
Selbstbewusst und betont langsam zog Jan an seinem Glimmstängel. Nachdem er einen blauen Schwall Rauch ausgeatmet hatte, antwortete er: »Eine Halbe für mich.«
»Für mich auch.«, folgte Christoph Jans Beispiel.
»Wer bin ich, in solch illustrer Runde aus der Reihe zu tanzen?«, mimte Peter den Dichter und schielte, sich dabei über die Lippen leckend, ins Dekolleté der Bedienung.
»Is des net no a bissl früh am Dog?«, wandte die Kellnerin, die nur wenig älter zu sein schien als die Schüler, mit hochgezogenen Augenbrauen ein.
Jan sah sie nur eindringlich mit seinen eisblauen Augen an. Sein Blick allein verriet, dass er von solcherlei Vorbehalten nicht allzu viel hielt.
Nicht weit vom Tisch der Freunde entfernt stimmte eine betrunkene Stimme ein Lied an. Dort hatte es sich eine Gruppe von Männern in SA-Uniform gemütlich gemacht und offenbar bereits ein Stadium des Alkoholkonsums erreicht, das die musikalischen Talente des Menschen zum Vorschein bringt. Zum Leidwesen der übrigen Gäste waren diese recht rudimentär ausgeprägt.
Einer der Männer prustete gerade kräftig durch die von Bierschaum bedeckten Lippen, verteilte dadurch einen erfrischenden Biernebel über seinen Kameraden und schien sich vor Lachen kaum mehr halten zu können.
»Und was ist mit denen da?«, gab Christoph mit einer Kopfbewegung zu bedenken. »Ist es für die nicht auch zu früh?«
»Scho guat, i hob nix gsogt.«, lenkte die Bedienung schließlich ein, sichtlich nicht besonders glücklich über die lautstark feiernden Braunhemden. Sodann richtete sie ihren zweifelnden Blick auf Michel, der wesentlich jünger als die anderen wirkte und seine Bestellung bislang schuldig geblieben war.
Der hob nur ganz kurz den Kopf, so schnell, dass er die kurvenreiche Kellnerin, die in ihrem blau-weißen Dirndl am Tisch stand und wartete, kaum angesehen haben konnte. Unmittelbar darauf errötete er und fand ein ungewöhnlich reges Interesse am Bierdeckelhalter in der Mitte des Tisches. »Ich ... äh ... nehme ein Glas … Wasser, bitte.«, stotterte er so leise, dass er kaum zu verstehen war.
Während die Bedienung mit der Aufnahme der Bestellungen beschäftigt war, studierte Jan eingehend ihr enormes Dekolleté, das zwischen blau-weißen Karomustern und weißer Spitze eingezwängt die Blicke förmlich einzusaugen schien. Als sie sich auf dem Weg zum Ausschank begab, sah er noch für einige Sekunden ihrem schaukelnden Hinterteil nach.
Peter, der mit dem Rücken zum Tresen saß, bemerkte Jans Blick. Umständlich verrenkte er sich, prüfte eingehend die Aussicht, um sodann kennerhaft festzustellen: »Dass man von hier drinnen bei klarem Wetter die Alpen sehen kann, ist mir neu. Donnerwetter!« Befriedigt von dem dargebotenen Augenschmaus, zündete auch er sich eine Zigarette an.
Neuerliches Schweigen hüllte die Runde ein. Obwohl es viel zu besprechen gab, schien niemand die rechten Worte zu finden. Wenigstens war es im Ratskeller derart laut, dass die Stille nicht peinlich zu werden drohte.
Indem er sich an Michel wandte, brach Jan als erster das Schweigen. »Ich wusste ja gar nicht, dass du neben Weiß, Grau und Grün auch noch andere Farben draufhast. Das reinste Chamäleon bist du.« Er tätschelte die sandfarbene Säule neben sich. »Kriegst du eigentlich auch die Farbe hier hin? Mensch, stell dir vor, du könntest praktisch den ganzen Tag hier sitzen und keiner würde dich sehen.«
Michel erwiderte kein Wort. Von einem sandfarbenen Ton war sein Gesicht weit entfernt, vielmehr glich es dem einer Hagebutte.
»Lass ihn doch, Mensch.«, sprang Christoph dem schüchternen Jungen zur Seite. »Hack auf jemand anderes herum.«
»Lass ihn doch, hä?«, äffte Jan Christoph nach und beugte sich zu ihm herüber. »Du solltest mal deine eigene Klappe besser unter Kontrolle halten. Das gilt im Übrigen auch für dich und deine kindischen Scherze.«, fügte er an Peter gewandt hinzu. »Könnt ihr euch nicht wenigstens noch für ein Jahr zusammenreißen? Manchmal benehmt ihr euch wie kleine Kinder.«
»Ja, schon gut. Lasst uns lieber mal darüber reden, was mit August Schönfeld passiert ist.«, versuchte Christoph das Gespräch auf ein Thema zu lenken, das ihn weitaus mehr beschäftigte als diese unbedeutende Auseinandersetzung mit Klassenvorstand Neumann. »Gestern hat er noch auf seinem Platz gesessen, als wäre alles in bester Ordnung, und heute wird uns aus heiterem Himmel eröffnet, dass er von der Schule geflogen ist.«
»Was kümmert dich das?«, wollte Jan gereizt wissen. Seine Laune schien immer schlechter zu werden. »Mit dem kleinen Juden hast du doch eh nie was zu tun gehabt. Ein Wunder eigentlich, dass du dich überhaupt noch an seinen Namen erinnerst.«
Christoph überging Jans Spott, wunderte sich aber über den Grund von dessen Bissigkeit. »Beunruhigt dich das nicht auch, wenn jemand so mir nichts dir nichts von der Schule verwiesen wird? Und das nur, weil einer seiner Vorfahren irgendwann mal eine Jüdin geheiratet hat?«
»Ein paar Mal habe ich mich heimlich mit seiner Schwester getroffen.«, eröffnete Peter seinen Freunden. »Schönfeld meine ich. Also Schönfelds Schwester. Ihr wisst schon, was ich meine.«
Jan hörte ihn gar nicht. »Ist euch jemals in den Sinn gekommen, dass wahr sein könnte, was sie uns über die Juden und die Bolschewiken erzählen?«, fragte er in die Runde. »Warum sollten sie uns auch anlügen? Irgendwie seltsam sind sie ja, das habe ich mir schon immer gedacht. Und ich rede jetzt nicht mal von den Orthodoxen mit ihren schwarzen Anzügen und Hüten, ihren Bärten und Locken. Die meisten von denen sehen auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich aus, verhalten sich nach außen hin genauso wie wir und geben sich ganz normal. Aber bei genauerem Hinsehen gibt es äußerlich eben doch gravierende Unterschiede, und das ist wissenschaftlich untersucht worden. Denkt nur an das, was wir in Rassenkunde gelernt haben, man kann die Andersartigkeit sogar messen. Außerdem haben die fast alle Geld wie Heu. Kommt euch das nicht auch komisch vor? Und wer weiß, was die hinter den Kulissen treiben, wenn keiner zusieht. Eine abnorme, über die ganze Welt verstreute Menschenrasse, die in Geld und Macht schwimmt – die können doch nichts Gutes im Schilde führen.«
»Ich bin schon mal in Giesl Schönfelds Zimmer gewesen und kann euch sagen, da sieht es nicht viel anders aus als im Zimmer meiner Schwester.«, verkündete Peter. »Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Klar, nirgendwo hing ein Kruzifix oder ein Bild der Jungfrau Maria an der Wand, aber die gibt's bei mir zu Hause auch nicht. In einer Nische in der Stube hat die Familie so eine Art Altar samt Menora und so was eingerichtet. Abgesehen davon aber keine Spur von abgenagten Knochen armer Christenkinder. Und an der Giesl ist mir auch alles ganz normal vorgekommen, wenn ihr versteht, was ich meine.«
Jan ließ diesen Einwand Peters nicht gelten. »Das bedeutet doch gar nichts. Überlegt doch, fast keiner von denen ist ein einfacher Arbeiter oder Handwerker. Kennt ihr auch nur einen einzigen, der in einer Fabrik arbeitet oder keine höhere Schule besucht hat? Die sind Händler, Bankiers, Juweliere und was weiß ich was noch, und leben wie die Maden im Speck.«
»Weiß jemand, was Augusts Vater für einen Beruf hat?«, wollte Christoph wissen.
Michel schickte sich an, darauf zu antworten, doch kam er nicht dazu.
»Völlig wurscht, was der ist, wird schon kein Straßenfeger sein.«, wischte Jan die Frage beiseite. »Ich sag's euch nochmal, denkt dran, was man uns in Rassekunde erzählt hat. Diese Vermessung des Schädels, die Unterschiede in der Physiognomie und all das ist doch wissenschaftlich fundiert, oder nicht? Und es beweist eindeutig, dass die Juden mit uns Deutschen überhaupt nicht das Geringste gemein haben, sondern ein fremdes, minderwertiges Volk sind.«
In diesem Moment kam die Bedienung mit den Bestellungen an den Tisch. Während sie die Getränke verteilte, sagte niemand ein Wort, Jan wirkte gar, als habe er für den Augenblick das Interesse an den weiblichen Reizen verloren. Er paffte nur an seiner Zigarette und wartete, bis sie wieder außer Hörweite war.
»Über den ganzen Erdball verstreut sind sie, ohne richtiges zu Hause, ohne Vaterland.«, fuhr er fort. »Ich sage, die haben hier nichts verloren. Je eher die sich vom Acker machen, desto besser für uns alle. Dass da auch mal Leute dabei sind, die wir kennen, ist eben Pech. Aber ob dieser August Schönfeld jetzt noch für ein weiteres Jahr auf seinem Platz in der ersten Reihe sitzt oder nicht, ist mir schnuppe.«
»Ohne Vaterland, sagst du? Und was ist mit denen, die im Krieg gekämpft haben?«, wandte Christoph ein. »Niemand riskiert sein Leben im furchtbarsten Krieg, den die Welt je gesehen hat, nur um den Schein zu wahren. Juden sind in den Schützengräben ebenso gestorben wie Deutsche, davon hat mir mein Vater erzählt.«
»Es ist ja nicht so, als ob sie eine Wahl gehabt hätten.«, tat Jan dieses Argument mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. »Es war schließlich Krieg und weigern konnten sie sich ja schlecht. Wahrscheinlich hat es dabei auch nur die armen Schlucker erwischt, der Großteil saß bestimmt warm und gemütlich zu Hause.«
»Das ist doch Quatsch! Was ist dann mit den Bibelforschern? Die hatten nach deiner Theorie auch keine Wahl und haben trotzdem geschlossen den Kriegsdienst verweigert. Sogar, wenn man sie dafür ins Gefängnis gesteckt hat.«
»Bibelforscher«, spottete Jan, »jetzt kommst du auch noch mit Bibelforschern um die Ecke. Wie viele kann es davon schon im ganzen Land geben? Vielleicht ein paar tausend? Das ist doch bloß eine kleine Minderheit von religiösen Fanatikern. Sind wohl auch nicht die hellsten Köpfe – so wie du, wenn dir nichts Besseres einfällt.«
Obwohl sie seit Kindertagen enge Freunde waren, gab es zwischen Christoph und Jan schon immer gewisse Gegensätze. In mancherlei Hinsicht verhielten sie sich sogar wie Konkurrenten, was sich vor allem im sportlichen Bereich immer wieder gezeigt hatte. Bevor sie im Laufe der Pubertät das Interesse daran verloren hatten, waren sie sich etwa bei Vereinsringkämpfen des Öfteren als erbitterte Gegner gegenübergestanden. Sobald sie die Matte verlassen hatten, war es zwar sofort mit der Rivalität vorbei gewesen, im Ring aber hatten sie sich nichts geschenkt. Wie in jeder Freundschaft gab es natürlich auch gelegentliche Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten außerhalb des sportlichen Wettbewerbs. Eine Besonderheit lag in solchen Fällen immer darin, dass die Missstimmung zwischen den beiden wesentlich länger anhielt und nicht zeitgleich mit dem Wettkampf endete. In Augenblicken wie diesen waren beide davon überzeugt, den anderen kein bisschen leiden zu können.
»Wir reden hier doch immer noch von August Schönfeld, oder?«, mischte sich nun erstmals Michel ein, um die Diskussion wieder zurück zum ursprünglichen Thema zu leiten. Der junge sprach ruhig und leise, aber fest und ohne zu stottern. »Mit August sind wir immerhin jahrelang in dieselbe Klasse gegangen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir manchmal bei ihm abgeschrieben haben.« Damit meinte er nicht sich selbst, er wusste aber, dass zumindest Peter schon so manche Gelegenheit zum Abschreiben von Hausarbeiten genutzt hatte. »Er war immer da, jeden Tag, und hat deswegen doch irgendwie zu uns gehört, finde ich. Sein Gesicht war mir jedenfalls so vertraut, als wäre er mein Bruder.«
»Nun übertreib mal nicht.«, warf Jan dazwischen und verdrehte die Augen.
Michel redete stur und flüssig weiter. Man hätte den Eindruck gewinnen können, als habe er das, was er sagte, in den vergangenen Minuten in Gedanken einstudiert. »Ich verstehe die Argumente von euch beiden, aber ich frage mich, was das alles mit August zu tun hat. Wir haben nie besonders viel mit ihm zu tun gehabt, das stimmt schon. Aber er war immer ein guter Schüler und uns ein anständiger Klassenkamerad. Verdient er es wirklich für etwas bestraft zu werden, das er sich nicht selbst ausgesucht hat? Ich jedenfalls kann mich nicht daran erinnern, gefragt worden zu sein, ob ich nun als Deutscher, Jude oder Afrikaner auf die Welt kommen möchte.«
Jan pfiff abschätzig durch die Zähne. Für ihn war das alles ausgemachter Blödsinn.
»Vielleicht ist es nur richtig, wenn man die eine Rasse einer anderen vorzieht.«, hielt Michel tapfer den einmal eingeschlagenen Kurs bei. »Vielleicht gibt es wirklich Rassen, die einer anderen überlegen sind. Jemand stellvertretend für seine Vorfahren zur Rechenschaft zu ziehen, halte ich jedenfalls für falsch. Denkt was ihr wollt, aber wenn ihr euch selbst die Frage stellt, ob es gerecht ist, was mit August passiert ist, dann kann es doch eigentlich nur eine Antwort geben.«
»Gut gebrüllt, Löwe.", sagte Peter, prostete Michel anerkennend mit dem Bierglas zu und genehmigte sich einen kräftigen Schluck.
Michel errötete. Der zierliche blonde Junge stammte aus bescheidenen Verhältnissen, war aber ein guter Schüler und galt als ausgesprochener Bücherwurm. Meistens hielt er sich mit seiner Meinung zurück, sprach allgemein nur wenig und meldete sich auch im Unterricht nie. In seiner Gegenwart neigten Menschen dazu zu vergessen, dass er überhaupt da war. Selbst Michels Freunde mussten manchmal daran erinnert werden, wie leicht man den zurückhaltenden Jungen unterschätzte.
»Hast du schon mal darüber nachgedacht, Anwalt zu werden?«, fragte Peter und wischte sich den Mund ab.
Jan verzog das Gesicht und nahm ebenfalls einen Schluck von seinem Bier. Allen Argumenten zum Trotz schien er nicht überzeugt, im Gegenteil sogar noch üblerer Laune zu sein als zuvor.
Christoph dachte über das Gesagte nach und beobachtete, wie der Schaum seines Bieres allmählich zusammenfiel. Auch seine Stimmung hatte sich verschlechtert, allerdings war das nicht Michels Schuld.
Peter suchte mit hungrigen Augen den Raum nach der Bedienung ab. Er befand sich als einziger noch immer in derselben Gemütsverfassung wie vor der Diskussion.
Vom Tisch der SA-Männer erhob sich indessen neuerlicher Lärm. Mit rotem Kopf, glasigen Augen und verschwitztem Gesicht stimmte einer von ihnen gerade die Parteihymne der NSDAP an. Lallend fielen seine Kameraden mit ein. Das Gegröle erreichte nach Sekunden eine derartige Lautstärke, dass sich für einen Moment die Aufmerksamkeit des gesamten Lokals auf die Uniformierten richtete. Einige der Gäste betrachteten das Schauspiel angewidert, viele schienen belustigt, manch einer sang sogar mit.
Peter stürzte den letzten Rest Bier hinunter, ließ den Krug auf den Tisch krachen und verkündete: »Kinder, ich muss los. Ich will den chronisch dünnen Geduldsfaden von meinem Alten nicht unnötig überstrapazieren. Wir sehen uns morgen in der Schule.« Er warf ein paar Groschen auf den Tisch, begutachtete im Gehen noch einmal die Bedienung und verschwand.
Jan, Christoph und Michel blieben schweigend zurück und beobachteten die mittlerweile schwer betrunkenen SA-Männer, von denen sich einer gerade schwerfällig erhob. Schwankend, mit gelösten Hosenträgern und heraushängendem Hemd stand er da und musste sich an einem Kameraden festhalten, um nicht die Balance zu verlieren. Zur Belustigung der grölenden Runde fummelte er mit der freien Hand an seinem Hosenlatz herum.
»Nee, Herrmann, behalte dein Kleinkaliber mal schön bei dir. Das Scheißhaus ist da hinten.«, sagte einer und begann brüllend über den eigenen Scherz zu lachen.
Unterdessen beobachtete der Wirt das Schauspiel vom Schanktresen aus. Ihm war anzusehen, wie die Beunruhigung in ihm wuchs. Nervös kaute er auf der Unterlippe herum und spielte mit dem Schnurrbart, offenbar wusste er nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Schließlich fasste er sich, ging zum Tisch der Männer, packte den halb entkleideten Kerl am Arm und führte ihn in Richtung der Toiletten, bevor ein Unglück geschehen konnte. Die anderen lachten nur, verlangten eine weitere Runde Bier und sangen weiter.
»Zum Kampfe steh’n wir alle schon bereit! Schon bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen ...«