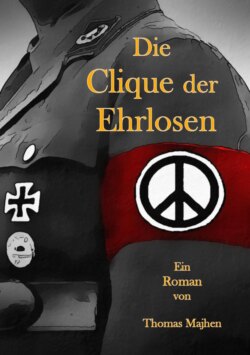Читать книгу Die Clique der Ehrlosen - Thomas Majhen - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2
Ende Januar 1938
Was Oberstleutnant Hans Oster soeben von seinem Freund und Vertrauten erfahren hatte, war überaus beunruhigend. Wenn die Information den Tatsachen entsprach, barg sie gefährlichen Zündstoff in sich, der in der Lage wäre, das Ansehen und die Stellung der Wehrmacht innerhalb des Reiches entscheidend zu schwächen. Daher wollte er keine Zeit verlieren und die Angelegenheit so schnell wie möglich mit seinem Vorgesetzten besprechen. So wie er den Admiral kannte, wusste dieser ohnehin schon längst von der Sache und konnte, so hoffte er jedenfalls, etwas Licht ins Dunkel bringen und vielleicht sogar einen Weg zur Lösung des Problems aufzeigen.
Gemeinsam mit Regierungsrat Hans Gisevius, jenem Freund, der ihn über die beunruhigenden Neuigkeiten unterrichtet hatte, schritt Oster durch die Flure des Oberkommandos des Heeres. Der verwinkelte Gebäudekomplex am Berliner Landwehrkanal hatte einst als Hauptquartier von Marine und Reichswehr des Deutschen Kaiserreiches gedient. Nach dem verlorenen Weltkrieg war die Flotte durch die Bedingungen des Versailler Vertrags allerdings derart zusammengeschrumpft, dass man die zahllosen Räume nicht mehr auszufüllen vermochte. Das Heer, das im Gegensatz zur Marine in den Jahren nach dem Krieg verborgen vor den Augen der Westmächte illegal wiederaufgebaut worden war, hatte den freigewordenen Platz gerne in Anspruch genommen. Am Tirpitzufer, wo sich der älteste Gebäudeteil des riesigen Komplexes befand, war auch die sogenannte »Abteilung Ausland/Abwehr«, der Auslandsgeheimdienst des Heeres, untergebracht. Seit 1935 war Oster Mitarbeiter dieser von Admiral Wilhelm Canaris geleiteten Einrichtung.
Zügig erreichten Oster und Gisevius das Vorzimmer zum Büro des Admirals und traten, ohne sich zuvor durch dessen Sekretärin anmelden zu lassen, nach einem hastigen, ungeduldigen Anklopfen umgehend ein.
An einem Schreibtisch saß eine kleine Gestalt tief über einen Haufen Papiere gebeugt. Obwohl der Mann erst Anfang fünfzig war, besaß er bereits schneeweißes Haar, das er gescheitelt und nach hinten zurückgekämmt trug. Das Auffälligste an ihm waren jedoch die großen Ohren mit den fingerdicken Läppchen, die breite Nase und die buschigen, ebenfalls makellos weißen Augenbrauen. Als die Gestalt die beiden Besucher bemerkte, hob sie leicht den ovalen Schädel und blickte ihnen mit seinen wasserblauen Augen fragend entgegen.
»Gisevius hat mir von den Vorwürfen gegen den Kriegsminister berichtet.«, begann Oster ohne Umschweife. »Ist es wahr?«
Admiral Wilhelm Canaris richtete sich auf und klappte den Aktenhefter, in dem er gerade gelesen hatte, zu. In seinen Augen lag Trübsal, seine Stimme klang leise und nicht sehr fest. »Es hat ganz den Anschein.« Er sah Oster an, dann wandte er sich an dessen Begleiter. »Ich nehme an, Sie haben die Akte ebenfalls gelesen?«
Der Angesprochene nickte und schob die Brille, die durch die Kopfbewegung etwas von ihrem Halt auf dem Nasenrücken verloren hatte, mit dem Zeigefinger zurecht. Als er sprach, reckte er das gespaltene Kinn nach vorn. »Schwarz auf weiß. Der Minister soll eine Annullierung der Ehe außerdem kategorisch abgelehnt haben.«
»Dann wird er nicht mehr zu halten sein.«, schlussfolgerte der Admiral nüchtern, lehnte sich zurück und verschränkte die dicken Finger ineinander.
Die Vorgänge, um die es ging, gestalteten sich folgendermaßen: Erst zwei Wochen zuvor hatte der verwitwete und unter Einsamkeit leidende Kriegsminister Werner von Blomberg seine deutlich jüngere Geliebte, eine Frau namens Margarethe Gruhn, geheiratet. Wie nun ans Licht gekommen war, konnte man ebenjene nicht gerade als ein Kind von Traurigkeit bezeichnen, war sie bei der Polizei doch bereits seit einiger Zeit aktenkundig – und zwar als in gewissen Kreisen äußerst gefragtes pornografisches Nacktmodell. Daneben kursierten Gerüchte, die besagten, dass die ehemalige Bardame des »Weißen Hirsches« in der Vergangenheit Dienstleistungen der besonderen Art angeboten und sich dadurch einen Nebenverdienst aufgebaut haben soll. Durch diese illegalen Aktivitäten war sie denn auch in den Fokus der Sittenpolizei geraten. Der liebeshungrige Blomberg, ein Stammkunde des fraglichen Lokals, war der attraktiven Blondine schnell verfallen und hatte sich schließlich, vermutlich unter dem Eindruck einer ungeplanten Schwangerschaft, zu einer Heirat nötigen lassen. Obwohl er nichts unversucht gelassen hatte, die alles andere als standesgemäße Ehe geheim zu halten, war die Wahrheit doch unweigerlich ans Licht gekommen. Der Kriegsminister und damit oberste Soldat der strengen preußischen Traditionen verpflichteten deutschen Wehrmacht hatte sich mit einer polizeibekannten Dirne verheiratet – das war ein Skandal erster Güte.
»Wie konnte der Mann nur annehmen, damit davonzukommen?«, wollte Oster kopfschüttelnd wissen. »Die Leute reden, das ist doch wohl klar. Und was könnte sich schneller herumsprechen als die Geschichte vom ‚Weißen Hirschen und der weißen Frau‘? In den entsprechenden Lokalitäten ist das sicher noch auf Wochen hinaus das Gesprächsthema Nummer eins.«
»Vollkommen unerheblich.«, wischte der Admiral das mit einer kraftlosen Handbewegung beiseite. »Der Schaden ist bereits angerichtet, die Wehrmacht in ihrem Ansehen irreparabel geschädigt. Dagegen lässt sich nichts mehr unternehmen. Fraglich bleibt, und das bereitet mir weitaus größere Sorgen, wie Hitler mit dieser Situation umgehen wird.«
Keiner der Anwesenden verschwendete auch nur einen einzigen sorgenvollen Gedanken an das weitere Schicksal des als eitel und weich geltenden, innerhalb des Offizierskorps überaus unbeliebten Kriegsministers. Denn Werner von Blomberg hatte nach dem sogenannten »Röhm-Putsch« von Ende Juni 1934 nicht nur die Ermordung der Generale Schleicher und Bredow in aller Öffentlichkeit gerechtfertigt. Er war zudem einer der Schöpfer der vielkritisierten Eidesformel der Wehrmacht, die nicht länger auf die Reichsverfassung sowie das Reich, sondern explizit auf die Person des Führers abgestellt war. Auch als SA und SS zunehmend als Konkurrenten zum Berufsheer aufgetreten waren und die Stellung der Wehrmacht als alleinige legitime Waffenträgerin in Frage zu stellen begannen, hatte der Minister die Provokationen stillschweigend hingenommen. Viele verachteten ihn daher längst als Hitlers zahmes Schoßhündchen, das nicht fähig oder willens war, die Interessen seines Standes mit der erforderlichen Vehemenz zu vertreten. Oster hegte keinen Zweifel daran, dass die Mehrzahl der Offiziere einen Rücktritt des Kriegsministers als keinen allzu großen Verlust empfinden würde. Was allerdings das ehr- und charakterlose Verhalten anging, das Blomberg jüngst an den Tag gelegt hatte, erschien ein allgemeiner Aufschrei der Empörung nur allzu gewiss.
»Vermutlich wird sich der Dicke bald Blombergs Posten einverleiben.«, sagte Oster höhnisch. Mit dem »Dicken«, ein hinter vorgehaltener Hand gängiger Spitzname, meinte er Hermann Göring. »Im Sammeln von Ämtern hat er ja bereits Übung. Ich schätze, das ist nicht der einzige Grund, warum er kaum noch in seine Anzüge passt.«
»Sicher wird es im Dunstkreis Hitlers noch weitere Bewerber geben.«, wandte Gisevius ein. »Möglicherweise erleben wir bald, wie sich seine edlen Paladine um das Amt des Kriegsministers wie Hunde um einen abgenagten Knochen balgen.«
Canaris hörte sich die wenig schmeichelhaften Ausführungen der beiden ruhig an, ohne zu widersprechen oder sie zurechtzuweisen. Auch er war kein Freund der obersten Führungsriege. Er legte die Finger an den Mund und dachte einen Moment lang nach. »Göring wäre mir von allen jedenfalls noch am liebsten.«, sagte er nach einer Weile. »Er hat seine Schwächen, keine Frage, aber ich halte ihn nicht für einen Fanatiker. Außerdem habe ich ihn als recht umgänglichen Menschen kennengelernt. Seinen Humor muss man natürlich mögen. Mit ihm als neuen Kriegsminister ließe sich vermutlich reden.«
Oster wie auch Gisevius schienen von dieser Einschätzung des Admirals nicht sonderlich überzeugt. Ihrer Meinung nach gab es weitaus geeignetere Kandidaten für diesen Posten, die zudem im Gegensatz zu Göring und manch anderem auf eine lange Soldatenkarriere zurückblicken konnten. Fast in der gesamten Führungsriege des NS-Staates fand sich kaum jemand, der ein Offizierspatent besaß und in wehrtechnischen Fragen kein ausgesprochener Laie war. Zwar hatte Göring im Weltkrieg als Flieger gedient und galt mit immerhin zweiundzwanzig Luftsiegen sogar als Ass, doch das war schon lange her. In militärischen Angelegenheiten sprach ihm längst niemand mehr die erforderlichen Kompetenzen zu.
Als wolle er einen hartnäckigen Kopfschmerz vertreiben, rieb sich der Admiral die Stirn. »Da ist leider noch etwas, das ich Ihnen mitteilen muss. Auch mit Fritsch soll irgendwas nicht stimmen.«
Oster und Gisevius wechselten erstaunte Blicke, richteten ihre Aufmerksamkeit dann wieder auf den Admiral.
Der Oberstleutnant fand als erster die Sprache wieder. »Was bitte meinen Sie damit? Was hat den Fritsch mit der Sache zu tun?«
Canaris hing nun, die Arme kraftlos auf den Lehnen, schlaff in seinem Stuhl. Fast war es, als wage er nicht, seinem Untergebenen in die Augen zu sehen. Seine Stimme klang leise und schüchtern wie die eines Klosterschülers. »Ich kenne keine Details. Mir sind lediglich Andeutungen zugetragen worden. Die allerdings nichts Gutes verheißen.«
»Was für Andeutungen?«, wollte Oster ungeduldig wissen. »Gerüchte?«
»Ich fürchte, es handelt sich um mehr als bloße Gerüchte. Wie es heißt, laufen auch gegen Fritsch derzeit Ermittlungen. Ganz gleich, welche Vorwürfe gegen ihn erhoben werden, eine polizeiliche Untersuchung könnte ihm ernsthaft schaden.«
Zuerst Blomberg, jetzt auch noch Fritsch. Die Vorgänge an der Spitze der Wehrmacht begannen allmählich bedrohliche Formen anzunehmen. Oster, der von den Enthüllungen, die den Kriegsminister betrafen, noch immer schockiert war, begann sich ernste Sorgen zu machen. Er kannte den Oberbefehlshaber des Heeres, General Werner von Fritsch, bereits seit Jahren. Persönlich schätzte er ihn als Menschen wie auch als Soldaten sehr und war von der Integrität des Mannes restlos überzeugt. So konnte er sich denn auch mit der größten Mühe oder unter Aufbietung seiner ganzen Fantasie nichts in der Welt vorstellen, das irgendwelche polizeilichen Ermittlungen gegen den General rechtfertigen könnte.
»Das ist absolut lächerlich. Sie kennen Fritsch doch genauso gut wie ich. Welche Vorwürfe auch immer gegen ihn vorgebracht werden, es muss sich um einen Irrtum handeln. Oder um Lügen und Verleumdungen.«
»Davon ist auszugehen.«, bestätigte der Admiral. »Aber bevor es uns nicht gelingt, Näheres in Erfahrung bringen, können wir nichts für ihn tun.« Sich an Gisevius wendend, fragte er: »Sie haben dahingehend nicht zufällig etwas aufgeschnappt und können uns sagen, was Fritsch vorgeworfen wird?«
Der Regierungsrat schüttelte den Kopf, wodurch er sich erneut veranlasst sah, die Brille wieder an ihren rechten Platz zu rücken.
Schon sehr früh hatte Hans Gisevius mit den Nationalsozialisten sympathisiert und sofort nach der Machtergreifung eine Zusammenarbeit mit ihnen angestrebt. Mehr noch: Er war am Aufbau der Geheimen Staatspolizei beteiligt gewesen und hatte kurzzeitig sogar selbst in deren Diensten gestanden. Dort hatte er sich allerdings nicht nur Freunde gemacht, zumal er sich bald skeptisch über den weiteren Ausbau des Polizeiapparats geäußert hatte. So war Gisevius schon nach wenigen Monaten wieder versetzt worden, später wechselte er ins preußische Landeskriminalamt. Zu dessen Leiter Arthur Nebe pflegte er seither eine enge Freundschaft, was ihm unbezahlbare Einblicke in die Vorgänge des wachsenden Polizeistaates gewährte. Heinrich Himmler persönlich soll Gisevius dann aber auf Betreiben Reinhard Heydrichs, dem Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes, der über dessen unkooperatives Verhalten noch immer erbost war, aus der Polizei entfernt haben. Mittlerweile arbeitete er zwar für die Regierung in Potsdam, seine Kontakte zur Polizei waren aber nie ganz abgerissen. Die Frage des Admirals, ob er bereits etwas von den Vorwürfen gegen den Oberbefehlshaber des Heeres gehört habe, war also durchaus berechtigt.
»Bislang ist mir noch nichts darüber zu Ohren gekommen.«, sagte der Regierungsrat. »Aber ich bin mir sicher, dass sich das in Bälde ändern wird. Wenn ich etwas erfahre, werde ich es Sie unverzüglich wissen lassen.«
Mit seiner Einschätzung, dass die Vorwürfe gegen Fritsch in Kürze bekannt würden, sollte Gisevius Recht behalten. Allerdings war nicht er es, der als erster von den Ereignissen um den General erfuhr.
***
Einen Tag später bat General Ludwig Beck, der Chef des ebenfalls im Oberkommando des Heeres – kurz OKH – ansässigen Generalstabs des Heeres, Oberstleutnant Oster und Konteradmiral Canaris zu sich. Beck war ein Soldat alter Schule, der die traditionellen Werte der Armee verkörperte wie kaum ein anderer. Obschon er das nationalsozialistische Regime niemals offen kritisierte, war er kein Nazi. Hans Osters regimekritische Einstellung war ihm bekannt, er hätte auch nur schwerlich nichts davon wissen können, denn der Oberstleutnant machte nur selten einen Hehl aus seinen Ansichten. Für den Geschmack einiger gebärdete der sich manchmal ein wenig zu offenherzig, Beck aber hielt es für eine Ehrensache, derartige Äußerungen vertraulich zu behandeln. Weil er sich zudem darüber im Klaren war, dass Oster von seinem Vorgesetzten beschützt und gefördert wurde – wie anders war es zu erklären, dass der Oberstleutnant im Haus praktisch Narrenfreiheit besaß? –, konnte er sich leicht ausmalen, wie Canaris den Nationalsozialisten gegenüberstand. Trotzdem misstraute Beck dem undurchsichtigen, selten direkt antwortenden Admiral, der mit jeder Geste, jedem Blick und jedem Wort die Aura des Geheimdienstlers um sich wob.
Oster wie auch Canaris kannten die Vorbehalte Becks gegen den Geheimdienstchef gut. Für sie galt der General als schwer einzuschätzende Persönlichkeit, die ihre Meinung meist für sich behielt und ganz grundsätzlich nicht besonders redselig war. Außerhalb rein dienstlicher Angelegenheiten hatten sie bis dahin noch nie etwas mit ihm zu tun gehabt, weshalb sie nicht wenig überrascht waren, als sie der General zu sprechen wünschte.
Das Büro des Generalstabschefs war geräumig und nicht vergleichbar mit den eher bescheidenen Räumlichkeiten, die von den Mitarbeitern der Abwehr genutzt wurden. Dominiert wurde der Raum von einem massiven Schreibtisch aus schwerem Eichenholz, der, obwohl er mit einer Vielzahl an Papieren, Dokumenten und Büchern beladen war, aufgeräumt und ordentlich wirkte. Direkt hinter dem Schreibtisch hing ein großes Gemälde an der Wand, auf dem Helmuth von Moltke zu sehen war, nicht dem ersten, aber doch unzweifelhaft berühmtesten Generalstabschef der preußisch-deutschen Geschichte, der seinem Nachfolger mit müdem Ausdruck bei der Arbeit zusah. Entlang der Wände reihten sich große Regale, die nicht nur mit allerhand Aktenheftern überfrachtet, sondern darüber hinaus auch mit zahlreichen Büchern vollgestopft waren.
Beck selbst war schlank, von mittelgroßer Statur und besaß schmale Schultern. Obwohl er nicht mit dem kräftigen Körper eines antiken Kriegers gesegnet war, bot er dennoch durch und durch die Erscheinung eines Soldaten. Die Vornehmheit seines Gesichts – nicht die Vornehmheit eines Aristokraten, sondern die eines Philosophen – wurde von seinen dünnen, an den Mundwinkeln abwärts geschwungenen Lippen noch unterstrichen und verliehen ihrem Besitzer einen stets mürrischen Ausdruck. Es erschien fraglich, ob diese Lippen auch zu einem Lächeln fähig waren, und tatsächlich hatten weder Oster noch Canaris jemals beobachtet, dass sie sich zur Vollführung dieses Kunststücks entgegen ihrer natürlichen Wuchsrichtung bewegt hätten. Seine braunen Augen wirkten durchdringend und streng, verrieten aber auch einen regen Geist und ließen eine gewisse Gutmütigkeit erahnen. An den breiten, dunklen Rändern war zu erkennen, dass ausreichender Schlaf ein Luxus war, den sich der Generalstabschef nur selten gönnte, sich stattdessen von früh morgens bis spät abends unermüdlich in allerlei Papierkram vertiefte. Seine Haare waren militärisch kurz geschnitten und seitlich gescheitelt; überwiegend beherrschten die Farben Grau und Weiß das Feld, nur hier und da leisteten braune Inseln erbitterten Widerstand. Auch der Haaransatz befand sich bereits auf dem geordneten Rückzug, würde sich aber voraussichtlich noch auf Jahre hinaus gegen die vorrückende Stirn behaupten.
Als Oster und Canaris eintraten, blickte der General noch nicht einmal auf. Gerade machte er sich an einem Schriftstück zu schaffen, sodass für eine Minute lediglich das Kratzen der Feder über das Stück Papier zu hören war. Endlich, als der Oberstleutnant schon ungeduldig mit den Füßen scharrte, legte der General den Federhalter beiseite, nahm die Brille ab, legte die Hände auf den Schreibtisch und richtete sich an die beiden Abwehrmänner.
»Ich vermute, Sie haben bereits gerüchteweise gehört, dass gegen General Fritsch gewisse Verdachtsmomente vorgetragen werden.«, erklang seine klare, kräftige Stimme. Der Ton, in dem Beck sich an sie richtete, war nicht unbedingt unfreundlich. Dennoch konnte kein Zweifel daran bestehen, dass hier jemand sprach, der es gewohnt war, Befehle zu erteilen. »Ich habe Sie heute zu mir gebeten, um Sie über den Stand der Dinge, jedenfalls insofern sie mir bekannt sind, in Kenntnis zu setzen.«
Oster und Canaris wagten es nicht, den General aus den Augen zu lassen. Sie hatten nicht damit gerechnet, ausgerechnet durch Beck zu erfahren, was gegen Oberbefehlshaber Fritsch vorlag. Gebannt warteten sie auf das, was nun folgen mochte.
Beck hatte nicht vor, sie lange auf die Folter zu spannen. »Am gestrigen Morgen ist General Fritsch in die Reichskanzlei gebeten worden. Dort hat man ihn im Beisein von Hitler, Göring und weiteren Personen einem Mann namens Otto Schmidt gegenübergestellt. Dieser Schmidt nun bezichtigte den Oberbefehlshaber des Heeres vor den Augen und Ohren der Anwesenden gewisser unsittlicher Handlungen.«
Als wäre die Angelegenheit damit bereits erledigt, nahm Beck die Hände vom Schreibtisch, legte sie in den Schoß und lehnte sich zurück. Er machte keinerlei Anstalten, das Gesagte weiter auszuführen, saß einfach nur ruhig da und studierte die Mienen der Abwehrmänner.
Hans Oster wusste nicht so recht, ob er verblüfft, entsetzt oder angewidert sein sollte. Um sich selbst darüber Klarheit zu verschaffen, oder vielleicht auch nur, um irgendetwas zu sagen, stellte er eine Frage. »Welcher Art sollen diese unsittlichen Handlungen gewesen sein?« Nachdem Beck das Wort »unsittlich« gebraucht hatte, hätte er sich diese Frage ohne Weiteres auch selbst beantworten können, aber innere Unruhe äußerte sich bei Oster oftmals auf hörbare Weise.
Beck seufzte. Sein Mund öffnete sich ein kleines Stück und schloss sich sofort wieder. Das geschah mehrmals, als wolle der General einen üblen Geschmack loswerden. »Muss ich das wirklich näher erläutern?«, fragte er, nicht sonderlich erfreut darüber, die Vorwürfe laut aussprechen zu müssen, etwas schroff. Eine Antwort gab er dennoch. »Fritsch wird vorgeworfen, homosexuelle Handlungen vollzogen zu haben.«
»Mit diesem Otto Schmidt?«, hakte Oster nach.
»Nein, das nicht.«, korrigierte Beck. »Schmidt will den General lediglich dabei beobachtet haben.«
»Dieser Schmidt ist also ein Augenzeuge?«, schlussfolgerte Canaris, dessen kühler, analytischer Verstand umgehend die Oberhand über das Erstaunen gewonnen hatte. »Gibt es noch weitere Zeugen?«
»Nicht, dass ich wüsste. Jedenfalls war er der einzige, den man gestern dem Oberbefehlshaber gegenübergestellt hat.«
»Was ist über Schmidt bekannt?«, wollte Canaris wissen.
»Sagen Sie es mir.«, erwiderte Beck. »Wenn ich mich nicht täusche, sind brisante Informationen und Geheimnisse Ihr Fachgebiet und nicht meines. Ich habe andere Dinge zu tun, als Erkundigungen über irgendwelche Zivilisten einzuholen.«
Der Admiral schien über das Gesagte nachzudenken. Leicht vornübergebeugt stand er mit den Händen in den Taschen reglos da. Sein Gesicht ließ keine Gefühlsregung erkennen, sein Blick war in sich gekehrt, die Lippen zuckten nicht einmal. Fast erweckte er den Eindruck, als meditiere er. Nachdem er in Gedanken seine Schlussfolgerungen gezogen hatte, sagte er: »Wenn ein angesehener General der Wehrmacht mit den Anschuldigungen einer bestenfalls als zwielichtig zu bezeichnenden Gestalt im Beisein fragwürdiger Zeugen konfrontiert wird, ohne ihn zuvor unter vier Augen anzuhören, wie es Ehre und Anstand gebieten, dann liefert schon allein das allerhand Grund zu Misstrauen. Daher liegt nach meiner Ansicht die Vermutung nahe, dass es sich bei den Vorwürfen gegen Fritsch nicht um tatsächliche Ereignisse, sondern um ein Komplott gegen seine Person handelt. Möglicherweise geht es dabei in letzter Konsequenz nicht einmal um ihn, sehr wahrscheinlich richtet sich dieser Vorstoß gegen die Wehrmacht.«
»Das ist auch mein Eindruck.«, pflichtete Beck bei. »Vielleicht versucht jemand den Trubel um Blomberg auszunutzen, um sowohl den Kriegsminister als auch den Oberbefehlshaber in einem Abwasch loszuwerden.«
»Es würde mich nicht überraschen, wenn einmal mehr der Dicke seine schmierigen Finger im Spiel hätte.«, meinte Oster. »Auch zu Himmler würde so eine Verleumdungskampagne passen. Wer weiß, am Ende haben die beiden das sogar zusammen ausgeheckt.«
»Denkbar.«, stimmte der General zu. »Von einer Schwächung der Wehrmacht würde die SS am meisten profitieren. Für ebenso gut möglich halte ich es aber, dass die Order für diese Intrige von noch weiter oben gekommen ist.«
Mit »noch weiter oben« konnte nur Hitler gemeint sein.
Oster wollte mehr darüber erfahren. »Wie kommen Sie zu dieser Annahme, wenn ich fragen darf? Ich kann mir nicht vorstellen, was ausgerechnet er davon hätte, wenn die Armee nach Blomberg gleich in den nächsten Skandal verwickelt wird.«
Der Blick des Generals verdüsterte sich. Seine braunen Augen schienen sich tiefer in ihre Höhlen zurückzuziehen. Es erweckte den Eindruck, als begebe sich der Generalstabschef an einen anderen Ort in weiter Ferne, als bliebe lediglich eine reglose Hülle auf dem Stuhl zurück. Sich räuspernd, kehrte er nach einer Weile in die Gegenwart zurück. »Ich muss mich entschuldigen. Tatsächlich gibt es nichts, das diese Mutmaßung rechtfertigte. Allerdings würde ich Göring als Drahtzieher ausschließen, groß angelegte Schmutzkampagnen sind nicht unbedingt seine Art. Als wahrscheinlichster Urheber, dem ich eine solche Inszenierung zutrauen würde, kommt meiner Einschätzung nach Himmler in Frage. Sie wissen so gut wie ich, wie ambitioniert der Reichsführer SS von Anfang an daran arbeitet, die Schutzstaffel zu einer bewaffneten Macht auszubauen – auch, wenn er natürlich stets das Gegenteil beteuert. Ihm dürfte wohl am meisten daran gelegen sein, das Heer nicht nur in der Öffentlichkeit bloßzustellen, sondern in letzter Konsequenz zu kastrieren. Dieses Ziel vor Augen, wäre es eine gerissene Herangehensweise, zunächst die Heeresführung zu kompromittieren, um sie sodann durch eigene, gefügigere Handlanger zu ersetzen.«
Obwohl Oster Göring als Schuldigen noch nicht gänzlich ausschließen wollte, musste er doch anerkennen, dass Becks Argumente überzeugend klangen. Auch Canaris stimmte dem zu.
Einen ganz ähnlich gearteten Fall hatte es zudem in der Vergangenheit schon einmal gegeben. Einen Fall mit blutigem Ausgang, der den wahren Charakter des NS-Staates erstmals offenbart hatte.
Damals, es war unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gewesen, war die Sturmabteilung, Hitlers Parteiarmee, in Rekordzeit zu enormer Größe herangewachsen. Die ehemalige Ordner- und Schlägertruppe hatte sich gerade bei jungen perspektivlosen Männern wachsender Beliebtheit erfreut und sich mit zuletzt 4,5 Millionen Mitgliedern zu einem ernstzunehmenden Machtfaktor gemausert. Ihr Chef Ernst Röhm hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die SA letztlich zu einer Art Revolutionsheer aufbauen wollte, das vorläufig neben der Reichswehr existieren, diese in letzter Konsequenz aber absorbieren und ersetzen sollte. Es war klar, dass nicht nur die Armee sich das nicht gefallen lassen konnte und Röhms Bestrebungen mit Misstrauen beobachtete. Auch Heinrich Himmler beanspruchte die Stellung, die bislang die SA innehatte, eifersüchtig für seine SS und wollte die unliebsame Konkurrenz um jeden Preis loswerden. Als das riesige Heer der Braunhemden bis Mitte 1934 den vorläufigen Höhepunkt seiner Macht erreichte, wollte man schließlich nicht länger warten und die wachsende Bedrohung ausschalten, bevor es zu spät wäre. Beginnend am 30.06.1934 wurden bis zum 02.07. reichsweit wenigstens einhundert Personen ermordet und über eintausend verhaftet. Bei nicht allen davon bestand auch tatsächlich eine Verbindung zur SA. Man wollte die sich darbietende Gelegenheit nutzen, um gleichzeitig auch andere politische Gegner loszuwerden. Neben vielen Kommunisten, Christ- und Sozialdemokraten sowie Gewerkschaftsführern fielen außerdem die Reichswehrgenerale Schleicher und Bredow den Säuberungen zum Opfer. Über den verbrecherischen Charakter geflissentlich hinwegsehend, verlieh man der Aktion durch die offizielle Bezeichnung als »Röhm-Putsch« einen selbstverteidigenden, rechtfertigenden Anstrich. Die Reichswehr beteiligte sich zwar nicht direkt an den Erschießungen und Verhaftungen, lieferte aber Waffen und Munition, stellte Lkws und andere Fahrzeuge bereit, schützte wichtige Einrichtungen und kümmerte sich um die Entwaffnung von SA-Einheiten. Durch ihre zwar nicht aktive, aber doch unterstützende Beteiligung, mochte sich die Armee der Illusion hingegeben haben, sich dadurch eines unliebsamen Nebenbuhlers entledigt zu haben. In Wahrheit aber hatte man lediglich der SS den Weg bereitet und sich damit nur einen neuen, noch rücksichtsloseren und gefährlicheren Gegner geschaffen.
Wie die jüngsten Ereignisse nahezulegen schienen, beabsichtigte Himmler nun das in die Tat umzusetzen, wozu Röhm seinerzeit nicht mehr gekommen war: die Enthauptung der Wehrmacht. Hans Oster konnte die am Horizont heraufziehende Bedrohung schon fast körperlich spüren. Falls es stimmte und Himmler seine Ziele in naher Zukunft erreichen, die Wehrmacht durch seine SS ersetzen sollte, würde das Reich unweigerlich einem Abgrund zusteuern, den er sich noch nicht einmal auszumalen wagte. Umso bedeutungsvoller war es, die Bestrebungen des Reichsführers schon im Ansatz mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Und augenblicklich mussten diese Mittel darin bestehen, den Oberbefehlshaber Werner von Fritsch von allen Vorwürfen zu entlasten.
Zu keiner Zeit hatte Hans Oster mit den Nationalsozialisten sympathisiert. Nicht einmal, als sich durch die allgemeine Aufrüstung und die Wiedereinführung der Wehrpflicht in der Armee ungeahnte Karrierechancen aufgetan hatten. Viele, vermutlich sogar die meisten gerade auch der höheren Offiziere, hatten das erneute militärische Erstarken Deutschlands freudig begrüßt. Wie hätte es auch anders sein können, lag es doch in der Natur der Sache, dass sich Soldaten von einer Politik angesprochen fühlten, die ihrem Berufsstand mehr Bedeutung, Ansehen und Macht versprach. Hans Oster jedoch empfand das rüpelhafte Auftreten und die primitive Polemik der Nationalsozialisten von Anfang an als abstoßend. Hierzu gesellte sich die Gängelung und Ausgrenzung der Juden sowie anderer Minderheiten, was er als würdelos, grausam und dazu völlig überflüssig ansah. Dies verbunden mit dem entbrannten Kampf gegen die Kirchen hatte ein Übriges getan, und so hatte er sich in den vergangen fünf Jahren vom Skeptiker zu einem entschiedenen Gegner des Regimes entwickelt.
Bei aller Gefahr lag in der Situation, wie sie sich derzeit darbot, aber vielleicht auch eine ungeahnte Chance. Ohne jeden Zweifel würde sich der Machtkampf zwischen Wehrmacht und SS schon sehr bald zuspitzen, Oster musste lediglich dafür Sorge tragen, dass die Armee als Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervorging. Zwar besaß er weder den Rang eines Generals noch bekleidete er eine herausgehobene Stellung, über großen Einfluss verfügte er außerdem auch nicht. Aber vielleicht gelang es ihm, die Wahrheit hinter der Intrige gegen Fritsch aufzudecken. Danach konnte er sich die allgemeine Empörung, die Himmler und seiner SS unzweifelhaft entgegenschlagen würde, zunutze machen, um nach Verbündeten Ausschau zu halten. Nach Verbündeten, die mächtiger waren als er. Für den Moment galt es herauszufinden, welche Position innerhalb dieser Gleichung der Generalstabschef Ludwig Beck einnahm.
»Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie uns von den Vorgängen berichtet haben. Das alles ist höchst beunruhigend.«, sagte er, sah den General fest an und achtete sorgsam darauf, nicht die kleinste Gefühlsregung zu übersehen. »Verfolgen Sie eine bestimmte Intention, indem Sie ausgerechnet dem Admiral und mir davon erzählen?«
General Beck, der immer noch an seinem Schreibtisch saß, hatte nicht vor, sich in die Karten schauen zu lassen. Ungerührt, beinahe unfreundlich gab er zur Antwort: »Ich war lediglich der Meinung, dass Sie beide davon erfahren sollten. Was Sie nun mit diesen Informationen anfangen wollen, bleibt Ihnen überlassen.« Damit setzte er seine Brille auf, nahm den Federhalter zur Hand und widmete seine Aufmerksamkeit wieder den vor ihm liegenden Papieren.
»Was für ein komischer Kauz.«, dachte Hans Oster und versuchte aus dem Generalstabschef schlau zu werden. Da der sie offenbar entlassen hatte, wandten sich Oberstleutnant Oster und Admiral Canaris ab und verließen das Büro.
***
Für Oster war die Angelegenheit damit aber noch längst nicht erledigt, im Gegenteil begann sein Verstand nun fieberhaft zu arbeiten. Auch wenn er ein Geheimnis daraus zu machen schien und sich mehr oder minder abweisend gebärdete, musste Beck doch fraglos seine Gründe dafür haben, weshalb er den Admiral und ihn ins Vertrauen gezogen hatte. Nach Hans Osters Vermutung konnte sich der General durchaus denken, wenn er nicht sogar fest damit rechnete, dass die Abwehrmänner in Anbetracht der Umstände nun die Initiative ergreifen und zu General Fritschs Rettung schreiten würden. Ob dies tatsächlich der Absicht Becks entsprach oder nicht, Oster war fest entschlossen genau das zu tun. Der erste Schritt in dieser Richtung konnte nur darin bestehen, den Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen.
Noch am selben Abend suchte er daher General Werner von Fritsch in dessen Berliner Wohnung auf. Dort fand Oster einen niedergeschlagenen, zutiefst gekränkten Mann vor, der kaum in der Lage schien, zu sprechen. Dass der Oberbefehlshaber des deutschen Heeres derart bloßgestellt und auf so schändliche und niederträchtige Art behandelt wurde, das konnte in der Welt, in der Fritsch bis dahin gelebt zu haben glaubte, eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Bevor er auch nur ansatzweise dazu fähig war, das erlebte aus eigener Sicht zu schildern, musste Oster ihn erst einmal durch gutes Zureden beruhigen. Auch danach ergab sich nur langsam und bruchstückhaft ein Bild der Ereignisse.
Einen gemeinen Strauchdieb habe man ihm vorgesetzt, einen Taugenichts, der in seinem Leben noch nie etwas Vernünftiges zuwege gebracht habe und seinen Unterhalt als Strichjunge und Erpresser bestritt, erzählte Fritsch. Hitler habe ihn mit mühsam im Zaum gehaltener Wut förmlich überfahren, und selbst als er sein Ehrenwort gab, diesem Otto Schmidt noch nie im Leben begegnet zu sein, habe der Führer dies mit einer verächtlichen Handbewegung beiseite gewischt. Man stelle sich vor: das Ehrenwort eines hochrangigen deutschen Generals in den Dreck getreten durch die Anschuldigungen eines Strichjungen! Göring sei daraufhin vor die Tür gestürzt und habe wie ein altes Waschweib lauthals verkündet, die Gerüchte seien allesamt wahr. Sodann habe Fritsch die Untersuchung der Angelegenheit vor einem Kriegsgericht verlangt, was Hitler jedoch abgelehnt habe. Stattdessen habe er dem General befohlen, sich unmittelbar in das Hauptquartier der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße zu begeben und sich dort einer Befragung zu unterziehen. Dem sei Fritsch gehorsam nachgekommen, schließlich habe er nichts zu verbergen und wolle diese Farce so schnell wie möglich aufklären. Die Befragung indes verlief anders als er gehofft habe, und zum gegebenen Zeitpunkt sei er noch nicht in der Verfassung, über die Details dieses schmählichen Verhörs – jawohl, wie einen gemeinen Verbrecher habe man ihn verhört! – zu sprechen. Weiterhin habe er auf Drängen Hitlers eingewilligt, bis zur Klärung der Angelegenheit von seinem Amt zurückzutreten und darüber hinaus in der Sache Stillschweigen zu bewahren.
Oster ließ vorsichtig durchklingen, dass er das Nachgeben des Generals für einen Fehler hielt. Dieser hätte nicht nur auf der Verhandlung vor einem Kriegsgericht beharren müssen, er hätte sich außerdem einer Befragung durch die Gestapo verweigern und seinen Rücktritt ablehnen sollen. Indem er den Forderungen des Diktators nachgekommen sei, habe er seine Karten ohne Not aus der Hand gegeben und befinde sich nun in einer geschwächten Position.
Fritsch wollte davon nichts hören. Es sei nun einmal der Führer gewesen, der solches von ihm verlangt habe, zudem habe man ihn vollkommen überrumpelt. In dieser Situation habe er keine andere Möglichkeit gesehen, als so zu handeln.
Obwohl er mit dessen Nachgiebigkeit unzufrieden war, verfiel der Oberstleutnant bald auf einen anderen Gedanken, wie sich Amt und Würde des Generals wiederherstellen ließen. Es sei noch nichts verloren, meinte er, Fritsch bleibe immer noch die Möglichkeit, sein Ansehen und Prestige innerhalb der Armee geltend zu machen. Er solle die Generalität versammeln und ihr ungeschönt von den Vorkommnissen berichten. Die Unterstützung des Offizierskorps sei Fritsch sodann gewiss, war doch immerhin für jedermann offensichtlich, welches Unrecht hier begangen wurde und wie würdelos man den General obendrein behandelt habe. Mehr noch, sollte Hitler weiterhin auf der Entlassung des Oberbefehlshabers beharren, solle Fritsch die Generäle zu einem geschlossenen Aufstand gegen die Willkür des Diktators führen.
Mit dieser letzten Aufforderung allerdings war der Abwehroffizier entschieden zu weit gegangen.
Fritsch zeigte sich empört und verbat sich daraufhin nicht nur jedwede Aufforderung zum Ungehorsam, er untersagte Oster außerdem, auf welche Weise auch immer zu seinen Gunsten tätig zu werden. Der Oberstleutnant wisse offenbar nicht, so scheine es jedenfalls Fritsch, auf welch gefährliches Terrain er sich da begebe. Die Folgen einer Mobilisierung der Generalität seien unvorhersehbar, ein solches Vorgehen würde mit einiger Wahrscheinlichkeit nur zu einer Spaltung des Offizierskorps führen. Damit riskiere er im äußersten Fall sogar den Ausbruch eines Bürgerkrieges! All das auch noch aus persönlichen Gründen? Nein, so etwas sei unentschuldbar und komme keinesfalls in Frage. Danach wollte der kaltgestellte Noch-Oberbefehlshaber nichts weiter davon hören.
Oster, der etwas zu hoch gepokert hatte, blieb nichts anderes übrig, als Fritsch genauso elend zurückzulassen, wie er ihn vorgefunden hatte. Zwar hatte er Verständnis für die Einwände des Generals, hielt dessen Zurückhaltung und übertriebenes Ehrgefühl aber für kontraproduktiv, seine Angst vor einem möglichen Bürgerkrieg für übertrieben. Gefangen in seiner Kränkung war der Mann offenbar unfähig zu begreifen, dass es um weit mehr ging als nur seine Person. Aber es war zwecklos, wie Oster einsehen musste. Er kannte den General gut genug, um sich darüber im Klaren zu sein, wie sinnlos es zumindest im Augenblick wäre, weiter in diesen zu dringen. Genaugenommen gab es außerdem nichts, das ihn an Fritschs Aufforderung, keinerlei Versuche zu dessen Entlastung zu unternehmen, binden konnte. Weder hatte er sein Ehrenwort gegeben noch konnte der General ihm dies befehlen. Für Oster war es daher ein Leichtes, die ihm mündlich auferlegten Restriktionen zu ignorieren und sein weiteres Vorgehen zu planen.
***
Die folgenden Tage verwand der Oberstleutnant darauf, sich mit Admiral Canaris und Hans Gisevius zu beraten. Zu dieser Runde gesellte sich noch Carl Goerdeler hinzu, der ehemalige Bürgermeister von Leipzig, zu dem Oster seit einiger Zeit lose Beziehungen unterhielt und von dem er wusste, dass er ganz ähnliche Auffassungen vertrat wie er selbst. Bezüglich Fritsch waren Canaris, Gisevius und Goerdeler der gleichen Ansicht wie Oster: Es handelte sich um einen Angriff der SS auf die gesamte Wehrmacht, der unbedingt noch im Keim erstickt werden musste. Um das zu gewährleisten, kam man darin überein, alles daran zu setzen, nicht nur Fritsch als Oberbefehlshaber des Heeres zu rehabilitieren und in Amt und Würde zu halten. Es schien weiterhin unumgänglich, den ranghöchsten Offizieren des Heeres unmissverständlich vor Augen zu führen, welche Bedrohung von gewissen Kreisen innerhalb der nationalsozialistischen Partei ausging – nicht nur für die Armee, sondern für das gesamte Reich.
Dieser letzte Punkt brachte allerdings gewisse Probleme mit sich. Denn selbst wenn man sich innerhalb des Offizierskorps ausschließlich auf die Generalsränge konzentrieren wollte, wäre die Zahl der Einzelgespräche, die zu führen wären, noch immer viel zu groß. Auf diese Weise erschien es unmöglich, die Aufgabe zeitnah und noch bevor Schlimmeres geschehen konnte zu einem Abschluss zu bringen. Es galt daher, eine Vorauswahl zu treffen und zunächst nur eine Handvoll an Generälen ins Gespräch zu ziehen. Solche, die lediglich administrative Aufgaben versahen, wurden als erste aussortiert. In Frage kamen sodann nicht nur Generäle, die die höchsten Positionen bekleideten, sondern vor allem jene, die auch tatsächlich Truppen befehligten. Über die mit Abstand größten Truppenverbände gebot dabei vor allem eine Sorte Befehlshaber: die Kommandeure der sogenannten Wehrkreise.
Das gesamte Reichsgebiet war in dreizehn dieser Wehrkreise eingeteilt. Im Mobilmachungsfall, also sobald der Ausbruch eines Krieges unmittelbar bevorstand, würde aus jedem Wehrkreis ein entsprechendes Armeekorps – ein großer Heeresverband bestehend aus mehreren zehntausend Mann – gebildet. Da man unmöglich alle dreizehn Wehrkreiskommandeure aufsuchen konnte und auch gar nicht damit zu rechnen war, dass man bei jedem einzelnen davon auf offene Ohren stoßen würde, beschloss man, sich auf einige wenige zu beschränken. Manch einer war bekannt dafür, ein überzeugter Nationalsozialist zu sein, bei anderen versprach man sich aus verschiedenen Gründen keine Aussicht auf Erfolg. Dennoch, sollte es gelingen, auch nur vier oder fünf dieser Befehlshaber zu einer entschiedenen Stellungnahme gegen die schändliche Behandlung von Oberbefehlshaber Fritsch zu bewegen, so hoffte man damit eine Welle loszutreten. Im günstigsten Fall würde die Generalität sodann geschlossen vor Hitler treten, die Wiedereinsetzung von Fritsch verlangen und die Ermittlung der Drahtzieher hinter dieser Intrige fordern.
Hans Osters Überlegungen gingen sogar noch weiter. Sobald der Zeitpunkt dafür reif schien, wollte er die Armee dazu bewegen, die Gestapozentrale in Berlin zu besetzen und Himmler und seine Schergen zu verhaften. Im Reichssicherheitshauptamt sollten danach Beweise sichergestellt und veröffentlich werden, die belegten, dass SS und Gestapo hinter den Machenschaften gegen das Heer steckten. Letztlich sollte Hitler dadurch zu einem Vorgehen gegen die verantwortlichen Institutionen gezwungen werden, was einer Entmachtung des gesamten SS-Apparates gleichkäme. Diese Idee, die manchem sicherlich zu radikal erschienen wäre, behielt Hans Oster vorerst für sich. Zunächst einmal galt es die Generäle von den Vorgängen in Berlin zu unterrichten und zu mobilisieren.
Wenige Tage nach dem Treffen wurde Goerdeler in den Wehrkreis IV nach Dresden zu General List entsandt, Gisevius in den Wehrkreis VI nach Münster zu General Kluge, während Oster den Wehrkreis XI in Hannover unter General Ulex übernahm. Zeitgleich kümmerte sich Admiral Canaris um General Walther von Brauchitsch, der als potenzieller Nachfolger von Fritsch gehandelt wurde. Des Weiteren gelang es, den Reichsbankpräsidenten und ehemaligen Wirtschaftsminister Hjalmar Schacht als Verbündeten zu gewinnen, der sich bereit erklärte, sein Glück bei General Gerd von Rundstedt sowie Admiral Raeder zu versuchen.
Jeder, der bei dieser Gelegenheit von den Vorgängen um Blomberg und Fritsch erfuhr, zeigte sich gleichermaßen schockiert wie empört. Einigkeit herrschte insoweit, als dass man die schlechte Behandlung von Oberbefehlshaber Fritsch verurteilte und die SS hinter der Intrige vermutete. Als es jedoch darum ging, etwas zu unternehmen, dem Regime zu demonstrieren, dass man es nicht duldete, wenn ihresgleichen derart übel mitgespielt wurde, brach die oft lauthals verkündete Empörung unter einer Flut an Einwänden und Bedenken zusammen. So lehnte etwa General Rundstedt einen Protest rundheraus ab, während sich General Kluge erst einmal über seine »eigene Position im Klaren werden wollte «, wie er sich ausdrückte.
Allen Bemühungen und Hoffnungen zum Trotz kehrten die Emissäre enttäuscht, ja ernüchtert nach Berlin zurück. Ihre Mission war gescheitert, ein kollektives Aufbegehren der Generäle mehr als nur unwahrscheinlich. Hans Oster musste einsehen: Er hatte die Lage verkannt und die Unentschlossenheit, Trägheit oder Furcht der Offiziere unterschätzt.
***
Etwa zur gleichen Zeit suchte der Oberquartiermeister II, Generalleutnant Franz Halder, der in dieser Funktion zugleich Becks Stellvertreter als Generalstabschef des Heeres war, Beck in dessen Büro im OKH auf. Halder, ein eher introvertierter und zugleich unbeweglicher Charakter, trat weniger aus eigenem Antrieb an seinen Vorgesetzten heran, vielmehr hatten ihn die jüngeren und im Rang unter ihm stehenden Offiziere des Generalstabs gebeten, einmal beim Chef vorzufühlen. Am Tirpitzufer kursierten nämlich längst Gerüchte in Bezug auf den abgesägten Oberbefehlshaber Fritsch, doch wusste niemand etwas Genaues. Denn Beck, der sich an sein Wort sowohl gegenüber Fritsch wie auch gegenüber Hitler, die Angelegenheit diskret zu behandeln und zu niemandem ein Wort zu sagen, gebunden fühlte, hatte es bislang tunlichst vermieden, auch nur Andeutungen in irgendeiner Richtung zu verlautbaren.
Der Bayer Halder und der Hesse Beck schätzten wohl das fachliche Können des jeweils anderen, von gegenseitiger Sympathie aber konnte keine Rede sein; zu unterschiedlich waren die Charaktere, zu verschieden die Auffassungen, Überzeugungen und Ansichten der beiden. Fraglos spielt immer auch eine unterbewusste Komponente, die einen Menschen im Unklaren darüber lässt, warum er einen anderen nicht riechen kann, eine gewisse Rolle. Halder nun konnte seinen Chef aus so manchen Gründen nicht recht riechen, trat diesem dementsprechend steif gegenüber.
Weder groß noch klein, kompakt gebaut, bebrillt und mit dem für ihn typischen Bürstenhaarschnitt, stand der nur vier Jahre Jüngere da und suchte nach einem Anfang. »Die Generalstabskameraden und ich bitten Herrn General um Orientierung und Anweisung, was die Gerüchte um den OB anbelangt. Es herrscht große Unsicherheit darüber, welche Stellung der Generalstab diesbezüglich einnimmt.«, trug er hölzern, mit dezent bayerischem Akzent sein Anliegen vor.
Beck sah den weißhaarigen Oberquartiermeister II unverwandt an. »Darum haben sich die Kameraden nicht weiter zu kümmern.«, gab er knapp zur Antwort und glaubte wohl, damit sei die Sache bereits vom Tisch.
Halder stand einen Augenblick ungerührt, überlegte wohl, wie er es besser mache könne. Dann setzte er erneut an. »Mit Verlaub, Herr General, die Anschuldigungen gegen OB Fritsch betreffen uns alle. Was soll ich den Männern sagen, wenn sie mich erneut darauf ansprechen?«
»Sagen Sie ihnen meinetwegen, dass eine Untersuchung bereits läuft und sie die Details nicht zu interessieren brauchen.«, erwiderte Beck nicht sehr geduldig.
Der Bayer machte einen Schritt nach vorn. Ihm war anzusehen, dass etwas in ihm brodelte und sich nur schwer im Zaum halten ließ. Seine Stimme nahm einen künstlichen, gezwungenen Klang an – noch künstlicher und noch gezwungener als üblich –, sein Körper versteifte sich derart, als bestünden seine Gelenke aus Metallscharnieren, die man vergessen hatte zu ölen. »Ich kann diese Art der Geheimnistuerei nicht gutheißen. Sie können nicht ernsthaft annehmen, dem OB damit einen Gefallen zu tun.« Das klang ungehalten.
Der Hesse Beck drohte nun ebenfalls ungehalten zu werden. Verärgert darüber, dass man ihn derart bedrängte, antwortete er: »Was Herr Generalleutnant gutheißen und was nicht, das ist mir ganz gleich.«
Halders leicht hängende Wangen begannen zu beben. Auch der von einem nicht sehr kräftigen Oberlippenbart gekrönte Mund zitterte leicht. Schon stand zu befürchten, ihm könne der bügellose Zwicker von der Nase fallen, so sehr zitterte und bebte er.
Schließlich, als Beck seinen Stellvertreter in derart erdbebenhafte Unruhe versetzt vor sich stehen sah, besann er sich und führte etwas ruhiger aus: »Verstehen Sie denn nicht, dass ich mein Wort gegeben habe? Über die Angelegenheit soll nicht eher gesprochen werden, als sie zu einem Abschluss gekommen ist. Die Untersuchungen werden die Wahrheit ans Licht bringen und ich bin mir sicher, in Kürze wird sich alles aufklären und in Wohlgefallen auflösen.«
Nun sah der Oberquartiermeister II keinen Grund mehr vorzugeben, er wisse rein gar nichts über den Fall. In einem seltenen Anflug von Kühnheit trug er seine Forderung vor. »Jetzt, da sowohl Fritsch als auch Blomberg abgesetzt sind, sind Herr General gegenwärtig der oberste militärische Führer des Reiches. Als solcher sind Sie dazu berufen, die Konsequenzen zu ziehen und sich an die Spitze der Wehrmacht zu stellen. Allein Ihr Name und Ihr Ruf reichen aus, um die Generalität zu einer geschlossenen Front zusammenzuschweißen. Ich fordere Sie daher auf, das Heft in die Hand zu nehmen und umgehend zu handeln!«
Mit einer solchen Aufforderung hatte der Generalstabschef nicht gerechnet, von den Worten Halders zeigte er sich zutiefst erschüttert. Beck konnte kaum glauben, was er soeben gehört hatte, war er doch offen dazu aufgefordert worden, den Aufstand zu proben. Gewiss hegte auch er den einen oder anderen Vorbehalt gegen das Regime. Nicht nur die Affäre um Fritsch führte ihm einmal mehr vor Augen, mit welchem Menschenschlag man es bei den Nationalsozialisten zu tun hatte. Auch bekümmerte ihn nicht nur der nunmehr offen zu Tage tretende Versuch, die Wehrmacht ihres angestammten Platzes innerhalb des Staates zu berauben und über kurz oder lang durch eine bewaffnete SS zu ersetzen. Als gläubiger Christ empfand er es als beschämend, wie jüdische Mitbürger herabgesetzt und gegängelt wurden und wie die Regierung seit ihrem Machtantritt fortwährend versuchte, den Einfluss der Kirchen zurückzudrängen. Für ihn waren Christentum und preußische Traditionen die maßgebenden Ideen, denen er sich als Offizier verpflichtet fühlte und nach denen er sein Leben stets zu führen suchte. Doch gerade diese Werte, die von den Nazis mit Füßen getreten wurden, verhinderten gleichzeitig, dass für Beck an eine Auflehnung auch nur zu denken war. Gegen das gewählte und somit legitime Staatsoberhaupt vorzugehen, war für ihn ein unvorstellbarer Gedanke. Gut möglich, dass dabei auch noch ein entferntes Echo der vergangenen Vorstellung eines Herrschertums von Gottes Gnaden mitschwang.
Wütend, dass man solches von ihm verlangte, antworte er, ja beinahe schrie er es hinaus: »Das, was Sie von mir fordern, ist Revolution und Meuterei. Diese Worte gibt es nicht im Lexikon eines deutschen Offiziers!«
Halder, dem mittlerweile vielleicht dämmerte, dass er einen Schritt zu weit gegangen war, sah sich in der Klemme. Stolz und Sturheit machten es ihm unmöglich, sich zu überwinden und zurück zu rudern. »Herr General, was im Lexikon des deutschen Offiziers steht, weiß ich genauestens aus der dreihundertjährigen soldatischen Tradition meiner Familie. Guten Morgen.«, schleuderte er stattdessen Becks entgegen und wollte sich schon zum Gehen wenden.
Bevor sein Stellvertreter den Raum verlassen konnte, wagte Beck noch einen letzten Versuch, seinen Standpunkt zu verdeutlichen und seine abweisende Haltung zu rechtfertigen. »Begreifen Sie doch, es handelt sich dabei um ein schwebendes Verfahren, und in ein solches kann ein Offizier unmöglich eingreifen. Gerade Sie müssen das doch verstehen.«
Aber die Fronten waren bereits verhärtet.
Für Halder waren Becks Argumente nichts weiter als Ausflüchte. Seiner Ansicht nach versteckte sich der Generalstabschef hinter einer Fassade aus Pflicht- und Ehrgefühl. Verbittert nahm er die Klinke in die Hand und verabschiedete sich mit den Worten: »Wie Herr General meinen.«
Beck, der nicht begriff, wie ein langgedienter Offizier ein solches Unverständnis an den Tag legen konnte, schleuderte wütend noch zwei letzte Sätze in Richtung Tür. »Hiermit verbiete ich Ihnen wie auch allen anderen Angehörigen des Generalstabes noch einmal über die Angelegenheit zu sprechen. Hören Sie, ich verbiete es!«
Auch wenn er mit seinem Schweigen bei vielen auf Unverständnis stieß, so war Ludwig Beck doch auch nach dieser unangenehmen Begegnung mit Halder weiterhin unerschütterlich davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Eine andere Vorgehensweise ließen Ehre und Anstand nach seinem Verständnis einfach nicht zu.