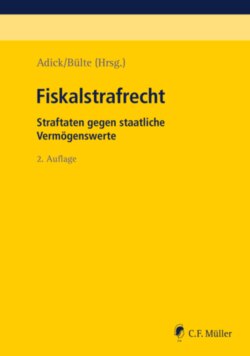Читать книгу Fiskalstrafrecht - Udo Wackernagel, Axel Nordemann, Jurgen Brauer - Страница 212
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6. Kapitel Europarechtliche Verfahrensvorschriften › A. Einleitung
A. Einleitung
1
Zumindest bislang existiert kein europäisches Strafverfahrensrecht und auch keine umfassende Kompetenz der EU, strafprozessuale Vorschriften zu erlassen. Gleichwohl hat das Unionsrecht bereits jetzt wesentlichen Einfluss auf das Prozessrecht der Mitgliedstaaten. Hinzu kommt, dass europäische Vorgaben dabei neben Vorschriften aufgrund anderer multilateraler sowie bilateraler Übereinkommen stehen. Die nachfolgende Betrachtung lässt sich nur schwer auf rein europarechtliche Vorschriften beschränken, da zahlreiche Normen zwar auf unionsrechtlichen Vorgaben basieren, durch ihre Umsetzung aber inzwischen Teil des deutschen Rechts geworden sind.
2
Ansätze einer europäischen Kooperation in Strafsachen finden sich bereits sehr früh, wobei diese zunächst ausschließlich zwischen den Mitgliedstaaten und damit außerhalb des institutionellen Rahmens der EG stattfand. Die Mitgliedstaaten bedienten sich klassischer Mittel der internationalen Zusammenarbeit (Konventionen, Resolutionen etc.). Die Entwicklung einer „Sicherheitsunion“ wurde etwa durch das Schengener Übereinkommen vom 14.6.1985 (SÜ), welches die allmähliche Beseitigung der innergemeinschaftlichen Grenzkontrollen vorsah und mit dem Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) implementiert wurde, wesentlich vorangetrieben. Zahlreiche ausgleichende Maßnahmen (compensatory measures) sollten sicherstellen, dass während dieses „Experiments“ ein hoher Sicherheitsstandard aufrechterhalten werden konnte. Dazu gehört eine verstärkte sowohl polizeiliche als auch justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Eben diese wurde im Vertrag von Maastricht als dritter Pfeiler festgelegt und – mit Ausnahme von „Schengen“ – unter einem einheitlichen europäischen Rahmen zusammengefasst. Die spätere Modifizierung durch die Verträge von Amsterdam und Nizza, der spätere Verzicht auf das Säulenmodell und die Vergemeinschaftung der strafrechtlichen Zusammenarbeit durch den Vertrag von Lissabon sowie mehrere Programme sollten der weiteren Ausgestaltung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Titel V AEUV) dienen.
3
Eine weitere Integration auf diesem Gebiet wird dadurch erschwert, dass strafrechtliche Vorschriften aus Sicht der Mitgliedstaaten zum Kernbereich der staatlichen Souveränität gehören. Weil ein europäisches Strafrecht aber als integraler Bestandteil des angestrebten Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts angesehen werden kann, soll die künftige justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen auf dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung (Art. 82 Abs. 1 AEUV) aufbauen.[1] Dieser aus dem Bereich des Binnenmarktes übernommene Grundsatz besagt, dass eine in einem Mitgliedstaat rechtmäßig ergangene justizielle Entscheidung in jedem anderen Mitgliedstaat als solche anerkannt werden muss, und soll das bisher gültige Rechtshilferecht, welches auf der Souveränität der einzelnen Staaten basiert, nach und nach ersetzen.[2] Ziel ist es, die justizielle Zusammenarbeit zu vereinfachen und zu beschleunigen, u.a. durch den Abbau von Versagungsgründen, die Einführung standardisierter Formulare sowie einheitlicher Fristen.
4
Im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit ermöglichen Art. 67 Abs. 3, 82 Abs. 1 UAbs. 1 AEUV zudem eine Mindestharmonisierung des nationalen Strafverfahrensrechts. Soweit es zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung erforderlich ist, können im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften festgelegt werden. Solche Rechtsangleichungen müssen unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten stattfinden (Art. 82 Abs. 2 UAbs. 1 S. 2 AEUV) und sind daher nur punktuell in einzelnen Bereichen des Strafprozessrechts möglich.[3] Zum Schutz der grundlegenden Aspekte der nationalen Strafrechtsordnungen ist eine prozessuale „Notbremse“ vorgesehen. Der Katalog (Art. 82 Abs. 2 UAbs. 1 AEUV) sieht eine Harmonisierung zunächst für die Zulässigkeit von Beweismitteln, die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren und die Rechte der Opfer von Straftaten vor. Über die abschließende Generalklausel kann die Angleichung theoretisch auf alle Normen des nationalen Strafverfahrensrechts ausgedehnt werden.
5
Für den Bereich der Fiskaldelikte sind die europäischen Verfahrensvorschriften schon deshalb relevant, weil die gemeinschaftlichen Instrumente hierfür häufig Sonderregeln vorsehen. Zudem verfolgt die EU ausdrücklich das Ziel, dass kriminelle Handlungen zum Nachteil ihrer finanziellen Interessen ebenso effizient verfolgt und vergleichbar hart bestraft werden wie solche zum Nachteil der finanziellen Interessen des jeweiligen Mitgliedstaates.[4] Mit Hilfe der sog. PIF Richtlinie sollen gegen die finanziellen Interessen der EU gerichtete Betrugsdelikte und ähnliche rechtswidrige Handlungen verfolgt werden können (vgl. dazu unten unter Rn. 133 f.). Die „finanziellen Interessen der Union“ lassen sich zusammenfassend umschreiben als alle Einnahmen und Ausgaben, die im Haushaltsplan der Union und in den Haushaltsplänen der nach den Verträgen geschaffenen Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen oder in den von diesen verwalteten und überwachten Haushaltsplänen erfasst werden. Zur Verfolgung derartiger Delikte soll zeitnah eine Europäische Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehen (vgl. hierzu unten unter Rn. 137 ff.).