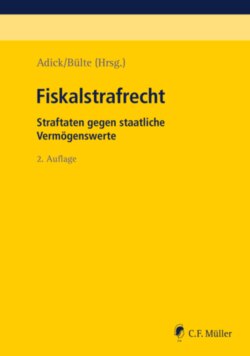Читать книгу Fiskalstrafrecht - Udo Wackernagel, Axel Nordemann, Jurgen Brauer - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Kapitel Europäisierung des Strafrechts › V. Begrenzung nationalen Strafrechts durch europäische Freiheitsrechte und Grundfreiheiten in der Rechtsprechung des EuGH › 1. Entwicklung von den europäischen Grundfreiheiten zu den europäischen Freiheitsrechten
1. Entwicklung von den europäischen Grundfreiheiten zu den europäischen Freiheitsrechten
42
Die europäische Rechtsprechung hat zunächst als europäische Verkehrsfreiheiten konzipierte Rechte wie das Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen (Art. 34 AEUV), das allgemeine Diskriminierungsverbot (Art. 18 ff. AEUV), die Freizügigkeit (Art. 21 AEUV), die aktive und passive Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 ff. AEUV), die Kapital- und Warenverkehrsfreiheit (Art. 63 ff. AEUV) oder auch die Steuerneutralität,[1] im Laufe der Jahre zu Freiheitsrechten und schließlich zu echten Grundrechten vor und neben der europäischen Grundrechtecharta entwickelt.[2] So wurde etwa das Verbot von Einfuhrbeschränkungen i.V.m. dem Diskriminierungsverbot zu einem allgemeinen Beschränkungsverbot ausgebaut.[3] Der Gleichheitsgrundsatz und der Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit sind ebenfalls Elemente dieser Grundfreiheiten geworden und haben zu einem grundsätzlichen Verbot von Beschränkungen des Wirtschaftsverkehrs geführt, das weitreichende Auswirkungen haben kann.
43
Beschränkungen des Wettbewerbs innerhalb von Europa und der Grundfreiheiten sind zwar immer noch möglich, sie müssen jedoch begründet sein und dürfen keine diskriminierende Anwendung von nationalem Recht bedeuten.[4] Die beschränkende Regelung muss sich zur Erreichung des durch den Normgeber gesetzten und zudem unionsrechtlich anerkannten Ziels eignen, durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein und das mildeste Mittel darstellen, um das Ziel effektiv zu erreichen. Es gilt also der unionsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.[5]
44
Unter Berufung auf diese Freiheitsrechte hat der EuGH in der Rechtssache Keck entschieden, dass nicht nur jede mengenmäßige Beschränkung des Handelns innerhalb der Union durch mitgliedstaatliches Recht verboten ist, sondern auch jede Maßnahme, die wie eine mengenmäßige Beschränkung wirkt. Das Verbot gilt damit für alle Maßnahmen, die geeignet sind,
den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern. Unter diese Definition fallen Hemmnisse für den freien Warenverkehr, die sich in Ermangelung einer Harmonisierung der Rechtsvorschriften daraus ergeben, daß Waren aus anderen Mitgliedstaaten, die dort rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind, bestimmten Vorschriften entsprechen müssen (…), selbst dann, wenn diese Vorschriften unterschiedslos für alle Erzeugnisse gelten, sofern sich die Anwendung dieser Vorschriften nicht durch einen Zweck rechtfertigen lässt, der im Allgemeininteresse liegt und den Erfordernissen des freien Warenverkehrs vorgeht. [6]
In der Rechtssache Morellato[7] hat der EuGH dementsprechend die Verhängung eines Bußgeldes wegen Inverkehrbringens eines in Frankreich rechtmäßig hergestellten Brotes in Italien für unzulässig erklärt: Eine solche Sanktion stelle sich als grundsätzlich unzulässige, weil einer mengenmäßigen Beschränkung ähnliche Maßnahme dar.