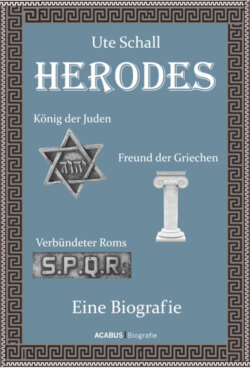Читать книгу Herodes. König der Juden - Freund der Griechen - Verbündeter Roms - Ute Schall - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Beginn einer Karriere
ОглавлениеDrehen wir das Rad der Geschichte für einen Augenblick eine Generation zurück! In Rom ist Octavian Augustus, der als erster Kaiser der Römer einmal die pax Romana begründen wird, noch nicht geboren. Noch kündet dort niemand von dem neuen Erben, der schon vom Himmel herabsteigt. Das iam nova progenies caelo dimittitur alto ist noch nicht in jede Wohnund Bürgerstube gedrungen. Angst lähmt vielmehr die siebenhügelige Stadt. Denn im nahen Capua hat der Sklave Spartacus – man munkelt, er sei ein thrakischer Königssohn – einen gefährlichen Aufstand entfacht. Noch nie wurden die Grundfesten Roms in ihrem Innersten von einem Unfreien derart erschüttert, und niemand weiß, wie die Sache ausgehen wird.
Nur das kleine Palästina, noch jenseits der römischen Grenzen, kann sich der Segnungen eines bescheidenen Friedens erfreuen. Dort herrscht Königin Alexandra, die einzige Frau, die je den Thron der Juden bestiegen hat. Man zählt in Rom 680 Jahre seit Gründung der Stadt. Spätere Geschichtsschreiber werden vom Jahr 73 v. Chr. sprechen.
In diesem Jahr wurde unter der Regentschaft der „guten Königin“ Alexandra im südlichen Palästina jener Mann geboren, mit dem wir uns hier zu beschäftigen haben: Herodes, dem der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, wie wir gesehen haben, das seltene Prädikat „der Große“ verlieh, das von den kommenden Jahrhunderten aufgegriffen und so allmählich zum festen Bestandteil des königlichen Namens gemacht wurde.
Über seine Herkunft wurde bereits berichtet. Kindheit und Jugend sind wenig bekannt. Doch dürfte der ehrgeizige Vater seine beiden ältesten Söhne, Phasael und Herodes, schon früh mit den Möglichkeiten der Politik vertraut gemacht, ihnen gangbare Wege aufgezeigt und zumindest seinen Zweitgeborenen, Herodes, entscheidend geprägt haben. Stärker noch als sein Vater sollte sich dieser den Römern verbunden fühlen und schließlich erreichen, wovon Antipater wohl nicht einmal zu träumen gewagt hätte: Ein Königtum von Roms Gnaden.
Als es zur ersten Auseinandersetzung zwischen Hyrkan und Aristobul kam, 67 v. Chr., noch zu Lebzeiten von deren Mutter Alexandra, schickte, worauf bereits hingewiesen wurde, Antipater seine Frau Kypros und seine Kinder an den Hof von Petra, um sie aus der Gefahrenzone zu entfernen. Offensichtlich bestanden zur dortigen Herrscherfamilie verwandtschaftliche Beziehungen. So ist es denkbar, dass sich Herodes bald diesen Kreisen zugehörig fühlte, ohne ihnen tatsächlich anzugehören. Als gleichberechtigt akzeptiert wurden Antipater und seine Angehörigen allerdings nie.
Auch in Jerusalem verkehrte der Jüngling später am Königshof. Aber auch dort begegnete man ihm reserviert. Sicherlich hat die Stellung der Familie – als Juden fremd in Petra und als Halbjuden fremd in Jerusalem – ihr Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und vielleicht erklärt sich daher auch die Solidarität unter den fünf Geschwistern. Nur die Römer sollten sich weder an Herodes’ Herkunft noch an seinem Glauben stören. Davon wird noch ausführlich zu berichten sein.
Wie sah der junge Herodes aus? Auch darüber wissen wir so gut wie nichts. Verstreute Bemerkungen bei Flavius Josephus lassen vermuten, dass er groß und kräftig war. Über seine Ausbildung ist ebenfalls nichts bekannt. Man kann daher nur von der Bildungsvermittlung im Allgemeinen auf den Einzelfall schließen. Reiten, Jagen und das Kriegsspiel gehörten damals zu den standesgemäßen Beschäftigungen der Oberschicht, der Antipaters Familie zweifellos angehörte. Man darf deshalb annehmen, dass auch Herodes auf diese Weise seinen Körper stählte. Wahrscheinlich beherrschte er die Umgangssprache des damaligen Palästina, das Aramäische. Er wird zudem, zumindest in späteren Jahren, des Lateinischen und des Griechischen, der Gelehrtensprache Roms, mächtig gewesen sein. Damit dürften wir es selbst nach neuzeitlichen Maßstäben mit einem durchaus gebildeten Mann zu tun haben. Leider ist nicht bekannt, ob er auch Hebräisch sprach, das zu seiner Zeit als Umgangssprache zwar schon weitgehend durch das Aramäische verdrängt worden war, aber als Schriftsprache noch eine bedeutende Rolle spielte. Ob er hebräisch gelernt hatte oder nicht, wäre vor allem deswegen von Interesse, weil sich daraus Rückschlüsse auf seine Erziehung ableiten ließen. Nur wer in den Idealen des Judentums aufgewachsen oder zumindest doch mit ihnen vertraut war, konnte sich mit dieser Weltanschauung und den Zielen des jüdischen Volkes – die Entwicklung eines Gottesstaats auf dem Boden des verheißenen Landes und die Unabhängigkeit von jeglicher Fremdherrschaft – identifizieren.
Aus Herodes’ Verhalten als Throninhaber lässt sich leider nicht erkennen, ob er als Anhänger des jüdischen Glaubens erzogen worden war. Sein „Judentum“, ob eine Haltung aus innerer Überzeugung oder nur geschickt zur Schau gestellt, erschien jedenfalls seinen jüdischen Zeitgenossen so halbherzig, dass sie ein Recht zu haben glaubten, ihn wegen der idumäischen Herkunft seines Vaters und der nabatäischen Abstammung seiner Mutter als Halbjuden zu schmähen. Daran vermochte auch der beeindruckende Tempel nichts zu ändern, den er größtenteils aus eigenen Mitteln dem Gott seiner Untertanen erbauen ließ und der an Pracht und Herrlichkeit alles in den Schatten stellte, was je ein Herrscher seinem Volk als Heiligtum gestiftet hatte. Das eindrucksvolle Kunstwerk verdient die besondere Aufmerksamkeit eines jeden Altertumsfreundes.
In Flavius Josephus’ ansonsten so detailliertem Bericht werden wir, als er uns zum ersten Mal begegnet, mit einem Herodes konfrontiert, der bereits erwachsen und verheiratet ist. Über Kindheit und Jugend, über frühe charakter- und persönlichkeitsbildende Erlebnisse, Einflüsse und Erfahrungen, die spätere Verhaltensmuster zu erklären geeignet wären, hören wir von ihm nichts.
Angeborene Eigenschaften lassen sich allenfalls aus Tun und Unterlassen, aus Aktion und Reaktion, erkennen. Nach dem Wenigen, das bekannt ist, befand sich Herodes aber durchaus im Einklang mit den Herrschenden seiner Zeit, einer von Humanismus, Toleranz und friedlicher Koexistenz weit entfernten Epoche, die auch nicht dadurch menschenfreundlicher wurde, dass man allenthalben pax und clementia beschwor.
Herodes wird uns, wie bereits gesagt, als fertiger Mann präsentiert, der sich gerade anschickt, große Verantwortung zu übernehmen. Er ist verheiratet mit einer Frau namens Doris, einer „Bürgerlichen“, was immer der antike Historiker darunter verstehen mag. Sicherlich verbot es die hohe Stellung Antipaters bei Hofe, dass sich seine Söhne bei der Wahl ihrer Lebenspartnerinnen in die Niederungen des einfachen Volkes verirrten. Da Liebesheiraten unüblich und seltene Ausnahmen waren, muss Doris aus angesehenem, zumindest reichem Hause gekommen sein. Dass sie nicht adligen Kreisen entstammte, sollte ihre Stellung als Gemahlin des Königs Herodes bis zur Unerträglichkeit erschweren.
Wie ihre Familie bleibt auch ihre Nationalität im Dunkeln. Sie schenkte Herodes einen Sohn, Antipater. Beide, Mutter und Kind, sollten dem Ehemann, Vater und König einst großen Kummer bereiten.
Herodes heiratete neun weitere Frauen, von denen sieben namentlich bekannt sind. Nicht immer waren für die Heiraten nur politische Motive ausschlaggebend. Herodes hatte, so Flavius Josephus, „eine ganze Anzahl von Frauen, weil den Juden nach ihrem Gesetz die Vielweiberei gestattet ist und auch, weil er Vergnügen daran fand“1.
Als harten, energischen und unbeugsamen Mann, der ihm in vieler Hinsicht glich, schätzte Antipater seinen noch nicht 30jährigen Sohn. Diesem vertraute er 46 v. Chr. die Ausrottung der Widersacher des rechtmäßig inthronisierten Hyrkan in Galiläa an, „Räuber“, wie Flavius Josephus bemerkt,2 die unter dem Hauptmann Ezekias – der Geschichtsschreiber nennt fast alle Rebellen so – syrische Städte und Parteigänger der Römer terrorisierten und sich vor ihren Verfolgern in Höhlen verbargen. Ohne nähere Anweisungen vom Sanhedrin abzuwarten und ohne Gerichtsverfahren ließ Herodes diese Leute hinrichten, wurde daraufhin von den syrischen Bewohnern als Befreier gefeiert, von den Familien der Ermordeten und von der Jerusalemer Aristokratie jedoch gehasst.
Noch war der Einfluss des alten Adels nicht zu unterschätzen, aber man ahnte wohl, dass große Veränderungen in der Luft lagen. Der Argwohn galt weniger dem schwachen Hyrkan und dem langsam, aber sicher aussterbenden Hasmonäerhaus. „Die Ernennung des Phasael und des Herodes zu Gouverneuren bewies“, dass sich „hier eine Macht bildete aus einem Hause von Nichtpriestern und Nicht-Adeligen und obendrein Halbjuden; eine solche Macht drohte alle Verhältnisse in Judäa über den Haufen zu werfen und insbesondere die Adelsfamilien der Machtstellung, die sie seit Generationen innegehabt hatten, zu berauben.“3
Zur Hochburg ihrer Befugnisse hatte sich der Sanhedrin in Jerusalem entwickelt, der (wahrscheinlich aus der Gerusia hervorgegangene) Rat der Ältesten, dem unter anderem die peinliche Gerichtsbarkeit oblag. Die Entscheidung über Leben und Tod von Verbrechern galt dem Rat als die Bestätigung der inneren Herrschaft in Judäa schlechthin, einer der wenigen Bereiche, die ihm die Römer überlassen hatten und die wenigstens einen Schein von Unabhängigkeit bewahrten. Der jüdische Gesetzes- und Gerichtshof bestand aus 71 Personen, denen der Hohepriester vorsaß, sodass Hyrkans Herrschaft mit der des Sanhedrin eng verknüpft war. Dank des Einflusses auf den amtierenden Hasmonäer brauchte Antipater dieses Vorrecht also nach außen hin nicht anzutasten.
Leider ist nicht bekannt, aus welchen Leuten sich der Hohe Rat zusammensetzte. Wahrscheinlich war er eine aristokratische Körperschaft, die sich erst langsam und eher vorsichtig demokratisierte und in der sich die zunächst überwiegenden Sadduzäer mit den Pharisäern erst später die Waage hielten. Vor allem in nachherodianischer Zeit versammelten sich die Stadtväter von Jerusalem üblicherweise im Tempel in der „Halle der behauenen Steine“4. Man saß im Halbkreis, um Blickkontakt zu haben. Sekretäre und rechtskundige junge Schreiber nahmen an den Sitzungen teil. Es gab gewisse Ordnungsregeln. So konnte etwa ein Mitglied des Hohen Rats, das sich für einen Angeklagten aussprach, nicht später gegen ihn reden. Zum Freispruch, der unverzüglich zu verkünden war, genügte die einfache Mehrheit der Anwesenden. Eine Verurteilung bedurfte einer größeren Zustimmung (wobei sie erst tags darauf auszusprechen war). Neben seiner obersten richterlichen Gewalt „stellte der Sanhedrin ein Symbol für die verkörperte Autorität des Judentums dar“5.
Herodes allerdings scherte sich um bestehende Vorschriften und Empfindlichkeiten nicht. Er usurpierte das wichtigste Recht des Rates und maßte sich damit die Stellung eines unabhängigen Landverwesers an. Er verließ sich dabei auf die Macht des römischen Statthalters, Sextus Iulius Caesar, dem er allein das Recht auf die peinliche Gerichtsbarkeit auch über die Judenschaft zugestand. Hatte doch schon dessen Vorgänger Gabinius den Ältestenrat in Jerusalem aufgehoben und all seiner Machtbefugnisse beraubt, wenn auch Gaius Iulius Caesar die Entrechtung widerrufen und mit der Bestätigung des Ethnarchen Hyrkan deutlich gemacht hatte, dass die alten Rechtsverhältnisse wiederhergestellt sein sollten. Diese Restitution schloss auch das Recht des Sanhedrin ein, Todesstrafen zu verhängen.
Das eigenmächtige Vorgehen des Herodes bei der Bestrafung der Räuber galt deshalb vielen Ratsmitgliedern als schwerwiegender Verstoß gegen ihre legitimen Rechte und als Versuch, die bestehende Ordnung umzustürzen. Der junge Mann musste zur Verantwortung gezogen werden.
Energisch forderte der Rat deshalb von Hyrkan, Herodes vor Gericht zu stellen. „Wie lange“, hielten sie dem Ethnarchen vor, „willst du denn noch ruhig zusehen? Merkst du denn nicht, dass Antipater und seine Söhne alle Gewalt in Händen haben und dir selbst nur noch den Namen eines Königs lassen?“6 Der Rat allein hätte Hyrkan vielleicht nicht überreden können, gegen Herodes etwas zu unternehmen, aber er fürchtete sich vor dem Zorn der Mütter der Ermordeten, die Tag für Tag im Tempel beim König und beim Volk Gerechtigkeit anmahnten. So lud er Herodes vor, damit sich dieser gegen die Anschuldigungen verteidigen könnte.
Das rechtswidrige Verhalten seines Sohnes hatte indes auch Antipater in eine missliche Lage gebracht. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als sich zu fügen und Herodes zu raten, die Konsequenzen für sein vorschnelles Handeln auf sich zu nehmen. Aber er riet ihm dringend, zunächst seine Stellung in Galiläa zu festigen, und vor allem, nicht ohne bewaffnete Leibgarde vor seine Richter zu treten. Er müsse wissen, dass ihm die Todesstrafe drohe, falls man ihn schuldig spräche.
Herodes focht das alles nicht weiter an. Er verließ sich auf das Wohlwollen des Statthalters von Syrien, der, wie er wusste, Hyrkan befohlen hatte, den jungen Mann freizusprechen. Für den Fall der Weigerung hatte er ihm harte Strafen angedroht. Mit einer Begleitung, die dem Ethnarchen nicht gefährlich werden konnte, ihm selbst jedoch ausreichend Schutz bot, erschien Herodes vor dem Sanhedrin: Nicht in demütiger Haltung und schwarz gekleidet, wie sich das für einen Angeklagten, dem eine so schwere Tat zur Last gelegt wurde, gehörte. Er trat in einem Purpurgewand auf, das Haar geschniegelt und von Bewaffneten umgeben, ein in seinem Auftreten selbstsicherer junger Mann – wie unsicher er tatsächlich war, wird sich noch zeigen –, der alles Recht zu verhöhnen schien.
Tatsächlich ließen sich die Ratsmitglieder von soviel Schneid zunächst einschüchtern, bis der alte Sameas auftrat und sie für ihre Feigheit rügte: „ … Doch ich will Herodes keinen Vorwurf daraus machen, dass er mehr auf seinen Vorteil als auf die Gesetze achtet“, sagte er in flammender Rede. „Euch vielmehr und den König muss ich tadeln, dass ihr euch so etwas bieten lasst. Denkt aber daran, dass es einen allmächtigen Gott gibt, und dass der, den ihr jetzt Hyrkan zu Gefallen freisprechen wollt, einst auch den König dafür züchtigen wird.“7 Prophetische Worte, die in Erfüllung gingen, als Herodes selbst König geworden war.
Die Rede bewirkte tatsächlich einen Sinneswandel. Doch als Hyrkan merkte, dass man jetzt geneigt war, Herodes zum Tode zu verurteilen, vertagte er die Sitzung, um dem jungen Mann, den er wie einen Sohn liebte, die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Er gedachte wohl auch der Strafe, die ihn selbst erwarten mochte, wenn er sich über einen Befehl des römischen Statthalters hinwegsetzte. Hatte er nicht zudem eine gute Ausrede? Es fehlte eine grundlegende Prozessvoraussetzung. Niemand hatte sich bereit gefunden, gegen Herodes auszusagen, da sich ein jeder vor den Folgen fürchtete.
Herodes nutzte die Gelegenheit, um bei seinem Beschützer Sextus Caesar in Syrien Zuflucht zu suchen. Von diesem ließ er sich gegen Bestechungsgeld zum Strategen von Coilesyrien und Samaria machen und erkaufte sich wohl auch die Erlaubnis, an der Spitze einer Schar Bewaffneter nach Jerusalem zu ziehen und sich an seinen Feinden, darunter auch Hyrkan, der ihm immerhin die Flucht ermöglicht hatte, zu rächen. Gewiss, er hatte sich volens nolens der Vorladung gebeugt. Er wusste, welch mächtige Gegnerschaft sich im Falle seiner Weigerung gegen seinen Vater erhoben hätte. Es war also klug zu gehorchen, wollte er seiner Karriere nicht selbst im Wege stehen. Aber er empfand die Behandlung durch die von ihm ohnehin nicht sonderlich geliebten Juden als tiefe Demütigung.
Der Zug gegen Jerusalem ging jedoch selbst seinem Vater zu weit. In Begleitung seiner anderen Söhne zog er Herodes entgegen und beschwor ihn, es bei der Machtdemonstration zu belassen. Mit Mühe konnte er den erzürnten Jüngling von seinem Vorhaben abbringen. Dieser hatte immerhin deutlich gemacht, mit welchen Mitteln er sich zur Wehr zu setzen gedachte, wenn man ihm, aus welchen Gründen auch immer, nach dem Leben trachtete. Damit gab er sich fürs erste zufrieden und kehrte nach Galiläa zurück.
Eine wichtige Erfahrung hatte er aus dem Zwischenfall gewonnen: Er würde sich nie auf eine Partei der Juden verlassen können, sondern sich mehr noch als sein Vater ganz in die Hand der Römer begeben müssen.
Nicht zuletzt deshalb war auch für ihn der Ausgang des Bürgerkriegs zwischen Caesar und Pompeius von schicksalhafter Bedeutung.