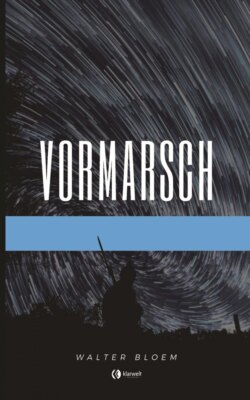Читать книгу Vormarsch - Walter Bloem - Страница 11
7.
ОглавлениеDas dumpfe Brausen des Erwachens der Tausende weckt mich. Es ist noch stichdunkel. Mich fröstelt. Grell stechen die erleuchteten Fensterreihen aus dem Bleigrau der Nacht.
Wieder hinauf zum Kompagnierevier! Die Schnarcher sind geweckt worden, kehren ihr Lagerstroh zusammen. In den Kammern hastiges Treiben. Meine Männer machen sich marschbereit. Ich geh’ von Stube zu Stube. Noch kenn’ ich nur wenige Namen, wenige Gesichter nur haben sich abgelöst aus dem Schwarm des Vierteltausends, das ich an den Feind führen soll. In jeder Stube empfängt mich das krachende „Achtung!“, erstarrt alles mitten in seiner Hantierung.
„’Morgen, Leute!“
„’Morgen, Herr Hauptmann!“
„Na, Kinder, nu geht’s also los!“
„Jawoll, Herr Hauptmann“
Eine kecke Fragestimme aus dem Hintergrunde:
„Russen oder Franzosen, Herr Hauptmann?“
„Wenn ich’s wüsste, mein Junge, dann dürft’ ich’s dir nicht sagen. Aber ich weiß es selber nicht. In zwei Stunden wissen wir’s alle beide. Wo möchtest du lieber hin?“
„Auf die Franzosen, Herr Hauptmann.“
„Ich auch. Wollen ’s Beste hoffen.“
Ahlert ist schon zu Gange, schnauzt von Stube zu Stube, sorgt, dass das Revier wie ein Schmuckkästchen übergeben werden kann. Wie ein Schmuckkästchen! Staub wirbelt auf, Besen werden geschwungen. Ich flüchte wieder auf den Kasernenhof.
„’raustreten!“
Im fahlen Morgenlicht wimmelt’s aus den Pforten, sammelt sich in grauen, schattenhaften Massen. Schnarrende Grüße klingen, wo die verkaterten jungen Leutnants begegnend einander erkennen. Das alles hab’ ich schon so oft erlebt — vorm Ausrücken zu meinen sechs Manövern. Nur die Farben haben gewechselt. Statt des gewohnten Blau und Rot der Uniformen, des flimmernden Messinggelb der Helmbeschläge — überall das stumpfe, deckende Grau. Ein Neues, ein Unerhörtes hebt an.
Die Kameraden finden sich zusammen. Die Hauptleute zumal. Sarkastisch und gelassen wie immer Graf Reventlow, herb und zusammengerissen Spiegel, der alte Afrikaner, etwas übernächtig der kleine, dicke Sommer-Oberleutnant. Alles wie im Manöver.
Die Kompagnien haben sich aufgestellt. Die Stunde naht. Auf Leutnant Graberts Kommando fliegen mit einem Ruck die zweihundertfünfzig Köpfe der Zweiten nach rechts, ihrem Häuptling entgegen.
„Kompagnie zur Stelle mit dreiundzwanzig Unteroffizieren, zweihundertdreiundzwanzig Mann!“
„’Morgen, Kompagnie!“
„’Morgen, Herr Hauptmann!“
Das dröhnt wie ein Jubelschrei, wie ein Sturmstoß.
„Na, Jungens, nun fängt er also an, der Krieg! In einer Stunde rollen wir hinaus, wohin der König befiehlt. Vertragt euch manierlich auf der Fahrt, eure Instruktion kennt ihr ja. Und dann, wenn wir an den Feind kommen: drauf als gute Brandenburger! Im Dienst stramm, tapfer, gehorsam — außer Dienst fröhlich: fröhlich und stolz, dass wir Männer sind und unsre Lieben schützen dürfen vor all den Feinden in Ost und West!
Rührt euch!“
Feldwebel Ahlert bittet, noch einen Augenblick wegtreten zu dürfen, um seiner Frau Lebewohl zu sagen. Es ist hell geworden. Da stehen sie: vier, fünf blasse Frauen vor der Pforte der Kaserne, die auch ihr bescheidenes, eng dem Dienst ihrer Männer verknüpftes Familienglück umschloss. Ich trete zu der Weinenden heran: ein feines, liebes, schlankes Menschenkind. Sie trägt ihr Bübchen auf dem Arm — es wird bald ein Geschwisterchen bekommen.
„Kopf hoch, liebe Frau Ahlert! Ihr Mann wird für mich sorgen, und ich für ihn. Wir zwei halten treu zusammen. Das wollen wir einander hier vor Ihnen versprechen.“
Fünf Uhr. Die Stunde des Abmarsches. Die erste Kompagnie geht an die Gewehre. Ein rosiger Hauch aus Osten überflockt den umwölkten Himmel.
„Zweite Kompagnie: an die Gewehre! Gewehr in die — Hand! Bitte die Herren einzutreten und zu ziehen!“
Mein Säbel fliegt aus der Scheide. Ich hab’ ihn nur dies einzige Mal gezogen im ganzen Feldzuge. Er hat sich als kriegsunbrauchbar erwiesen — unser schöner, langer, stolzer Schleppsäbel.
„Stillgestanden! Das Gewehr — über!
Kompagnie — marsch!“
Unsere Pferde sind längst verladen. Zu Fuß setz’ ich mich an die Spitze meiner Kompagnie, das Herz geschwellt von nie gefühltem Stolz. Es geht hinaus — hinaus.
Die Stunde unsres Abmarsches ist streng geheim gehalten worden. Frankfurt ahnt nicht, dass seine Grenadiere so früh schon ausrücken. Die Straßen sind leer. Nur an den Fenstern tauchen hier und dort erschrockene Frauengesichter hinter eng zusammengerafften Gardinen auf.
Alte, liebe Garnisonstadt! Mir, dem Reserveoffizier, hast du nur zu meinen Übungen Gastrecht gewährt, jedes Mal auf kurze Wochen. Und doch, in dieser Abschiedsstunde bist du mir die Heimatstadt. Wird’ ich doch mit jeder Sekunde mehr Soldat — dieweil versinkt, was ich sonst noch bin.
Wir sind am Bahnhof. Die Kompagnien trappsen durch die Vorhalle, strudeln auf den Bahnsteig. Da steht der endlose Zug, der das Bataillon hinaustragen soll — wohin? Ost? West? Noch immer keine Ahnung. Die Lokomotiven stehen gen Westen. Aber das beweist nichts. Das kann auf Täuschung der Spione abzielen.
Signal: Einsteigen! Im Nu sind die Gepäckwagen, die unsre Mannschaften aufnehmen sollen, bis zum Bersten gefüllt mit lebendiger Fracht. Viele wollen ihre Wagen mit Inschriften versehen, mit Grün schmücken. Major von Kleist verbietet’s.
„Wenn wir als Sieger wiederkommen!“
Wir Offiziere richten uns für eine lange Fahrt ein. All das vollzieht sich ruhig, ohne Aufregung, ohne Jubel, als ging’s zum Manöver. Das Publikum hat keinen Zutritt zum Bahnhof. Nur eine einzige Offiziersdame steht auf dem Bahnsteig: die Frau des Bataillonsadjutanten, gestern kriegsgetraut: ein zartes, blutjunges Geschöpfchen. Hält sich wunderbar, wie’s der preußischen Offizierstochter, Offiziersschwester, Offiziersfrau geziemt. Rührend in ihrem straff beherrschten Weh.
— Endlich. Die Wagentüren klappen. Der Stationsvorsteher legt die Hand an die rote Mütze, die Bahnbeamten winken, ein tränennasses weißes Tüchlein weht. Ein einziges. Der Zug rollt — gen Westen. Am Bahnhofsgitter hat sich ein knappes Hundert Menschen angesammelt. Sie winken, rufen: Auf Wiedersehen. Die Stadt schwebt vorüber, fern die Zwölfer-Kaserne. Die vertraute Landschaft, einst Schauplatz unzähliger Felddienstübungen und fröhlicher Ritte. Mir hat niemand nachgewinkt. Fern im Südwesten schlummern meine Lieben. Eine liegt gewiss schlummerlos. Ich denke stumm an sie. Und stumm geworden sind wir alle. Wer wird heimkehren? und wer — wird draußen bleiben?
Die Fahrt ist gen Westen gegangen. Dauernd gen Westen. Als uns das klar wurde, da hat’s einen großen Jubel gegeben. Es geht ins schöne Frankreich. Es geht — ins Belgierland vielleicht. Wir wussten längst, dass unsere Heere die belgische Grenze überschritten hatten. Und wie sie dort empfangen worden waren. Die Morgenblätter, die wir unterwegs erhielten, meldeten grausige Geschichten von einem Franktireurkriege, der Siebzig in Schatten stellte. Von Geistlichen, die bewaffnet an der Spitze der Freischärler kämpfen. Von heimtückischen Überfällen auf Patrouillen und Posten, die man später mit ausgestochenen Augen und abgeschnittenen Zungen gefunden. Von vergifteten Brunnen. Von Überfällen auf unsere Trainkolonnen. Ein erster Pesthauch des Krieges, dieses Krieges schlug uns entgegen aus weiter Ferne. Dennoch: der Westen. Er schien uns vertraut und fassbar. Russland — schon der Name weckte unbestimmtes Grausen. Wir meinten zu wissen, man werde gegen Russland rein defensiv kämpfen, zunächst Frankreich im ersten ungeheuren Anprall zu Boden rennen. Und wir wollten da sein, wo es einzugreifen galt.
Der Zug rollte dahin. Nun umfuhr er in weitem Bogen auf der südlichen Ringbahn Berlin. Berlin, mein Berlin. In den sieben Jahren, die ich, vor Stuttgart, dort als freier Schriftsteller gelebt, hatte ich mich selber ganz gefunden. Tiefes Heimatgefühl verband mich dieser ungeheuren Stadt, wärmste Freundschaft manchem lieben Menschen darinnen. Euch einen stummen Gruß aus tiefster Seele! Und dir, du Erweckerin, große, feurige, rastlose Stadt.
Zwei Tage hat sie gedauert, diese unvergessliche Fahrt. Eine Erholung nach der fieberhaften Arbeit der Mobilmachungswoche. Gedenk’ ich ihrer heute, erklingt’s in meiner Seele wie helle Musik.
Deutschland breitete sich um uns. Deutschland drängte sich an unser Herz. Es war ein großes, erschütterndes Einigungsfest.
Zwar die Bahnhöfe waren überall für die Bevölkerung gesperrt. Dies und das segensreiche Alkoholverbot erhielten der Fahrt ihre stille Würde. Die Städte, die Dörfer hatten ihre Sendbotinnen abgeordnet, uns aus der Nähe noch einmal zu grüßen. Ihr stattlichen Frauen, ihr lachenden Mädchen mit dem roten Kreuz an der Armbinde, ahnt ihr, was euer Anblick, euer Wort, eure Gaben uns waren, uns, den Scheidenden?
In Liebesgaben erstickten wir fast. Unsere Kerls wurden sozusagen zusehends fett von all der Schokolade, den Riesenmassen von Butterbroten, welche die reichliche Sitzung der glänzend eingerichteten Verpflegungsstationen ergänzten.
Zeitungen flatterten uns zu. Was wussten sie zu melden? Einen ersten, in Windesschnelle errungenen, Fantastisch großartigen Sieg:
Lüttich gefallen . . .
Schon kamen die ersten Andeutungen von einem kolossalen Trumpf, den unsere Waffenindustrie im kaum begonnenen Spiel hatte ausspielen können: eine Riesenkanone Krupps, vor deren mannslangen Granaten die Forts der belgischen Festung wie Streichholzschachteln in die Luft gegangen seien. Daneben immer die wüste Kunde von scheußlichen Franktireurkämpfen.
Eine Nacht im Eisenbahnwagen, die erste von vielen. Als sie vergangen, umwehten mich Heimatlüfte. Der Sonntag kam, noch festlicher, heiterer wurde ringsum das Gewühl. Durch Westfalens Industriestädte rollten wir hindurch. Die düstre Kargheit ihrer Hügelfronten war erhellt von lichten Fähnchen, wehenden Tüchern. Die Arbeiterbevölkerung war mit ganzer Seele bei diesem Krieg. Ich hatt’ es niemals anders erwartet, mancher der Kameraden staunte. Das Bild war wundervoll, wie au fünf Stockwerken die Fabrikarbeiter, sommersonntäglich frisch behemdärmelt, inmitten der Orgelpfeifen ihrer Kinderscharen uns Offizieren zuwinkten. Nun erkannten sie in uns, was wir immer gewesen waren: die Erzieher ihrer Jugend zur Wehrhaftigkeit — ihre Führer im kommenden Kampf, der auch um ihr Dasein ging: um ihres zuerst und zumeist. Brüder grüßten sie uns, und unsern Brüdern grüßten wir zurück. Für euch und eure Kinder unser Schwert, unser Leben.
Einen großen Teil der Fahrt erlebten wir, wie ich niemals vor und nach eine Eisenbahnfahrt erlebt hab’: vorn auf den angepflöckten Kompagniewagen saßen wir unter freiem Himmel. Die Augustsonne strahlte, der Zug rollte gemächlich dahin, der Lokomotivruß störte uns nicht. Gedenk’ ich heute jener Stunden, will mir das Herz vor Glück und Wehmut zerspringen. Wie viele von denen, die dieser Fahrt teilhaftig wurden, leben denn noch?! Kameraden, die ihr noch seid und diese Zeilen lest, schickt mir einen Gruß. Ich grüße euch, die Fernen, und sehnsüchtiger noch, ehrfürchtiger grüß’ ich die Unzähligen, die diese Zeilen nicht mehr lesen können.
Wir hatten natürlich keine Ahnung, welche Strecke wir fahren würden. Schon war mir’s klar geworden, dass keine Aussicht war, durchs heimatliche Wuppertal zu kommen. Aber wenn ich wenigstens gewusst hätte, ob wir bei Düsseldorf über den Rhein gehen würden oder bei Duisburg? Ich hätte so gerne meine alte Mutter telegraphisch bestellt. Aber nicht einmal das hätte ich machen können, ohne gegen den Befehl zu handeln. So hab’ ich hinausziehen müssen, ohne die Teure, Verehrte noch einmal sehen zu können. Das war sehr hart.
Kurz vor Düsseldorf durchfuhren wir den langgestreckten Schiebebahnhof Derendorf.
Hier entstand ein längerer Halt. Alle Geleise waren gestopft voller Wagen. Auf ihrem kastenlosen Boden standen angepflöckt in unübersehbaren Massen: Geschütze. Kanonen und immer wieder Kanonen. Und auf der andern Seite: Autos. Personenautos, Lastautos.
Die ersteren in allen Abstufungen der Eleganz. Die Fantasie erträumte ihre Vergangenheit: sah violette Schleier wogen und schelmische Frauenaugen blitzen im Vorübersausen. Die Kraftwagen trugen Inschriften: Speditionsfirmen aus Hannover, Gotha, Brandenburg. Wertheim-Autos und Schultheiß-Autos. Alles requiriert.
Die Seele ahnte zum ersten Male: welch ein ungeheures Chaos geworden sei in wenig Tagen aus unserer wundervoll geordneten, wundervoll ihren Uhrwerksgang laufenden Welt. Wann würde sie wieder „aufgeräumt“ sein?!
Der Sonntag ging zur Rüste. Blutig angestrahlt stiegen aus Westen schwere Abendwolken auf.
So fuhren wir über den Rhein. Wir saßen zu fünfen auf einem Kompagniewagen: Graeser, Wildegans, Schüler, Tettenborn und ich.
Und wie wir nun über die leichtgeschwungene Eisenbahnbrücke zum andern Stromufer hinüberrollten, da stürmte aus dem ganzen Zuge mit einem Mal ein mächtiges Lied in die Lüfte. Jenes Lied, das unsre Väter vor vierundvierzig Jahren über den Strom und ins Herz des Feindesland hineingeleitet hatte:
„Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!
Wer will des Stromes Hüter sein?
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
fest steht und treu die Wacht am Rhein!“
— — Ist dies nun noch Wahrheit? ist’s Erlebnis? oder ist es Traum — ist’s ein Märchen? ein altes Heldenlied?
All mein Gefühl, all mein Können hatt’ ich vor vier Jahren an die Schilderung dessen gesetzt, was nun sich erneute als Wirklichkeit, als brennende Gegenwart. Mein Dichten ward mein Leben, Wort wurde Tat.