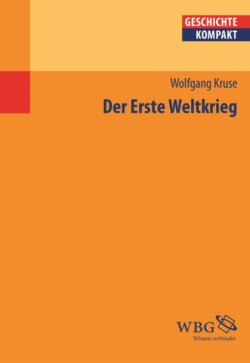Читать книгу Der Erste Weltkrieg - Wolfgang Kruse - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Burgfrieden
ОглавлениеDer Kriegsbeginn setzte vieles in Bewegung, nur das innenpolitische Leben schien erst einmal wie still gestellt. Nicht nur im Deutschen Reich bewilligten die im Reichstag vertretenen Parteien am 4. August 1914 einstimmig die von der Regierung vorgelegten Kriegskredite und ein Ermächtigungsgesetz für weitreichende Eingriffsmöglichkeiten in das Wirtschaftsleben, bevor sich das Parlament auf unbestimmte Zeit vertagte. Auch die anderen Volksvertretungen, das britische Parlament, die französische Nationalversammlung oder die russische Duma (der österreichische Reichstag allerdings war schon länger suspendiert und trat nicht zusammen) verabschiedeten ähnliche Gesetzesvorlagen. Mehr noch, überall wurde förmlich und feierlich eine Einstellung der parteipolitischen Auseinandersetzungen für die Dauer des Krieges beschlossen: Burgfrieden, Truce Policy oder Union Sacrée lauteten die jeweiligen Formeln für die Etablierung kriegspolitischer nationaler Einheitsfronten.
Die Politik der Kriegsgegner
So selbstverständlich und einförmig, wie der nationale Zusammenschluss im Angesicht des Krieges sich im Rückblick darzustellen scheint, war er jedoch nicht. Die großen Arbeiterparteien aller beteiligten Länder hatten in der Vorkriegszeit den Antimilitarismus und den Kampf gegen die imperialistische Kriegsgefahr in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten gerückt, so dass viele Zeitgenossen für den Kriegsfall Widerstand, zumindest aber Distanz zu den nationalen Kriegsanstrengungen erwarteten. Zusammengeschlossen in der II. Sozialistischen Internationale, proklamierten sie die internationale Kriegsgegnerschaft des Proletariats und organisierten eine Vielzahl oft grenzüberschreitender Antikriegskundgebungen. Vor allem in Großbritannien konnte die Labour Party sich dabei in Übereinstimmung mit starken Strömungen im liberalen Lager sehen, doch auch in Frankreich war die bürgerliche Friedensbewegung ausgesprochen stark. Hier hatte sich ferner die mehrheitlich syndikalistisch orientierte, in der Confédération Générale du Travail (CGT) zusammengeschlossene Gewerkschaftsbewegung strikt antimilitaristisch entwickelt und den Generalstreik gegen jeden imperialistischen Krieg proklamiert. Diese Forderung war vor allem von französischer Seite auch in der Internationale immer wieder vorgebracht worden. Doch die gemeinsame Festlegung aller Mitgliedsparteien auf einen internationalen Massenstreik bei Kriegsbeginn hatte vor allem die deutsche Sozialdemokratie verhindert.
Die SPD und die Freien Gewerkschaften standen nicht zuletzt unter dem Eindruck ihrer langjährigen Verfolgung unter den erst 1890 aufgehobenen Sozialistengesetzen. Weiterhin mit den Worten von Wilhelm II. als „Reichsfeinde“ und „vaterlandslose Gesellen“ aus der Nation ausgegrenzt, wollten sie ihren mächtigen politischen Gegnern keine Rechtfertigung für neue Ausnahmegesetzte und Verfolgungen bieten. Hinzu kam, dass die nationale Landesverteidigung gegen feindliche Angriffe von der Internationale akzeptiert wurde. Und hier befürchteten die Franzosen, Opfer einer Aggression des „preußisch-deutschen Militarismus“ zu werden, während ihre deutschen Genossen den als „Hort der Reaktion“ begriffenen Zarismus in Russland als Hauptbedrohung ansahen und deshalb ein Eintreten für die Landesverteidigung nicht ausschließen wollten. Trotzdem mobilisierte die SPD in den außenpolitischen Krisen der Vorkriegsjahre mehrfach viele zehntausend Menschen, um gegen die drohende Kriegsgefahr zu protestieren.
Antikriegsproteste
Auch im Juli 1914 trat das kriegsgegnerische Potential der internationalen Arbeiterbewegung deutlich in Erscheinung. In allen Ländern fanden noch Ende Juli Kundgebungen und Demonstrationen gegen den drohenden Krieg statt, an denen sich in Deutschland etwa 750.000 Menschen beteiligten. Es lag kaum an einer zu geringen Massenbeteiligung, sondern mehr an der politischen Schwäche der sozialistischen Antikriegsbewegung, dass die in den Krieg führenden Entwicklungen nicht ernsthaft behindert werden konnte. Zwar fand sich am 28./29. Juli in Brüssel das Führungsgremium der Internationale noch einmal zusammen, doch ein gemeinsames Vorgehen konnte angesichts der höchst unterschiedlichen nationalen Interessen nicht mehr beschlossen werden. Anfang August trafen sich in Paris Vertreter der deutschen und der französischen Sozialisten, wobei letztere jedoch deutlich machten, dass sie ihr Land gegen eine deutsche Aggression verteidigen würden. Auch die Ermordung des Sozialistenführers Jean Jaurès durch einen Nationalisten am Abend des 31. Juli konnte daran nichts ändern, zumal die Regierung alle für den Kriegsfall geplanten Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Arbeiterbewegung, vor allem die Verhaftung ihrer im berühmten Carnet B aufgeführten Führungspersönlichkeiten, außer Kraft setzte. Auf der auch von Vertretern der nationalistischen Rechten besuchten Beerdigung von Jaurès am Morgen des 4. August kündigte der CGT-Vorsitzende Léon Jouhaux, der bis vor kurzem noch ein Verfechter der Idee des antimilitaristischen Generalstreiks gewesen war, stattdessen an, die gesamte französische Arbeiterklasse werde das Vaterland der Revolution gegen den preußischdeutschen Militarismus verteidigen. In London dagegen wurde noch am 2. August auf dem Trafalgar Square gegen den Krieg demonstriert, als in Frankreich und Deutschland unter dem Belagerungszustand längst alle öffentliche Proklamationen verboten waren.
Die organisierte Arbeiterbewegung
Vor allem in Deutschland war der Abbruch der Antikriegsproteste jedoch noch keineswegs identisch mit der Entscheidung für die Bewilligung der Kriegskredite und den Burgfriedensschluss, die in einer hochgradig politisch motivierten Geschichtsschreibung lange entweder als „Verrat“ an den sozialdemokratischen Traditionen oder als längst überfälliges, eigentlich selbstverständliches Bekenntnis zur Nation beurteilt wurden. Beide Wertungen gehen jedoch an den realen Bedingungen und Motiven einer Entscheidung vorbei, die sich kurzfristig in einer hochgradig aufgewühlten, unübersichtlichen Atmosphäre herausbildete. Noch am 1. August, als der Krieg schon unausweichlich erschien, optierte eine deutliche Mehrheit in den schnell zusammengerufenen Führungsgremien der SPD für Stimmenthaltung oder Ablehnung der Kriegskredite. Anders als in Frankreich, wo die Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) in engem Kontakt mit der vom ehemaligen Sozialisten René Viviani geführten Regierung stand und nicht ohne Grund von ihrem Friedenswillen überzeugt war, konnten die deutschen Sozialdemokraten kaum davon ausgehen, dass ihre Regierung keine Schuld am beginnenden Krieg tragen würde. Zwar bemühte sich Reichskanzler Bethmann Hollweg intensiv darum, das den Sozialdemokraten als Bedrohung erscheinende Russland als Hauptschuldigen am Krieg hinzustellen, und die Sozialdemokratie (und in ihrem Gefolge viele Historiker) hat ihre Burgfriedenspolitik später immer wieder damit begründet, von einem Verteidigungskrieg gegen eine russische Aggression überzeugt gewesen zu sein. Doch diese Rechtfertigung ist in mancher Hinsicht zweifelhaft. Denn bis Ende Juli/Anfang August hatte die Parteipresse nachdrücklich die Verantwortung der deutschen Regierung für die Entscheidung über Krieg und Frieden herausgestellt, und auch in den folgenden Tagen äußerten viele Sozialdemokraten intern die zutreffende Auffassung, dass der Reichsleitung zumindest ein hohes Maß an Verantwortung für die Kriegsauslösung zufalle. Der Verteidigungskrieg, den man nun beschwor, galt im Grunde unabhängig von Schuld und Verantwortung, denn die Landesverteidigung schien nun allein deshalb notwendig, weil eine mögliche Niederlage in jedem Fall auch für die Stellung der deutschen Arbeiterbewegung höchst bedrohlich erschien, zumal gegen das zaristische Russland.