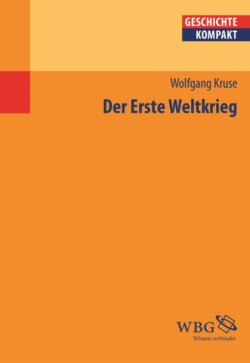Читать книгу Der Erste Weltkrieg - Wolfgang Kruse - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Q
ОглавлениеRichard Dehmel, Lied an Alle Aus: Zwischen Volk und Menschheit. Kriegstagebuch, Berlin 1919.
| Sei gesegnet, ernste Stunde,Die uns endlich stählern eint;Frieden war in aller Munde,Argwohn lähmte Freund wie Feind –Jetzt kommt der Krieg,Der ehrliche Krieg! | Feurig wird nun Klarheit schwebenÜber Staub und Pulverdampf;Nicht ums Leben, nicht ums LebenFührt der Mensch den Lebenskampf –Jetzt kommt der Tod,Der göttliche Tod! |
| Dumpfe Gier mit stumpfer KralleFeilschte um Genuß und Pracht;Jetzt auf einmal fühlen alle,Was uns einzig selig macht –Jetzt kommt die Not,Die heilige Not! | Gläubig greifen wir zur WehreFür den Geist in unserem Blut;Volk, tritt ein für deine Ehre,Mensch, dein Glück heißt Opfermut –Dann kommt der Sieg,Der herrliche Sieg! |
Der Kriegsbeginn: Eine innere Reichsgründung?
Offensichtlich spielte dies vor allem in Deutschland eine besondere Rolle, wo man lange die ausbleibende „innere Reichsgründung“ beklagt, die nationalen Minderheiten unter Sondergesetze gestellt und die sozialdemokratischen und katholischen „Reichsfeinde“ aus der Nation ausgegrenzt, damit aber auch die von ihnen ausgehenden Bedrohungspotentiale überhöht hatte. Nun wurden stattdessen der Burgfriedensschluss und das Massenerlebnis der Mobilmachung zu einem „Augusterlebnis“ der nationalen Einheit des deutschen Volkes stilisiert und der im Krieg geborene „Geist von 1914“ als Garant nationaler Zukunft beschworen. „Dieser Krieg ist ein Zauberkünstler und ein Wundertäter“, stellte etwa die „Tägliche Rundschau“ am 5. August begeistert fest, denn er führe nicht nur Welfen, Elsass-Lothringer und Polen zu „feurigem Reichsbekenntnis“, sondern er vollbringe sogar „das größte aller Wunder: Er zwingt die Sozialdemokratie an die Seite ihrer deutschen Brüder.“ Der nationale Überschwang konnte dabei allerdings nur oberflächlich verdecken, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit der nun von allen beschworenen nationalen Einheit sehr unterschiedliche, ja gegensätzliche Interessen verbanden, die schon bald wieder zu politischen Konflikten führen mussten. Denn während aus konservativer Sicht das Bekenntnis aller Bevölkerungsgruppen zu Nation, Staat und Monarchie gefeiert wurde, erwarteten die bislang ausgegrenzten und benachteiligten Kräfte von der Sozialdemokratie über die nationalen Minderheiten und die Juden bis hin zur Frauenbewegung, dass das gemeinsame Kriegsengagement auch zu gesellschaftlicher Gleichberechtigung und politischen Reformen führen werde.
Grenzen des Augusterlebnisses
Die vielfach zitierten Beschwörungen des „Augusterlebnisses“ sind zweifellos beeindruckende Zeugnisse einer bei Kriegsbeginn um sich greifenden Begeisterung. Sie sollten jedoch auch jenseits ihrer inneren Widersprüchlichkeit nicht verallgemeinert werden. Denn dabei handelte es sich nur um eine Ausdrucksform der vielfältigen, teilweise auch widersprüchlichen Gefühlsbewegungen, von denen die Menschen bei Kriegsbeginn ergriffen wurden. Schon in den bürgerlich geprägten großstädtischen Zentren wurden keineswegs alle Menschen von der Begeisterung mitgerissen. Ein kritischer Beobachter, der junge Mitarbeiter des sozialdemokratischen „Vorwärts“ Rudolf Franz, hielt in seinem Tagebuch nach der Verkündung der Mobilmachung das folgende Stimmungsbild aus der Berliner Innenstadt fest: „Viele Frauen mit verweinten Gesichtern. Ernst und Bedrücktheit. Kein Jubel, keine Begeisterung. (…) Beim Schlossplatz Menschenmassen. Hochrufe und singenden Gruppen vor dem Kronprinzenpalais. Die Weiterwegstehenden passiv.“ Auch zwei Tage später registrierte er überall nur „Ernst und Aufgeregtheit“. Und der Vertreter der dänischen Minderheit im Reichstag, Hans Peter Hanssen, notierte am 4. August in seinem später auf Englisch publizierten Tagebuch: „On the way I read high-sounding newspaper accounts describing the jubilation and enthusiasm in Berlin. The opposite is evidently the truth, judging by what I had ample opportunity to see on my way here to the hotel.“
Vor allem trat die Distanz zur Kriegsbegeisterung aber jenseits der zentralen Orte deutlich zu Tage. Aus Arbeitervororten und ländlichen Gebieten berichten die verfügbaren Quellen vielfach über eine gedrückte, von Trauer und Angst, teilweise auch von kriegsgegnerischen Traditionen geprägte Stimmung. „In der letzten Juliwoche“, stellte etwa der Pfarrer einer Arbeitergemeinde bei Frankfurt am Main fest, „war im Dorf alles voller Sorge. Bei der Mobilmachung, als das letzte Fädchen Hoffnung zerschnitten war, wurde es noch stiller und Verzweifelung setzte ein. Keine Begeisterung, keine patriotischen Lieder.“ Der Ausmarsch der Rekruten vollzog sich hier tatsächlich weit häufiger unter Tränen als unter Begeisterungsstürmen. „Dicht besetzte Militärzüge verlassen die Bahnhöfe. Weinend nehmen Frauen und Kinder Abschied und manchem Familienvater, der hart im Leben wurde, stehen die Tränen im Auge. Der Jammer ist groß“, lautete ein typischer Bericht in der sozialdemokratischen Lokalpresse. Und angesichts der schon bei Kriegsbeginn rasch um sich greifenden sozialen Not konnte sich die Stimmung auch in der Folgezeit selbst unter dem Eindruck von Siegesmeldungen kaum oder nur kurzzeitig heben. Die Beteiligung am Krieg wurde überwiegend als eine nationale Pflichterfüllung hingenommen und akzeptiert, doch für nationalistischen Überschwang blieb dabei wenig Raum.