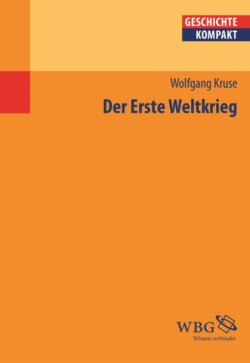Читать книгу Der Erste Weltkrieg - Wolfgang Kruse - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Stimmung der Bevölkerung
ОглавлениеEine wirksame Legende
Die Kriegsbegeisterung von 1914 ist geradezu legendär. Sie wird in vielen Publikationen immer wieder beschworen, und mit ihr wird vieles begründet: vor allem der sozialdemokratische Burgfriedensschluss, manchmal sogar die Auslösung des Krieges, die von den kriegsbegeisterten Massen den eher zögernden Politikern und Staatsmännern aufgedrängt worden seien. Und nicht zuletzt wird immer wieder der Versuch unternommen, das ebenso verstörende wie offensichtlich in mancher Hinsicht liebgewonnen Bild der begeistert in Krieg und Tod ziehenden Menschenmassen zu erklären. Das Phänomen selbst dagegen ist von der Geschichtswissenschaft lange Zeit einfach vorausgesetzt und nicht weiter untersucht worden. Neuere sozialgeschichtliche Forschungen haben demgegenüber gezeigt, dass die Massenstimmung bei Kriegsbeginn tatsächlich vielfältige Ausprägungen hatte und keineswegs primär durch Begeisterung gekennzeichnet war. Dabei handelte es sich vielmehr nur um eine Form der Massenstimmung unter anderen, die vor allem aus propagandistischen Gründen schnell verabsolutiert wurde. Dies gilt besonders für Deutschland, wo das vermeintlich klassenübergreifende, alle Deutschen im Zeichen des Krieges einende „Augusterlebnis“ unter dem Signum des „Geistes von 1914“ schnell zu einem geschichtsmächtigen Mythos weiterentwickelt wurde.
Zur Forschungsentwicklung
Von grundlegender Bedeutung für eine differenzierte Untersuchung der Massenstimmung bei Kriegsbeginn ist eine auf Frankreich bezogene Studie von Jean-Jacques Becker aus dem Jahre 1977, in der systematisch verschiedene Formen von Stimmungsberichten in der Presse, von den Präfekten sowie von den Schulleitern ausgewertet wurden. Im Ergebnis konnte Becker einen Stimmungswandel feststellen, der bei starken regionalen und sozialen Unterschieden grundsätzlich von anfänglich starker Reserviertheit gegenüber dem Krieg im Verlauf der Mobilmachung zu einer durchaus kriegsentschlossenen, aber weiterhin keineswegs durchgängig begeisterten Stimmung geführt hat. Wesentlich dafür war die Idee der Landesverteidigung. Wie spätere Forschungen auch für Deutschland bestätigt haben, kann dieses Gesamtbild tendenziell verallgemeinert werden. Festzuhalten ist vor allem aber, dass die Stimmung der Bevölkerung bei Kriegsbeginn viele Ausprägungen und Facetten hatte, die sich nach sozialen, regionalen, religiösen und politischen Kriterien durchaus unterschieden.
Verbreitete Distanz zum Krieg
Es ist festzuhalten, dass die große Mehrheit der europäischen Bevölkerung keineswegs einen Krieg gewünscht oder gar herbeigesehnt hat. Noch in der letzten Juliwoche wiesen die zumeist von der Arbeiterbewegung organisierten kriegsgegnerischen Veranstaltungen überall eine weit größere Massenbeteiligung auf als die in der Presse herausgestellten, mehrheitlich von bürgerlichen Jugendlichen und Studenten getragenen Manifestationen für den Krieg. Den „Sängerwettstreit“ im Zentrum Berlins zwischen nationalistische Lieder anstimmenden jungen Männern auf der einen, die Internationale und andere revolutionäre Lieder singenden Arbeitern auf der anderen Seite, konnten die für den Krieg auftretenden Demonstranten nur deshalb gewinnen, weil die Polizei zu ihren Gunsten eingriff und die sozialistischen Antikriegsdemonstrationen mit Waffengewalt auflöste. Unter dem Belagerungszustand veränderte sich die Situation erst einmal deshalb, weil Antikriegsproteste nunmehr generell verboten waren. Die Massenstimmung durchlief darüber hinaus jedoch bei Kriegsbeginn vielfältige Transformationsprozesse, deren Grundlagen in einer allgemeinen Emotionalisierung durch die Beschleunigung und die einschneidende historische Bedeutung des politischen Geschehens zu suchen sind.
Ein Stimmungsumschwung
Der Übergang vom Frieden zum Krieg rief bei vielen Menschen den Eindruck eines allgemeinen gesellschaftlichen Wandlungsprozesses hervor, der die bisherigen Normen und Regeln des gesellschaftlichen Lebens zeitweise außer Kraft zu setzen schien und insbesondere in den großstädtischen Zentren mit ihren symbolischen Orten und Inszenierungen deutliche Ausformungen von Kriegsbegeisterung hervorbrachte. Begeisterte Menschenmassen begrüßten hier die Verkündung der Kriegserklärungen, feierten die ausziehenden Soldaten und bejubelten die Meldungen vom Burgfriedensschluss und ersten militärischen Siegen. Bald traten erste publizistische Ausdeutungen der Kriegsbegeisterung hinzu, die den Sinn des Geschehens zu bestimmen versuchten und zur Grundlage der Ideologisierung des Krieges wurden. Besonders die Vertreter des Bildungsbürgertums taten sich dabei hervor. „So auch bin ich nicht mehr“, fasste einer der bedeutendsten Wortkünstler deutscher Sprache, Rainer Maria Rilke, die gemeinschaftsstiftende Situation des Kriegsbeginns in Worte, „aus dem gemeinsamen Herz schlägt das meinige den Schlag, und der gemeinsame Mund bricht den meinigen auf“. Und Sigmund Freud, stellte erstaunt fest, dass in dieser Situation nun seine ganze Libido allein Österreich-Ungarn gehöre.
Längerfristige Ursachen
Zweifellos ist es weiterhin sinnvoll, nach den Ursachen dieser Begeisterung für den Krieg zu fragen. Antworten wird man auf unterschiedlichen Ebenen finden können. Zum einen geht es dabei um längerfristig wirksame Prägungen, die den Krieg als ein wünschenswertes Ereignis erscheinen lassen konnten. Hier sind vor allem die ideologischen und sozialen Wirkungen des Nationalismus, des Sozialdarwinismus und der sozialen Militarisierung des gesellschaftlichen Lebens in Rechnung zu stellen, die für das wilhelminische Deutschland dazu geführt haben, von der Ausprägung einer weit verbreiteten Kriegsmentalität auszugehen. Auf indirekte Weise konnte aber auch die im Bildungsbürgertum insgesamt, vor allem aber in der bürgerlichakademischen Jugend aller europäischer Länder mehr oder weniger deutlich ausgeprägte kulturpessimistische Grundhaltung dazu führen, im Krieg die Möglichkeit zum Ausbruch aus einer als inhaltsleer, verwaltet und lebensarm begriffenen, von den Vätern beherrschten Gesellschaft zu sehen. Dementsprechend wurden die frühen, in der letzten Juliwoche 1914 um sich greifenden Demonstrationen für den Krieg vor allem von Studenten und Gymnasiasten getragen, die darin offensichtlich die Möglichkeit zu einem aufregenden Abenteuer, zur „großen Kriegsfahrt“ sahen, wie es in Analogie zur sommerlichen „großen Fahrt“ im Titel einer Publikationsreihe mit Feldpostbriefen von Wandervögeln hieß.
Erregung, Anspannung und Erlösung
Zum Zweiten sind aber auch die unmittelbaren Zusammenhänge des Kriegsbeginns in Rechnung zu stellen. Die sich in der letzten Juliwoche überschlagenden Meldungen über die Zuspitzung des europäischen Konfliktes riefen in der Öffentlichkeit, besonders in den großstädtischen Zentren eine wachsende Unsicherheit und immer schwerer erträgliche Anspannung hervor, so dass die Entscheidung für den Krieg am Ende oft als eine Befreiung erfahren werden konnte. „Na endlich!“, so beschrieb die „Tägliche Rundschau“ die Reaktion der wartenden Menschenmassen auf die Erklärung des Zustands drohender Kriegsgefahr. „Wie ein Erlösungsschrei geht's durch die Menge. Kein Jubel wird laut, kein Hoch wird laut, alle Mienen sind ernst – die unheimliche Spannung, die auf ganz Berlin lastet, löste sich in einem befreiten Aufatmen: Also doch!