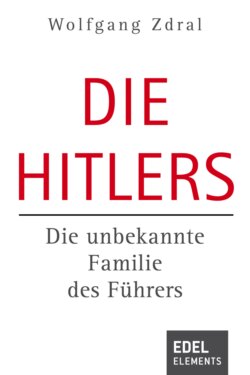Читать книгу Die Hitlers - Wolfgang Zdral - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dubiose Herkunft des Stammvaters Alois
ОглавлениеAlois kam im Juni 1837 in Strones bei Döllersheim als uneheliches Kind zur Welt. Das war in ländlichen Gegenden wie dem Waldviertel damals durchaus keine Seltenheit, auch wenn die das bäuerliche Leben bestimmende katholische Kirche solcherlei Sündhaftigkeit verdammte. Die Mutter Maria Anna Schicklgruber, Tochter eines mittellosen Kleinbauern, war mit ihren 42 Jahren für die damalige Zeit außergewöhnlich alt für eine Erstgeburt und außerdem allein stehend. Sie weigerte sich, den Namen des Erzeugers preiszugeben, so blieb die entsprechende Spalte des Taufbuches leer.
Adolf Hitlers Vater verbrachte die ersten Jahre am Hof der Schicklgrubers. Mit fünf Jahren bekam sein Leben eine neue Richtung: Die Mutter heiratete den 50-jährigen Johann Georg Hiedler, einen herumziehenden Müllergesellen. War es Geldnot oder die Ablehnung des Stiefvaters – jedenfalls schickte Maria Anna ihren Alois zum Bruder des Ehemanns, einen wohlhabenden Landwirt namens Johann Nepomuk Hüttler, der nur wenige Kilometer entfernt in Spital wohnte. Wie sich zeigte, sollte der Bub dort nun ein neues Heim finden. Schon bald wandelte sich das Provisorium in ein Ersatz-Elternhaus, und als Alois zehn Jahre alt war, starb seine Mutter. Nepomuk kümmerte sich um Alois wie um einen Sohn, sorgte für seinen Lebensunterhalt, schickte ihn zur Schule und ermöglichte ihm eine Lehre bei einem Schuhmacher in Wien.
Eigentlich schien das Leben des jungen Alois vorgezeichnet, so wie es in seiner Generation für Tausende junger Menschen üblich war: Einen Beruf erlernen, in die Heimat zurückkehren, heiraten, Kinder bekommen und versuchen, sein Leben ruhig und behaglich einzurichten. In der Regel blieben die Menschen innerhalb ihres sozialen Umfeldes, ein Ausbrechen aus den Schranken der Unterschicht oder unteren Mittelschicht war nur in Ausnahmefällen möglich. Mangelnde Bildung, fehlendes Kapital und das ausgeprägte Standesdenken jener Zeit legten jedem enge Fesseln an. Alois jedoch nutzte in Wien eine Karrierechance: Die Zollbehörden rekrutierten Nachwuchskräfte auch aus ländlichen Gebieten; Alois, voller Entschlossenheit und Durchsetzungswillen, wohl auch durchtränkt von Abenteuerlust und Risikofreude, griff sofort zu. Als 19-Jähriger begann er seine Ausbildung bei der österreichischen Finanzbehörde. Mit seinem Volksschulabschluss und dem bescheidenen sozialen Hintergrund war der junge Mann damals sicher nicht der Idealkandidat für die Beamtenlaufbahn, sein Risiko zu scheitern hoch. Aber Alois biss sich durch, bildete sich in Eigenregie weiter und war unerwartet erfolgreich. Genau 40 Jahre sollte er als Zöllner arbeiten, bis er im Jahr 1895 vorzeitig pensioniert wurde, gesundheitlich angeschlagen, »wegen der durch das staatsärztlich bestätigte Zeugnis nachgewiesenen Untauglichkeit zur ferneren Dienstleistung«, wie es in der amtlichen Mitteilung zu seinen Ruhestandsbezügen heißt.
Eines der wenigen erhaltenen handschriftlichen Dokumente Alois’ ist eine Eingabe an die Finanzdirektion Linz, in der er kurz nach der Pensionierung um die Rückgabe seiner Dienstkaution bittet. Das Schriftstück spiegelt in seinem devoten Tonfall und der gestelzten Wortwahl den typischen Beamten der Donaumonarchie wider. Darin heißt es:
»Hohe k.k. Finanz-Direktion!
Der ehrfurchtsvoll Gefertigte wurde mit dem hohen Dekrete vom 25. Juni 1895 in den dauernden Ruhestand versetzt.
Nachdem derselbe nicht verantwortlicher Rechnungsleger war, erlaubt er sich, um gnädige Erfolgslassung, beziehungsweise Devinkulierungsbewilligung seiner Dienstkaution, welche Eigentum des Johann Murauer, Hausbesitzer in der Theatergasse Nr. 7 zu Braunau a. Inn ist, ehrfurchtsvoll zu bitten.
Zu diesem Behufe überreicht derselbe in der Anlage ehrfurchtsvoll die auf dessen Namen als Dienstkaution vinkulierte Silberrente-Obligation per 900 Gulden neben I Stück Zinsenzahlungsbogen, sowie die Kassenquittung über die erlegte Barkaution per 200 Gulden.«3
Die Berufsjahre begleiten regelmäßige Beförderungen, die sonst nur Kollegen mit höherer Schulbildung erhalten. Alois dient sich als Amtsassistent hoch, später als Kontrolleur und wird schließlich Zollamtsoffizial. Sein Gehalt liegt am Ende der Dienstzeit bei 1100 Gulden jährlich, dazu addieren sich Ortszuschläge von 220 bis 250 Gulden. Selbst Schuldirektoren verdienen damals erheblich weniger. Mit einem Wort, Alois darf sich als Mitglied der Mittelschicht begreifen, sein Beruf verschafft ihm Autorität und Ansehen. Was der Emporkömmling mit seinem militärisch kurzen Haarschnitt, den buschigen Augenbrauen, dem sorgsam gepflegten Backenbart nach der Mode des Kaisers und durch seine Dienstuniform noch optisch unterstreicht. An eine Verwandte seiner Mutter schreibt er voller Stolz: »Seit Du mich vor 16 Jahren zuletzt gesehen hast, bin ich sehr hoch aufgestiegen.«4
Das neue Standesbewusstsein hat noch andere Konsequenzen: Im Jahr 1877 bricht Alois den Briefkontakt zur Schicklgruber-Sippe ab. »Der Vater hat sich um die Verwandtschaft nicht gekümmert«, berichtet später seine Tochter Paula. »Ich habe niemand von den Verwandten meines Vaters gekannt, so dass wir, meine Schwester Angela und ich, öfter gesagt haben: Wir wissen gar nicht, der Vater muss doch auch Verwandte gehabt haben.«5 Das Abkoppeln von der Schicklgruber-Linie setzte sich später fort: Die offiziellen Ahnenforscher des Nazi-Reiches ließen diese Verwandtschaftslinie des »Führers« völlig außen vor, selbst die Historiker beschäftigten sich lieber mit den Verwandtschaftsbeziehungen der Hiedlers, Pölzls und Koppensteiners. So verlieren sich die Nachfahren der Schicklgrubers bis heute im Nebel der Geschichte.
Mit der Abkehr von den eigenen Ursprüngen verschafft sich der Zollbeamte eine standesgemäßere Herkunft. Seinen alten Familiennamen legt er wie einen zu klein gewordenen Mantel ab und nimmt den Namen an, der durch seinen Sohn zum Inbegriff des Schreckens werden sollte: Hitler. Die Umstände dieser Namensänderung sind eines der merkwürdigsten Kapitel im Leben von Adolf Hitlers Vater.
Am 6. Juni 1876 erscheinen laut Legalisierungsprotokoll drei Zeugen und Alois Schicklgruber vor dem Notar Josef Penkner in Weitra und beurkunden, dass Alois der Sohn von Johann Georg »Hitler« sei. Am nächsten Tag wiederholt sich die Zeremonie vor Josef Zahnschirm, dem Pfarrer der Gemeinde Döllersheim. In das Geburtsbuch notierte der Geistliche, »dass der als Vater eingetragene Georg Hitler, welcher den gefertigten Zeugen wohl bekannt, sich als der von der Kindesmutter Anna Schicklgruber angegebene Vater des Kindes Alois bekannt und um die Eintragung seines Namens in das hiesige Taufbuch nachgesucht habe, wird durch die Gefertigten bestätigt: Josef Romeder, Zeuge, Johann Breiteneder, Zeuge, Engelbert Paukh, Zeuge.«6 Wahrscheinlich sind die drei Zeugen bei diesem zweiten Termin gar nicht mehr persönlich anwesend. Es reicht das Dokument des Notars, statt ihrer Unterschriften finden sich drei Kreuze auf dem Papier. Der Geistliche selbst unterlässt es, was unüblich ist, gegenzuzeichnen.
Fortan nennt sich Alois Schicklgruber also Alois Hitler. Die ungewohnte Schreibweise fällt sofort auf. Denn der Ehemann seiner Mutter nannte sich Hiedler und nicht Hitler. Sein Ziehvater Nepomuk trug den Namen Hüttler. All diese Namen entspringen demselben Wortstamm und bedeuten so viel wie Häusler oder Kleinbauer. Nun könnte schlicht ein phonetisches Missverständnis vorliegen, Notar Penkner hätte demnach den Namen nach der mündlichen Aussprache aufgeschrieben. Das geschah gar nicht selten: Die Brüder Georg und Nepomuk schrieben ihren Nachnamen ebenfalls unterschiedlich. Und auch Alois, wie er seinen Vornamen selbst notierte, war im Geburtsregister als »Aloys« eingetragen.
Aber »Hitler« war eine bewusste Wahl, denn Alois hat die falsche Schreibweise nie korrigieren lassen, was leicht möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich gefiel ihm die Idee, sich mit dieser Namensversion für alle sichtbar noch weiter von seiner Herkunft zu distanzieren. Als »Hitler« eröffnet er eine neue Linie des Stammbaumes, wie ein dynastischer Stammvater begründet er seinen eigenen Clan. Darin schwingt eine große Portion Eitelkeit mit, gepaart mit einer betonierten Überzeugtheit von der eigenen Person.
Was sich Alois damals nicht vorstellen konnte: Seine Idee einer eigenen Hitlerschen Linie sollte sich später in der ganzen Welt manifestieren – allerdings als Synonym für Verbrechen und Schreckensherrschaft. Das »Hitler« spricht sich auch anders aus, viel zackiger als das weiche Hiedler oder das bäurisch-bodenständige Schicklgruber – das als obligatorischer Gruß des Führers völlig undenkbar gewesen wäre. Dem Jugendfreund Kubizek gegenüber äußerte Adolf Hitler jedenfalls, wie froh er sei, dass sein Vater die hart klingende Namensversion gewählt hatte.
Das Ganze hat nur einen Haken: Die Namensänderung war illegal. Denn nach den damaligen Gesetzesvorschriften hätte entweder der Kindsvater selbst die Erklärung vor Notar und Pfarrer abgeben oder zumindest ein schriftliches Dokument hinterlassen haben müssen. Schließlich war der angebliche Vater Georg Hiedler zum Zeitpunkt der Namensänderung bereits 19 Jahre tot, die Mutter Maria Anna, die die Rechtmäßigkeit des Vorgangs ebenfalls hätte bezeugen können, lag schon 29 Jahre unter der Erde. Doch den Behörden schien die Angelegenheit nicht weiter wichtig, eine genauere Untersuchung unterblieb, die Änderung wurde einfach zu den Akten genommen – das notarielle Dokument war für die Obrigkeit Beweis genug.
Was bewegt einen 39-Jährigen, nach so langer Zeit in eine neue Identität zu schlüpfen? Dass er plötzlich seinen Familiensinn entdeckte und den letzten Wunsch von Georg Hiedler erfüllen wollte, ist auszuschließen. Dazu wäre bereits nach dessen Tod reichlich Gelegenheit gewesen, und die lange Wartezeit machte keinen Sinn. Auch der »Makel« seiner unehelichen Geburt hatte Alois all die Jahre weder gestört noch behindert. Für den Beruf war die Namensänderung ohne Belang, denn Alois war zu jener Zeit bereits unkündbar und hatte die ersten Stufen seiner Karriereleiter erklommen. Die Antwort liegt bei seinem Ziehvater Nepomuk. Der wollte sein Erbe regeln und Alois zum Hauptnutznießer bestimmen. Nepomuk hatte nur drei Töchter und keinen offiziellen männlichen Nachkommen. Deshalb war nach dem Tod seiner Ehefrau die Zeit reif, den Zögling Alois, auf den er so stolz sein konnte, als Erben für das Gros des Vermögens zu wählen und diesen Pakt mit der Namensänderung zu besiegeln.
Zwar fehlen aussagekräftige Dokumente über diese Erbschaftsregelung, aber nach dem Tode Nepomuks im Jahre 1888 fanden die anderen Kinder kein Vermögen mehr vor, während sich Alois, der selbst nur über ein bescheidenes Sparguthaben verfügt hatte, im selben Jahr plötzlich ein Bauernanwesen in Wörnharts bei Spital leisten konnte, das die stattliche Summe von über 4000 Gulden kostete. Es liegt also nahe anzunehmen, dass Nepomuk die finanziellen Dinge schon im Vorfeld geregelt hatte, wohl auch, um lästige Steuern zu umgehen – ein Verhalten, das auch in der heutigen modernen Zeit noch recht beliebt ist. Dazu passt der Schwindel, mit dem Nepomuk die Namensänderung von Alois in die Wege leitete, ganz gut. Die drei Zeugen, die Nepomuk auftrieb, waren nämlich alles Kumpel aus dem eigenen Umkreis: Josef Romeder war sein Schwiegersohn, Breiteneder und Paukh Verwandte. Es liegt auf der Hand, dass sich die vier vorher absprachen, um die überraschende Gedächtnisleistung glaubhaft zu machen, sich nach so vielen Jahren an die Aussage eines Verstorbenen zu erinnern, den die Zeugen allenfalls flüchtig kannten.
Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte Nepomuk noch bessere Gründe als diese, eine Namensänderung seines Ziehsohnes zu wünschen: Alles deutet nämlich darauf hin, dass in Wirklichkeit Nepomuk der Vater von Alois war, und nicht, wie vor Notar und Pfarrer angegeben, sein Bruder Georg. Die Indizien dafür sind zahlreich: Georg Hiedler heiratete Alois’ Mutter erst fünf Jahre nach dessen Geburt, es existieren keinerlei Hinweise darauf, dass der vagabundierende Müllergeselle bereits Jahre zuvor ein Verhältnis mit Maria Anna gehabt, geschweige denn, sich überhaupt im gleichen Dorf aufgehalten hatte. Wichtigstes Argument gegen die Vaterschaft Georgs: Er selbst hat Alois auch nach der Heirat mit Maria Anna nie nachträglich als Sohn legitimieren lassen, obwohl das üblich war. Selbst die Mutter, die bei der Geburt Alois’ den Erzeuger verschwiegen hatte, änderte daran nach der Hochzeit nichts, obwohl es das Natürlichste der Welt gewesen wäre, den gemeinsamen Sohn vor dem Gesetz in den Familienverbund aufzunehmen. Und schließlich kümmerte sich Georg Hiedler nach der Eheschließung auch nicht um seinen angeblichen leiblichen Sohn. Stattdessen gab die Mutter ihr einziges Kind zu – Nepomuk. Dort wuchs der Bub wohl behütet auf, angenommen wie der eigene Sohn und am Ende als Haupterbe begünstigt. Mangels eindeutiger Quellen kann die Frage nach dem Vater nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden. Viele Historiker halten die Vaterschaft Nepomuks jedoch für die wahrscheinlichste Variante.7
Das hätte allerdings eine fatale Konsequenz: »Adolf Hitler war das Produkt einer dichten Inzucht«,8 schreibt der Historiker Werner Maser. Denn Nepomuk Hüttler war demnach nicht nur Großvater von Adolfs Mutter Klara, die eine Tochter von Nepomuks Tochter Johanna war, sondern zugleich auch der Großvater Adolfs. Alois hätte also nicht nur, wie nach der offiziellen Lage der Dinge, eine Cousine zweiten Grades geheiratet, sondern sogar eine Enkelin seines Vaters. Derart enge verwandtschaftliche Beziehungen stehen nicht ohne Grund in den meisten Kulturen unter Inzesttabu und waren – bei aller Umdeutung, die der Begriff der Blutschande durch Hitlers Rassentheorien erfuhr – auch im späteren Nazideutschland verboten. Die Tatsache, dass vier der sechs Kinder Klaras offenbar eine schwächliche Konstitution hatten und früh verstarben, spricht für diese Inzestthese.
Hätte Alois seinen Namen nicht geändert und wäre es bei dem ursprünglichen »Vater unbekannt« geblieben, dann hätte Adolf Hitler pikanterweise selbst keinen Ariernachweis erbringen können, denn in seiner Geburtsurkunde hätte die Spalte für den Großvater väterlicherseits frei bleiben müssen. Adolf hatte also doppelt gute Gründe, seinem Vater für die Namenstrickserei dankbar zu sein und ebenso gute Gründe, allzu neugierige Nasen nicht in seiner Herkunft schnüffeln zu lassen. Sein Pech war nur, dass seine Heimlichtuerei um die Familie reichlich Nahrung für Mutmaßungen darüber gab, was er denn wohl zu verbergen hätte. Hitler-Gegner spekulierten immer wieder über angeblich »jüdisches Blut« in seinen Adern. Das Gerücht machte die Runde, ein jüdischer Kaufmann mit Namen Frankenberger sei der wirkliche Großvater Adolfs gewesen. Die Geschichtsschreibung hat diese These mittlerweile widerlegt. Immerhin nahm der NS-Herrscher die Spekulationen so ernst, dass er in den vierziger Jahren die Gestapo heimlich Nachforschungen über seinen Stammbaum anstellen ließ, doch die Recherchen brachten kein Ergebnis. Peinlich genau achtete Adolf Hitler daher darauf, dass die offizielle Propaganda immer Georg Hiedler als seinen Großvater nannte.