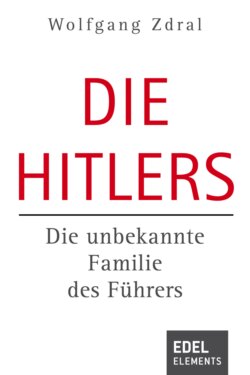Читать книгу Die Hitlers - Wolfgang Zdral - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auflösung der Familie
ОглавлениеDie Jahrhundertwende bringt für das Leben der Hitlers einschneidende Änderungen. Klaras Sohn Edmund stirbt im Februar. Ältester und einziger Sohn ist nun Adolf, auf seinen Schultern ruht ab jetzt die volle Last der elterlichen Erwartungen vom vorzeigbaren Stammhalter. Ob der Vater für ihn eine Beamtenlaufbahn vorgesehen hat, wie Hitler später immer wieder zum Besten gibt, ist zweifelhaft: »Ich sollte studieren ... Grundsätzlich war er aber der Willensmeinung, daß, so wie er, natürlich auch sein Sohn Staatsbeamter werden würde, ja müßte ... Der Gedanke einer Ablehnung dessen, was ihm einst zum Inhalt seines ganzen Lebens wurde, erschien ihm doch als unfaßbar. So war der Entschluß des Vaters einfach, bestimmt und klar, in seinen eigenen Augen selbstverständlich. Endlich wäre es seiner in dem bitteren Existenzkampfe eines ganzen Lebens herrisch gewordenen Natur aber auch ganz unerträglich vorgekommen, in solchen Dingen etwa die letzte Entscheidung dem in seinen Augen unerfahrenen und damit eben noch nicht verantwortlichen Jungen selber zu überlassen. Es würde dies auch als schlechte und verwerfliche Schwäche in der Ausübung der ihm zukommenden väterlichen Autorität und Verantwortung für das spätere Leben seines Kindes unmöglich zu seiner sonstigen Auffassung von Pflichterfüllung gepaßt haben.«21
Auf jeden Fall schickt Alois den widerstrebenden Sohn auf eine höhere Schule, die Staats-Realschule in Linz. Das bedeutet täglich einen Fußweg von jeweils einer Stunde hin und einer Stunde zurück und wenig Zeit für die dörflichen Spielkameraden. Auch ist Adolf in der neuen Klasse nicht mehr der tonangebende Mittelpunkt, wie er es aus Leonding gewohnt war. Schon bald müssen Klara und Alois sich Sorgen machen um ihren Jungen. Die schulischen Leistungen lassen nach; der Bub, dem bisher alles ohne Anstrengung zugefallen ist, hat es nicht so mit strebsamem Lernen. Am Ende des ersten Schuljahres passiert es auch schon: Adolf bleibt sitzen und muss die erste Klasse der Realschule wiederholen. Nach der damals üblichen Notenskala von eins »vorzüglich« bis fünf »nicht genügend« erhält der Schüler im sittlichen Betragen eine drei, in Fleiß eine vier, in Mathematik und Naturgeschichte jedoch eine fünf. Die Wiederholungsklasse schafft Adolf dann mit mittelmäßigen Noten.
Was sich zu Hause an Dramen wegen seines Versagens abgespielt haben mag, kann man sich leicht vorstellen: Der ehrgeizige, korrekte Vater, der seinen Sohn – zu Recht – wegen seiner Faulheit kritisiert, die Mutter, die sich um die Zukunft ihres letzten verbliebenen Sohnes Sorgen macht. Immerhin bedeutet es auch für die Eltern einige Entbehrung, die Summen für das mittägliche Kostgeld aufzubringen und den Junior länger auf der Tasche liegen zu haben.
In Mein Kampf stellt Hitler das Verhältnis zwischen Vater und Sohn als sich verschärfenden Konflikt zweier Menschen mit starkem Willen dar: »Zum ersten Male in meinem Leben wurde ich, als damals noch kaum Elfjähriger, in Opposition gedrängt. So hart und entschlossen auch der Vater sein mochte in der Durchsetzung einmal ins Auge gefaßter Pläne und Absichten, so verbohrt und widerspenstig war aber auch sein Junge in der Ablehnung eines ihm nicht oder nur wenig zusagenden Gedankens.«22
Sicher ist, dass das dominierende Familienoberhaupt überhaupt keinen Zweifel daran lässt, wer das Sagen hat. Widerspruch ist nicht erwünscht – weder von seiner Frau, noch von seinen Kindern. Wie selbstverständlich fordert er den unbedingten Gehorsam ein, den er selbst in seinem Dienst als Beamter gegenüber dem Staat gelernt hat. Alois’ vorherrschendes Erziehungsmittel sind Prügel. Das hat schon sein Ältester Alois junior zu spüren bekommen und nach dessen Weggang nun Adolf. Den trifft der Jähzorn des Vaters jetzt regelmäßig, die ängstliche, besorgte Mutter wagt nicht dazwischenzugehen. »Mein Bruder Adolf forderte meinen Vater zu extremer Strenge heraus und erhielt dafür jeden Tag eine richtige Tracht Prügel«, berichtet seine Schwester Paula. »Wie oft hat andererseits meine Mutter ihn gestreichelt und versucht, mit Liebenswürdigkeit das zu erreichen, was meinem Vater mit Strenge nicht gelang.«23 Klara wartet, krank vor Sorge, oft vor der Tür, wenn ihr Sohn drinnen verprügelt wird, wagt aber nicht einzugreifen. Adolf Hitler prahlt später gegenüber seiner Sekretärin Christa Schroeder: »Als ich eines Tages im Karl May gelesen hatte, dass es ein Zeichen von Mut sei, seinen Schmerz nicht zu zeigen, nahm ich mir vor, bei der nächsten Tracht Prügel keinen Laut von mir zu geben. Und als dies soweit war ... habe ich jeden Schlag mitgezählt. Die Mutter dachte, ich sei verrückt geworden, als ich ihr stolz strahlend berichtete: ›Zweiunddreißig Schläge hat mir Vater gegeben!‹« Zugleich gesteht Adolf ein, er habe »den Vater nicht geliebt, dafür aber um so mehr gefürchtet«24.
Der Konflikt Vater-Sohn erfährt ein unerwartetes Ende. Mitte August 1902 hat Alois einen Blutsturz, ausgelöst durch übermäßige Anstrengung beim Abladen von Kohlen im Keller. Der Senior ist zu dieser Zeit 65 Jahre alt. Er erholt sich rasch wieder, nimmt seine üblichen Gewohnheiten auf und tobt, weil sich Adolfs Leistungen in der Schule wieder verschlechtern. Nichts deutet auf etwas Besonderes hin, als Alois am Samstag, dem dritten Januar 1903, zu seinem routinemäßigen Wirtshausbesuch ins »Wiesinger« aufbricht. Kaum trinkt Alois den ersten Schluck aus seinem Weinglas, sackt er zur Seite. Die Angestellten tragen ihn ins Nebenzimmer und legen ihn auf eine Bank. Als Arzt und Priester eintreffen, können sie nur noch den Tod des Alois Hitler feststellen. Offizielle Todesursache: Lungenblutung. Zwei Tage später ist die Beerdigung auf dem Friedhof in Leonding, nur wenige Meter vom eigenen Haus entfernt. Die Linzer Zeitung Tagespost druckt am 8. Januar einen Nachruf. Bedenkt man, dass die Informationen in dem Artikel auf Angaben Klaras und seiner Arbeitskollegen beruhen und dass bekannterweise über Tote nur gut gesprochen wird, so umschreiben selbst diese Zeilen kaum verhüllt den Charakter Alois’: »Fiel ab und zu auch ein schroffes Wort aus seinem Munde, unter der rauhen Hülle verbarg sich ein gutes Herz. Für Recht und Rechtlichkeit trat er jederzeit mit aller Energie ein. In allen Dingen unterrichtet, konnte er überall ein entscheidendes Wort mitreden. Nicht zum wenigsten zeichneten ihn große Genügsamkeit und ein sparsamer, haushälterischer Sinn aus.« Auf gut Deutsch: ein schimpfender Besserwisser und Geizhals, der seine Familie kurz hält.
Für Klara wurde es damit leichter und schwerer zugleich. Der Quälgeist war tot, ein Quell des Leids versiegt. Damit aber gab es niemanden mehr, der den jungen Adolf hätte in Zaum halten können. Denn die Mutter war mit dem Heranwachsenden zunehmend überfordert. Der Jüngling zeigte sich in der Schule immer fauler, nutzte den Tag für seine eigenen kleinen Ausflüge und führte sich zunehmend renitent und launenhaft auf. Wie Freunde und Verwandte übereinstimmend berichten, war Klara zu gutmütig und zu wenig durchsetzungsfähig. Sie zeigte zwar eine geradezu überbordende Gluckenhaftigkeit und Zuneigung zu ihrem ältesten Kind, immer durchzogen von Angst und Verzagtheit, andererseits verstand sie es nicht, ihre mütterliche Hingabe in konstruktive Bahnen zu lenken. Zudem war sie von den vielen alltäglichen Arbeiten im Haushalt in Beschlag genommen, sodass eine stärkere Kontrolle Adolfs ihr wohl auch aus Zeitmangel aus den Händen glitt.
Ihr Sohn zeigte in der Schule wieder Schwächen, die zweite Klasse schloss er in Betragen mit der Note drei, in Fleiß mit vier und in Mathematik mit der Note fünf ab. Erst mit einer Nachprüfung schaffte Adolf den Aufstieg in die nächste Klasse. Sein damaliger Klassenlehrer Dr. Eduard Huemer beschrieb Adolf Hitler im Jahre 1924 anlässlich des Gerichtsverfahrens, bei dem sich sein früherer Schützling wegen des fehlgeschlagenen Putsches und des Marsches auf die Feldherrenhalle zu verantworten hatte: »Ich erinnere mich ziemlich gut des hageren, blassen Jungen, der täglich zwischen Linz und Leonding hin und her pendelte. Er war entschieden begabt, wenn auch einseitig, hatte sich aber wenig in der Gewalt, zum mindesten galt er für widerborstig, eigenmächtig, rechthaberisch und jähzornig, und es fiel ihm sichtlich schwer, sich in den Rahmen einer Schule zu fügen. Er war auch nicht fleißig, denn sonst hätte er bei seinen unbestreitbaren Anlagen viel bessere Erfolge erzielen müssen. Hitler war nicht nur ein flotter Zeichner, sondern er wusste auch in den wissenschaftlichen Fächern Entsprechendes zu leisten, nur pflegte seine Arbeitslust sich immer rasch zu verflüchtigen. Belehrungen und Mahnungen seiner Lehrer wurden nicht selten mit schlecht verhülltem Widerwillen entgegengenommen.«25
Adolf brachte immer schlechtere Noten von der Realschule mit nach Hause und bereitete Klara ständig Sorgen. In der dritten Klasse überreichte er seiner Mutter ein Abschlusszeugnis, in dem es wieder von deprimierenden Zensuren wimmelte. Der Fleiß war »ungleichmäßig«, in Französisch stand ein »nicht genügend«. Die Nachprüfung und Versetzung war nur unter der Bedingung möglich, dass Klara ihren Sohn aus der Linzer Realschule nahm. Die Mutter ging darauf ein, ihr Wunsch, dem Sohn eine bessere Ausbildung zukommen zu lassen, war ungebrochen. Dabei hätte es ihr bei mehr Weitblick klar sein müssen, dass Adolfs schwache Leistungen für eine höhere Schule nicht reichten. Doch Klara nahm einen neuen Anlauf und schickte den unwilligen Sohn auf die Realschule nach Steyr, wo er die vierte Klasse besuchte. Da an ein tägliches Nachhausekommen wegen der Entfernung nicht mehr zu denken war, bezahlte Klara ihrem Ältesten Unterkunft bei dem Steyrer Kaufmann Ignaz Kammerhofer und dem Gerichtsbeamten Conrad Edler von Cicini. Klaras Engagement für die schulische Zukunft ihres Sohnes blieb jedoch vergebens. Als er seiner Mutter das Zeugnis der vierten Klasse vorlegte, war die Katastrophe besiegelt: Adolf hatte das Klassenziel wieder nicht erreicht, all die Liebesmüh war umsonst gewesen. Die letzten Zensuren des Adolf Hitler:
| Sittliches Betragen Fleiß Religionslehre Deutsche Sprache Geographie, Geschichte Mathematik Chemie Physik Freihandzeichnen Turnen Stenographie | befriedigend (3) ungleichmäßig (4) genügend (4) nicht genügend (5) genügend (4) nicht genügend (5) genügend (4) befriedigend (3) lobenswert (2) vorzüglich (1) nicht genügend (5) |
In zwei Fächern reichte es also nicht zum Vorrücken. Die Note fünf in Steno zählte dabei nicht, das war nur Wahlfach. Die Hoffnungen, die Klara in ihren Sohn gesetzt hatte, waren endgültig zerstoben. Sollte sie Adolf nochmals die Klasse wiederholen lassen? Ihre Lebensumstände hatten sich erneut gewandelt: Stieftochter Angela hatte im Jahr 1903 den Beamten Leo Raubal geheiratet, das Haus in Leonding verlassen und war nach Linz gezogen. Die Immobilie in Leonding schien nunmehr zu groß, auch konnte Klara zusätzliches Einkommen gebrauchen. Sie verkaufte das Anwesen deshalb im Juni 1905 und zog in eine Mietwohnung in Linz in der Humboldtstraße 31. Die Wohnung im dritten Stock hatte eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Kabinett. Damit blieben Klara unterm Strich über 6 000 Kronen, die als Geldanlage weitere Zinsen abwarfen und die Haushaltskasse neben der Witwenpension zusätzlich füllten. Überdies steuerte Schwester Johanna aus ihrem Vermögen eine Art Wohngeld von knapp 50 Gulden monatlich bei, ein hoher Betrag, der ein Mehrfaches der ortsüblichen Mieten war und als Unterstützung der Verwandten zu sehen ist.
Die Entscheidung über die weitere Schulkarriere Adolfs beeinflusste dieser mit geschickter Schauspielerei. Eine Erkältung mit Husten bauschte Adolf theatralisch zu einer Lungenkrankheit auf, was Klara einen gehörigen Schrecken einjagen musste, waren doch bereits vier ihrer Kinder vorzeitig an Krankheit gestorben. Hitler verklärte in Mein Kampf seinen Boykott: »Da kam mir plötzlich meine Krankheit zu Hilfe und entschied in wenigen Wochen über meine Zukunft und die dauernde Streitfrage des väterlichen Hauses: Mein schweres Lungenleiden ließ einen Arzt der Mutter auf das dringlichste anraten, mich später unter keinen Umständen in ein Bureau zu geben. Der Besuch der Realschule mußte ebenfalls auf mindestens ein Jahr eingestellt werden. Was ich so im stillen ersehnt, für was ich immer gestritten hatte, war nun durch dieses Ereignis fast von selber Wirklichkeit geworden.«26 Bloß kann sich keiner der Zeitzeugen an eine solche Krankheit erinnern, was die Einlage als Geflunker entlarvt.
Klara glaubt den Symptomen, fährt mit ihrem Sohn mit der Bahn zur Erholung zu den Schmidts, ihren Verwandten im Waldviertel, Nachkommen aus dem Zweig Nepomuks. Am Bahnhof Gmünd holt der Onkel Mutter und Sohn mit einem Ochsengespann ab und bringt sie nach Spital. Dort auf dem Lande, der Heimat seiner Vorfahren, durchlebt Adolf angenehme Ferienwochen: ein Arzt kümmert sich um ihn, er isst reichlich, trinkt viel Milch, zeichnet und tollt durch die Gegend. Die Feldarbeit der Schmidts dagegen lässt ihn unberührt, er nimmt daran lediglich als Zuschauer teil – ein Affront gegen die Gastfreundschaft seines Onkels und seiner Tante, die gerade in ihrer Landwirtschaft jede helfende Hand gebrauchen können und für die gegenseitige Unterstützung unter Verwandten und Freunden selbstverständlich ist.
Nach dem Urlaub auf dem Lande holt Klara ihren Sohn in ihre neue Wohnung in Linz. Das Thema Schule ist erledigt. Ihr Liebling erhält für sich allein das Kabinett, einen kleinen abgetrennten Raum – Mutter, Tochter Paula und die Hanni-Tante teilen sich zum Schlafen das Wohnzimmer. Die zwei Frauen kümmern sich auch weiterhin um die täglichen Arbeiten wie Einkaufen, Putzen oder Kochen. Wie für alle Eltern steht nun die Frage an, was aus dem Sprössling werden soll. Alle Hoffnungen auf eine Beamtenlaufbahn sind geschwunden. Der Schulabbruch begrenzt die Möglichkeiten zur Berufswahl weiterhin. Der 16-jährige Bub ist in derselben Situation wie Tausende seiner Altersgenossen: Eine praktische Ausbildung oder Lehre wäre jetzt das Mittel der Wahl, um endlich auf eigenen Füßen zu stehen. Nicht so für Adolf. Er liegt seiner Mutter mit seinen Plänen für eine künstlerische Laufbahn in den Ohren. Am liebsten sieht sich der Jugendliche als Maler. Dem Wunsch folgen jedoch keine Taten. Weder probiert er einen Ausbildungsplatz zu bekommen, noch tritt er einer Malschule bei oder meldet sich – zu der Zeit – für die Aufnahmeprüfung einer Kunstakademie an.
Obwohl Freunde und Schwiegersohn Leo Raubal sie bedrängen, ihren Adolf zum Start ins Berufsleben zu bewegen, zeigt sich Mutter Klara nachgiebig. Ihr Ältester darf seinen künstlerischen Neigungen frönen, ohne durch eigene Arbeit zum Unterhalt der Familie beitragen zu müssen. Im Gegenteil, Klara öffnet immer wieder ihre Geldbörse, um auch die extravagantesten Wünsche des Heranwachsenden zu erfüllen. Im Sommer 1906 zahlt Klara ihrem Sohn eine mehrwöchige Reise nach Wien, die er ausgiebig für Besuche von Oper und Museen nutzt, einen Ausbildungsplatz organisiert er nicht. Als der Junior plötzlich den Drang zum Musizieren in sich verspürt, kauft ihm die Mutter einen Flügel und finanziert Klavierunterricht bei einem ehemaligen Militärmusiker. Nach vier Monaten hat Adolf die Lust am Klavierspielen verloren und widmet sich stattdessen tagsüber wieder dem Zeichnen, vor allem entwirft er phantastische Baupläne für die Stadt Linz. Er geht spät ins Bett und schläft sich lang aus – das »Muttersöhnchen«, wie Adolf Hitler sich selbst später beschreibt, genießt »die Hohlheit des gemächlichen Lebens« und »die glücklichsten Tage, die mir nahezu als ein schöner Traum erschienen«.27 An eine feste Arbeit zu denken, liegt ihm hingegen fern.
Da er seine musischen Kenntnisse steigern will, erlaubt Klara ihrem Adolf, Mitglied der Bücherei des Volksbildungsvereins und des Musealvereins zu werden und steckt ihm regelmäßig Geld zu für Theaterkarten in Linz. Auch die Hanni-Tante bessert regelmäßig das Taschengeld des Jünglings mit Beträgen zwischen 20 Hellern und mehreren Kronen auf, wie es penibel das Hitlersche Haushaltsbuch auflistet. Für 50 Heller kann sich Adolf ein Billet für ein Militärkonzert oder für einen Stehplatz im Landestheater in der dritten Galerie, der billigsten Kategorie, kaufen. Eintritt in Varieté-Vorstellungen oder Liederabende in Gasthäusern ist bereits für zehn Heller zu haben. Mit Vorliebe besucht der Sohn Wagner-Aufführungen. Dort trifft er auch seinen einzigen Freund dieser Zeit, August »Gustl« Kubizek, den Sohn eines Linzer Polsterers, der selbst nicht die Werkstatt seines Vaters übernehmen will, sondern auf eine Karriere als Musiker hofft. Die beiden sind vom Winter 1905/06 bis Sommer 1908 zusammen. Oft besucht Gustl die Hitlers in ihrer Wohnung in der Humboldtstraße. Er skizziert die Unterkunft: »Die kleine Küche mit den grüngestrichenen Möbeln besaß nur ein Fenster, das auf die Hofseite ging. Das Wohnzimmer ... wies zur Straßenseite. An der seitlichen Wand hing das Bild des Vaters, ein eindrucksvolles, seiner Würde bewusstes Beamtengesicht, dessen etwas grimmiger Ausdruck durch den sorgsam gepflegten Kaiserbart gemildert war.«28
Klara ist froh, dass ihr eigenbrötlerischer Sohn einen Freund und Gesprächspartner gefunden hat, mit dem er gemeinsame Interessen teilt. »Wie oft hat sie sich vor mir die Sorgen, die ihr Adolf bereitete, von Herzen geredet! Wie hoffte sie, an mir einen Helfer gefunden zu haben, um ihren Sohn auf die vom Vater gewünschte Bahn zu bringen«, erinnert sich Kubizek. »Ich musste sie enttäuschen. Doch sie nahm es mir nicht übel; denn sie ahnte wohl, dass die Ursachen für Adolfs Verhalten viel tiefer lagen und gänzlich außerhalb meiner Einflussmöglichkeit blieben.«29 Adolfs Freund bleibt nicht verborgen, dass Klara Hitler wesentlich älter aussieht als auf ihrem Jugendfoto. Das ergraute Haar, »das still getragene Leid, das aus ihren Zügen sprach« und das »ernste Antlitz« zeigen deutliche Spuren von Mühsal und Frustration. »So oft ich vor ihr stand, empfand ich immer, ich weiß nicht wieso, Mitleid und hatte das Bedürfnis, ihr etwas Gutes zu tun«, fährt er fort.
In Kubizek, der fast ein Jahr älter war als Adolf, fand die Witwe Klara Hitler einen Zuhörer, der Verständnis für ihre Probleme aufbrachte. Dennoch ist die Gesprächssituation ungewöhnlich: Eine Frau Mitte 40 beichtet ihre Sorgen einem Teenager – normalerweise ist es gerade anders herum. Und trotz der vielen Besuche war Kubizek für sie ein Fremder. Offenbar fehlten ihr Bezugspersonen aus der Verwandtschaft, mit denen sie offen über Familiendinge hätte reden können. »Die unbestimmten, für die Mutter nichtssagenden Äußerungen, die Adolf über seine Zukunft als Künstler machte, konnten diese begreiflicherweise nicht befriedigen. Die Sorge um das Wohl des einzigen am Leben gebliebenen Sohnes verdüsterte immer mehr ihr Gemüt«, so Kubizek. »Unser guter Vater hat im Grabe keine Ruhe«, pflegte sie zu Adolf zu sagen, »weil du absolut nicht nach seinem Willen tust. Gehorsam ist die Grundlage für einen guten Sohn. Du aber hast keinen Gehorsam. Deshalb bist du auch in der Schule nicht weitergekommen und hast kein Glück im Leben.«30 Den Klagen folgten jedoch keine Taten, die Mutter bezahlte das Faulenzerleben ihres Sohnes duldsam weiter und brachte nicht die Kraft auf, ihn zur Arbeit zu bewegen.
Die Schwäche Klara Hitlers manifestiert sich im Winter 1906/07 auch äußerlich. Sie klagt über Schmerzen, wirkt blass und kränklich, geht in die Sprechstunde ihres jüdischen Hausarztes Dr. Eduard Bloch. Die Diagnose des Arztes lautet: bösartige Geschwulst im kleinen Brustmuskel – vulgo Brustkrebs. Bereits vier Tage später, am 18. Januar 1907, wird Klara im Linzer Krankenhaus eine Stunde lang operiert und der Tumor entfernt. Sie muss 20 Tage im Krankenhaus das Bett hüten, sodass die Behandlung die Haushaltskasse insgesamt mit 100 Kronen belastet – Krankenversicherungen gibt es noch nicht. Bloch eröffnet dem 17-jährigen Adolf und seiner elfjährigen Schwester Paula, dass ihre Mutter trotz des Eingriffes schwer krank ist, das fortgeschrittene Stadium des Brustkrebses lässt nur auf geringe Überlebenschancen hoffen.
Klara Hitler zeigt sich das erste Mal sichtlich angeschlagen. Das Gehen und Treppensteigen fällt ihr schwer. So beschließt sie im Mai, die Wohnung im dritten Stock in Linz aufzugeben und nach Urfahr umzuziehen, einem Ort auf der anderen Seite der Donau. Die Familie wohnt zuerst in der Hauptstraße 46, wechselt aber nach 14 Tagen wieder und nimmt eine Wohnung in der Blütengasse 9. Das Domizil liegt im ersten Stock und verfügt über drei Zimmer. »Mein Haupteindruck von der einfach möblierten Wohnung war ihre Sauberkeit. Es glänzte: kein Stäubchen auf Stühlen oder Tischen, kein einziger Schmutzfleck auf dem gescheuerten Boden, keine Schmierspur an den Fensterscheiben. Frau Hitler war eine hervorragende Hausfrau«, berichtet Dr. Bloch.31 Er untersucht sie nochmals Anfang Juni. Trotz der angeschlagenen Gesundheit verbeißt sich die Frau in ihre Arbeit und versucht, auch weiterhin ihre Rolle als Mutter voll auszufüllen.
Obwohl sie sicher Hilfe braucht, kann sie nur auf ihre Schwester, die Hanni-Tante, zählen. Auf ihren fast erwachsenen Sohn Adolf dagegen kann sie nicht bauen. Der bringt die Mutter dazu, ihn nochmals nach Wien reisen zu lassen, diesmal, um an der Akademie für Bildende Künste in Wien ein Kunststudium zu beginnen. Obwohl der Sohn um den schlechten Gesundheitszustand seiner Mutter weiß, reist er Anfang September 1907 nach Wien, im Koffer einen Packen seiner Zeichnungen und Gemälde. In der Stumpergasse 31 in Wien nimmt sich der 18-Jährige ein Zimmer zur Untermiete.
Vor dem Studium ist die Hürde der Aufnahmeprüfung zu bewältigen. Adolf Hitler ist einer von 112 Aspiranten auf einen Studienplatz, seine Arbeitsproben reichen aus, ihn wie 33 andere zur zweiten Auswahlrunde, dem Probezeichnen, vorzulassen. Die Prüfung findet am 1. und 2. Oktober 1907 statt. Die Kandidaten müssen verschiedene Kompositionsaufgaben lösen, zum Beispiel »Rückkehr des verlorenen Sohnes«, »Trauer«, »Regen«, »Herbst« oder »Wahrsagerin«. Das Professorenkollegium der Akademie lässt Hitler durchfallen. Begründung: »Probezeichnung ungenügend, wenig Köpfe«.