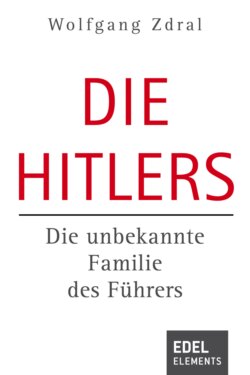Читать книгу Die Hitlers - Wolfgang Zdral - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Clanchef Alois und die Frauen
ОглавлениеAlois Schicklgruber/Hitler pflegte ein Triebleben, das im 19. Jahrhundert sicher nicht die gesellschaftliche Norm darstellte und auch mit den Sitten auf dem Lande kaum zu erklären ist. Er wird im Alter von 30 Jahren als Vater eines unehelichen Kindes ausgemacht, eines Mädchens Therese oder Theresia, entstanden aus einem Verhältnis mit einer gewissen Thekla P., ohne dass die Erstgeborene bislang von den Historikern genau identifiziert werden konnte. Im Jahre 1873 ehelicht er Anna Glassl, eine wohlhabende Beamtentochter aus Braunau am Inn. Bräutigam Alois ist 36 Jahre alt, hat sich also erst relativ spät entschlossen, vor den Traualtar zu treten. Seine Frau Anna jedoch ist noch weit älter, nämlich bereits 50 und nicht mehr bei bester Gesundheit. Anna ist so wohlhabend, dass sich die beiden ein Dienstmädchen leisten können. Das Vermögen der Braut scheint für ihn denn auch der Heiratsgrund zu sein: Der Altersunterschied von 14 Jahren zwischen den Eheleuten spricht gegen eine romantische, feurige Liebe. Wegen Annas Alter entfällt selbst das Motiv, eine Familie zu gründen. Zudem beweist Alois später, wann er wirklich schwach wird: bei jungen Frauen, die seine Töchter sein könnten.
Das soll Anna schon bald klar werden. Während sie immer mehr kränkelt, beginnt Alois ein Verhältnis mit der 24 Jahre jüngeren Franziska Matzelsberger, genannt Fanni, einem Mädchen aus dem Ort Weng im Innkreis. Fanni arbeitet als Magd im Gasthaus Streif in Braunau, dem Wohnsitz der Hitlers. Zu Beginn der Affäre ist das Mädchen 17, höchstens 18 Jahre alt – genau ist das nicht mehr feststellbar. Nach damaliger Rechtslage ist sie in jedem Fall eindeutig minderjährig. Um die Situation zusätzlich zu komplizieren, gehört zu der Zeit auch bereits die ebenfalls minderjährige Klara Pölzl dem Hitlerhaushalt an. Die 16-Jährige ist 1876 aus Spital gekommen, um bei der Pflege der kranken Ehefrau Anna zu helfen. Wobei unklar ist, ob Alois parallel zur Affäre mit Fanni auch schon etwas mit Klara anfängt.
Die am 12. August 1860 in Spital geborene Klara Pölzl ist die älteste Tochter des Kleinbauern Johann Baptist Pölzl und seiner Frau Johanna. Mutter Johanna wiederum ist eine Tochter von Nepomuk Hüttler, dem Ziehvater oder tatsächlichen Erzeuger von Alois. Der, mit Johanna wie ein Bruder aufgewachsen, ist offiziell Klaras Cousin, aber mit 23 Jahren Altersunterschied um so viel älter, dass sie ihn stets nur unterwürfig »Onkel« nennt. Dem Ruf des »Onkels« in die vergleichsweise große Stadt Braunau mag Klara gern gefolgt sein, versprach es doch eine erste Anstellung und eine aufregende Abwechslung zur Enge des Waldviertler Bauernhofes. Zweifellos verfehlten Alois und sein Respektsberuf seine Wirkung auf das unerfahrene, verschüchterte Mädchen nicht.
Die Bettgeschichte mit Fanni konnte in dem rund 3000 Einwohner zählenden Grenzort Braunau nicht lange verborgen bleiben. Die hintergangene Ehefrau Anna verlangt die Scheidung, im November 1880 erfolgt »die Trennung von Tisch und Bett«, wie der Vorgang damals in der österreichischen Doppelmonarchie hieß. Im Hitlerschen Ehebett liegt statt Anna nun Fanni. Die Beziehung ist das, was man später »wilde Ehe« nennen wird. Ihrem Instinkt folgend, verlangt Fanni, die neue Herrin, dass Klara Pölzl das Haus verlässt. Denn Fanni muss zu Recht befürchten, in der nur ein Jahr älteren Klara könne ihr eine Konkurrentin um die gute Partie Alois erwachsen. Klara kehrt nach Spital zurück, und Fanni bringt zwei Jahre später einen unehelichen Sohn zur Welt. Alois gibt ihm seinen eigenen Namen und legitimiert Alois junior nach der Hochzeit mit Fanni im Jahr 1883 – nur sechs Wochen nach dem Tod seiner ersten Frau Anna. Vor dem Traualtar ist die 22-jährige Fanni, für jeden unübersehbar, wieder hochschwanger. Trauzeugen spielen zwei Zollbeamte aus Simbach, dem bayerischen Ort auf der anderen Seite des Inns. Schon zwei Wochen später gebärt Fanni Tochter Angela. Gatte Alois ist 46 Jahre, als er zum ersten Mal legitimen Nachwuchs hat und sich an dessen Erziehung beteiligt.
Fanni Hitler erkrankt noch im selben Jahr schwer an Tuberkulose. Trotz ihres Widerstandes holt sich Alois wieder Klara Pölzl ins Haus: vordergründig, weil Klara bereits Erfahrung mit der Pflege von kranken Personen hat und ihm überdies den Haushalt führen kann. Doch dabei bleibt es natürlich nicht. Alois und Klara beginnen ein Verhältnis – die todgeweihte Fanni kümmert die beiden nicht. Fanni stirbt mit 23 Jahren im August 1884, etwa zur gleichen Zeit, als Klara von Alois schwanger wird. Die Erde auf dem Grab ist noch frisch, doch die beiden zögern nicht länger und beschließen sofort zu heiraten – Trauerfall hin oder her. Was nicht gerade von besonderer Feinfühligkeit des heimlichen Liebespaares zeugt. Doch so einfach funktioniert der Plan nicht.
Die verwandtschaftliche Beziehung macht ihnen nämlich einen Strich durch die Rechnung. Auf dem Papier sind Alois Hitler und Klara Pölzl Vetter beziehungsweise Cousine zweiten Grades. Da dürfen sie nur mit kirchlicher Sondergenehmigung heiraten. Wobei sie das Glück haben, dass niemand um die mögliche Vaterschaft Nepomuks weiß – unter solchen Voraussetzungen wäre eine Ehe überhaupt nicht möglich gewesen. Die Heiratswilligen müssen deshalb offiziell bei der Kirche um Dispens nachsuchen. Sie schreiben an die kirchlichen Stellen in Linz:
»Die in tiefster Ehrfurcht Gefertigten sind entschlossen, sich zu ehelichen. Es steht aber denselben laut beiliegendem Stammbuch das kanonische Hindernis der Seitenverwandtschaft im dritten Grad berührend den zweiten entgegen. Deshalb stellen dieselben die demütige Bitte, das Hochwürdige Ordinariat wolle ihnen gnädigst die Dispens erwirken, und zwar aus folgenden Gründen:
Der Bräutigam ist laut Totenschein seit 10. August dieses Jahres Witwer und Vater von zwei unmündigen Kindern, eines Knaben von zweieinhalb Jahren (Alois) und eines Mädchens von einem Jahre und zwei Monaten (Angela), für welche er notwendig einer Pflegerin bedarf, um so mehr, da er als Zollbeamter den ganzen Tag, oft auch nachts, vom Hause abwesend ist und daher die Erziehung und Pflege der Kinder nur wenig überwachen kann. Die Braut hat die Pflege der Kinder bereits nach dem Tode der Mutter übernommen und sind ihr selbe sehr zugetan, so dass sich mit Grund voraussetzen lässt, es würde die Erziehung derselben gedeihen und die Ehe eine glückliche werden. Überdies hat die Braut kein Vermögen und es dürfte ihr deshalb nicht so leicht eine andere Gelegenheit zu einer anständigen Verehelichung geboten werden.
Auf diese Bitte gestützt, wiederholen die Gefertigten ihre demütige Bitte um gnädige Erwirkung der Dispens vom genannten Hindernis der Verwandtschaft.«9
Die Stelle in Linz leitet das Gesuch nach Rom weiter – und die Wochen bis zur schriftlichen Erlaubnis vergehen. Erst am 7. Januar 1885 können Alois und Klara den Bund der Ehe schließen, sie ist 24, er 47 Jahre alt. Die Trauung entspricht so gar nicht den romantischen Vorstellungen Klaras: »Um sechs Uhr früh haben wir in der Stadtpfarrkirche von Braunau geheiratet, und um sieben Uhr ging mein Mann schon wieder in den Dienst.«10 Keine Feier, kein fröhliches Essen, kein Umtrunk mit Freunden – nichts. Nicht einmal einen Tag Urlaub gönnt sich der Gemahl für diesen Festtag. Für ihn ist es bloß eine Formalie, er und Klara sind schon längst zusammen und haben intime Beziehungen, was die Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes Gustav fünf Monate später bezeugt.
Für Klara ist die neue Rolle als Ehefrau ungewohnt. Noch lange nennt sie ihren Ehemann »Onkel«, so wie sie es als Kind zu tun pflegte. Was findet sie an dem Mann, der ihr Vater sein könnte? Sicher spielt die materielle Sicherheit eine Rolle, die Alois mit seinem Einkommen bietet. Auch das Ansehen, das die Gattin eines Zollbeamten gerade auf dem Lande genießt, hat seine Reize. Doch andererseits weiß Klara durch die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre, auf wen sie sich da einlässt. Klara ist im Gegensatz zu ihrem Mann eine gläubige Katholikin, geht regelmäßig in die Kirche. Ihr Tagesablauf ist eine immer wiederkehrende Abfolge von Putzen, Kochen, Einkaufen und Kinderversorgen. Treffen mit Nachbarn oder Freundinnen bleiben selten, meist entzieht sie sich dem mit dem Satz »Hab’ leider keine Zeit, die Arbeit wartet«. Ihr unterwürfiges Wesen akzeptiert alle Kränkungen, die sie still hinunterschluckt. Sie wagt es kaum, ihrem Partner zu widersprechen und lässt sich nur äußerst selten auf eine offene Konfrontation ein.
Das hatte seine Gründe. Alois war herrisch, jähzornig und gewalttätig, wie später seine Kinder berichteten. Prügel waren an der Tagesordnung. Ob Klara auch darunter leiden musste, ist unklar. Geradezu wie ein Hinweis darauf und wie eine verdeckte Schilderung der eigenen häuslichen Verhältnisse lesen sich zwei Passagen Adolf Hitlers aus Mein Kampf: »Wenn dieser Kampf unter den Eltern selber ausgefochten wird, und zwar fast jeden Tag, in Formen, die an innerer Rohheit oft wirklich nichts zu wünschen übriglassen, dann müssen sich, wenn auch noch so langsam, endlich die Resultate eines solchen Anschauungsunterrichtes bei den Kleinen zeigen. Welcher Art sie sein müssen, wenn dieser gegenseitige Zwist die Form roher Ausschreitungen des Vaters gegen die Mutter annimmt, zu Misshandlungen in betrunkenem Zustande führt, kann sich der eben ein solches Milieu nicht Kennende nur schwer vorstellen.«
Adolf Hitler konnte es offenbar, er schreibt weiter: »Übel aber endet es, wenn der Mann von Anfang an seine eigenen Wege geht und das Weib, den Kindern zuliebe, dagegen auftritt. Dann gibt es Streit und Hader, und in dem Maße, in dem der Mann der Frau nun fremder wird, kommt er dem Alkohol näher.«11
Alois’ Vorliebe für Bier und Wein ist bekannt. Praktisch jeden Tag, nach der Arbeit im Büro, genehmigte er sich mehrere Gläser in einem Gasthaus, rauchte ununterbrochen seine Pfeife und führte Stammtischgespräche mit Kollegen, vorzugsweise über landwirtschaftliche Fragen. Ob und wie stark Alois danach betrunken war, berichten Zeugen von damals unterschiedlich. Sein Sohn Adolf jedenfalls, der ihn bisweilen dort abholte, schilderte Jahre später die Szenerie – wenn auch sicherlich bewusst dramatisierend – folgendermaßen: »Da mußt’ ich als zehn- bis zwölfjähriger Bub immer spätabends in diese stinkende, rauchige Kneipe gehen. Ich trat dann immer ohne jede Schonung auf, trat an den Tisch, wo mein Vater saß und mich stier anschaute, und rüttelte ihn. Dann sagte ich: ›Vater, du mußt jetzt heim! Komm jetzt, wir müssen gehn!‹ Und oft mußte ich gleich eine viertel oder halbe Stunde betteln, schimpfen, bis ich ihn endlich so weit hatte. Dann stützte ich ihn und brachte ihn heim. Das war die grässlichste Scham, die ich je empfunden habe.«12
Wohl schon aus dieser Zeit speiste sich Adolf Hitlers lebenslange Ablehnung des Alkohols.
Auch an den übrigen Tagen hatte es Alois nicht eilig mit der Rückkehr in den Kreis seiner Familie. Viel lieber machte er nach der Arbeit einen Spaziergang, schaute noch nach seinen Bienenstöcken, seinem einzigen Hobby. Einmal zog er gar für mehrere Monate in eine Wohnung in der Braunauer Altstadt, weil er von dort aus schneller bei seinen Bienenstöcken war. Freunde hatte er keine. Die einzigen, mit denen er nähere Kontakte pflegte, waren seine Kollegen Emanuel Lugert, der spätere Firmpate von Adolf, und Carl Wessely, den er seit 1878 kannte und regelmäßig zu Kneipenabenden traf. Kein Wunder: »Alois Hitler war uns allen unsympathisch. Er war sehr streng, genau, ja sogar Pedant im Dienst und ein sehr unzugänglicher Mensch«, beschreibt ihn ein Kollege.13
Belastend für die Familie sind die vielen Umzüge. In seinen 21 Dienstjahren in Braunau zieht der Hausherr mit seiner Familie vergleichsweise bescheidene viermal um, danach folgen innerhalb von sieben Jahren sechs Umzüge. Diese lassen sich nicht gänzlich mit den Pflichten seines Berufes erklären, darin reflektiert sich auch Rastlosigkeit und Getriebenheit, wohl auch innere Unzufriedenheit, »er war ein unruhiger Geist«, wie ein Kollege es nannte.
Die Unfähigkeit, sesshaft zu werden und zur Ruhe zu kommen, manifestiert sich zudem in den Immobilientransaktionen Alois’. Das Gehöft und Grundstück in Wörnharts, das er nach dem Tode Nepomuks kauft, veräußert er drei Jahre später schon wieder. Die Tradition der Waldviertler, sich auf eigenem Grund und Boden niederzulassen, lässt Alois kalt. Der Begriff Heimat hat für ihn keine Bedeutung, so etwas wie geographische Wurzeln kennt er nicht. Genauso wenig, wie ihm die eigene Familie eine Heimat ist. Als er 1895 in Pension geht, zieht es Alois weder zurück zu den Orten seiner Kindheit im Waldviertel noch in die Großstadt Wien, zu den Plätzen seiner Jugend. Auch den Grenzort Braunau hat er nicht ins Herz geschlossen, wo er mehr als 24 Jahre gelebt hat und der noch am ehesten als Heimat zu bezeichnen wäre – immerhin ließen sich von dort aus seine früheren Lebensstationen und Verwandten bequem aufsuchen. Stattdessen kauft Alois ein umfangreiches landwirtschaftliches Anwesen in Hafeld bei Lambach an der Traun. Dort versucht er nochmals, das Landleben zu genießen. Alois probiert eine Existenz als Hobby-Landwirt, im Prinzip die gleiche Idee, die moderne Aussteiger mit dem Bauernhof im Chiemgau oder dem Rustico in der Toskana verfolgen. Das Resultat war für Alois genauso verheerend wie für viele Quereinsteiger heutiger Zeit: Die Arbeit mit den 38 000 Quadratmetern Acker und Wiesen überforderte ihn, zudem fraß der Besitz mehr Geld als er brachte. Zwei Jahre später muss Alois das Abenteuer Landwirtschaft wieder aufgeben, er verkauft den Besitz und erwirbt stattdessen ein Wohnhaus mit kleinem Garten in der Michaelsbergstraße 16 in Leonding bei Linz – im Vergleich zu den einsamen Weilern zuvor ist das wie der Wechsel in eine Großstadt. Dies sollte Alois’ letzter Umzug bleiben.