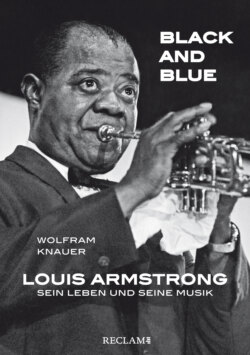Читать книгу Black and Blue - Wolfram Knauer - Страница 7
Erste musikalische Eindrücke
ОглавлениеÜberall war Musik in New Orleans, und Armstrong war schon als Kind davon begeistert. In einem Interview mit Richard Meryman sagte er 1966:
Als ich 4 oder 5 Jahre alt war, trug ich noch Kinderröcke und lebte mit meiner Mutter in der Jane Alley in einem Ort, den man Brick Row nannte – viel Zement, Mietzimmer, ein wenig wie ein Motel. Gleich um die Ecke auf der Perdido Street war die Funky Butt Hall – ein alter Schuppen, heruntergekommen, mit Löchern in den Wänden. An den Samstagabenden konnte meine Mutter uns nie finden, weil wir diese Musik hören wollten. Vor dem Tanz spielte die Band eine halbe Stunde vor dem Saal. Und wir Kinder legten unsere kleinen Tänze hin. Wenn ich jemals Buddy Bolden gehört habe, dann muss es dort gewesen sein.12
Buddy Bolden ist ein Stück Jazzlegende. Er war schon um die Jahrhundertwende ein in New Orleans gefeierter Kornettist, dem man nachsagte, er könne so laut spielen, dass man ihn noch auf der anderen Seite des Lake Pontchatrain hörte (der allerdings bei New Orleans etwa 38 Kilometer breit ist). Um 1905, also etwa zu der Zeit, von der Armstrong berichtet, war Bolden eine Berühmtheit in seiner Heimatstadt. Er spielte in den Kneipen der Stadt, bei Umzügen, privaten Festen, in Tanzsälen und Parks. Mehr und mehr aber hatte er Anflüge geistiger Umnachtung, und 1907 übernahm der Posaunist Frank Dusen seine Band. Bolden wurde in eine geschlossene Psychiatrie in Jackson, Louisiana, eingewiesen, wo er 1931 starb. Wie der Kornettist Bolden wirklich klang, ist nicht durch Tondokumente überliefert. Zeitgenossen lobten seinen Sound, seinen rhythmischen Drive, die emotionale Kraft seiner Musik, einen gewissen archaischen Ansatz, insbesondere im Vergleich zu den braveren Tanzkapellen der Stadt.13 Bolden hatte viele Musiker beeindruckt, unter ihnen die Kornettisten Freddie Keppard und Bunk Johnson, die ein wenig älter als Armstrong waren und Boldens Stil sehr bewusst auf ihre eigene musikalische Vorstellung übertrugen. Für Armstrong war das alles später eine Traditionslinie, in der er auch sich sah: »Ich denke immer an diese alten großartigen Cats in New Orleans – Joe (Oliver) und Bunk (Johnson) und (Lorenzo) Tio und Buddy Bolden – und wenn ich meine Musik spiele, dann höre ich sie. Sie haben immer so schön phrasiert, konzentrierten sich immer auf die Melodie«14. Was Armstrong allerdings aus dieser Tradition machte, wenn er sich später in seinen Hot Five und Hot Seven aus dem Kollektiv des New-Orleans-Ensembles löste, um mit seinem eigenen Solokonzept zu glänzen, das hat neben der Tradition auch etwas Zukunftsweisendes und ist neben Fortführung gewiss auch ein Bruch mit den Traditionen aus New Orleans.
Seine musikalische Karriere allerdings begann Armstrong erst einmal als Sänger. Schon als Junge hatte er Kohlen auf der Straße angepriesen: »Steinkohle, meine Damen, fünf Cents pro Wassereimer.« Die Verkaufsgesänge waren damals so üblich wie es hierzulande die Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt sind. Man hörte sie überall, wo Straßenhändler ihre Ware feilboten, Fisch, Wassermelonen, Obst, Gemüse, Shrimps, Holz oder eben Kohle. Man nennt diese Gesänge »street cries« oder »street hollers«, und sie werden zusammen mit den Worksongs, den Arbeitsgesängen auf den Plantagen also, und mit den Spirituals der schwarzen Kirchengemeinden als wichtige Vorformen der afroamerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts angesehen. Eine gewisse Archaik schwingt in ihnen mit, aber zugleich versuchten die Verkäufer auch etwas von ihrer eigenen Persönlichkeit in diese Ausrufe zu legen, weil sie ja Aufmerksamkeit erregen und die Konkurrenz übertönen sollten. »Stone cole, ladies, five cents a water bucket« also sang Louis Armstrong, seine Hände wie ein Sprachrohr an den Mund gelegt. Es gibt Feldaufnahmen solcher »street cries«, die in Intonation und Ausdruck ihre Verwandtschaft zum Blues deutlich machen.
Für Armstrong waren diese Klänge so vertraut wie die Dampforgel der Mississippi-Schaufelradboote. Mit einigen Freunden gründete er ein Vokalquartett, mit dem sie in der damals üblichen Barbershop-Manier auf der Straße auftraten. Das war damals nichts Außergewöhnliches; man konnte durchaus in einer Bar oder eben im Friseursalon (barber shop) Männer in vierstimmigen Gesang ausbrechen hören. Der Barbershop-Gesang war eine populäre Tradition, die insbesondere in den amerikanischen Südstaaten auch bei Afroamerikanern gepflegt wurde. Es handelt sich dabei um eine Art improvisierten Harmoniegesang, bei dem der erste Tenor (lead) die Melodie singt, der zweite Tenor einen Harmonieton darüber, der Bass die harmonische Basis legt und der Bariton die Harmonie auffüllt, mal unter-, mal oberhalb der Melodiestimme. Die Improvisation findet dabei also weniger in der Melodieerfindung statt als vielmehr im Entstehen immer neuer, spannender, »schöner« Zusammenklänge. Das ist durchaus vergleichbar den Gesangstraditionen in der schwarzen Kirche, nur konnten die Sänger im Quartett, im dichten Aufeinander-hören, noch viel weiter in ihren harmonischen Experimenten gehen als dies im Chor der Kirchengemeinde möglich gewesen wäre. Noch heute kann man die Tradition des Barbershop-Gesangs erleben, auf der Bühne genauso wie ab und an und nicht weniger improvisiert als zu Armstrongs Zeiten in der U-Bahn von New York oder Chicago.
Mit seinen Sängerfreunden ging Louis besonders gern ins Rotlichtviertel der Stadt, wo er von Zockern und Zuhältern bezahlt wurde, die die schwarzen Jungs als akustische Werbung für ihre jeweiligen Aktivitäten benutzten. Später erinnerte er sich an seine damals noch helle Stimme, mit der er den Tenorpart übernommen habe. Außerdem habe er die Slide Whistle (Kolbenflöte) gespielt,
ganz wie eine Posaune. Ich konnte die einzelnen Tonpositionen darauf genau fühlen. […] Nachdem wir gesungen hatten, reichten wir den Hut herum. Manchmal kriegten wir so einen ganzen Dollar am Abend. Meine Mutter, die die Wäsche einer weißen Familie in einer Zinnwanne über einem heißen Kohlenfeuer im Hof der Familie auf der Canal Street wusch, kriegte nicht mehr als einen Dollar am Tag. Das war gutes Geld damals.15
Für Armstrong war diese Quartetterfahrung jedenfalls eine wichtige musikalische Schule. Hier lernte er, auf andere zu hören. Hier lernte er, mit der Bluestonalität kreativ umzugehen. Hier lernte er, wie wichtig der Einsatz auch schauspielerischer Fähigkeiten sein konnte, um sein Publikum zu begeistern. Hier lernte er, wie man eine Melodie sicher phrasierte; hier lernte er eine Begleitstimme zu entwickeln, die harmonisch zur Melodie des Songs passt; hier lernte er eine Art der Intonation, die tief in afroamerikanischer Erfahrung verankert war. Vor allem aber lernte er, improvisatorisch im Ensemble seinen eigenen Ton zu finden, einen Ton, der sich in das Zusammenspiel aller einpasste und den Ensemblesound dabei in der entstehenden harmonischen Spannung über die Stimme des Einzelnen erhob. Man hört all diese Lehren in Armstrongs Musik, in seinen Aufnahmen mit Joe King Oliver, in denen ihm als zweitem Kornettisten eine oft ganz ähnliche Aufgabe des harmonischen Auffüllens zukam, in seinen Hot-Five- und Hot-Seven-Aufnahmen der späten 1920er Jahre, in denen er um die notwendige Abwechslung des Bandklangs im Verlauf der Stücke wusste. Und insbesondere hört man sie in seinen Vokalaufnahmen spätestens ab Anfang der 1930er Jahre, in denen er all diese Erinnerungen an die Straßen von New Orleans in eine kunstvolle wie ursprüngliche Interpretation einfließen ließ.