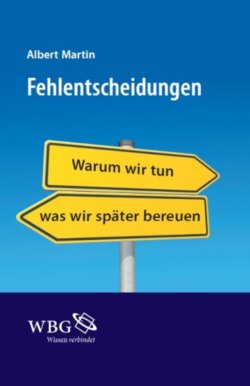Читать книгу Fehlentscheidungen - Albert Martin - Страница 19
2.2.2 Beispiele
ОглавлениеDas falsche Sunk-Cost-Denken ist weit verbreitet, man findet es in allen Handlungsfeldern und in allen Lebenslagen:
Man isst den merkwürdig schmeckenden Hasenbraten, wenn auch mit Widerwillen, denn man leistet sich ja nicht jeden Tag einen teuren Restaurantbesuch.
Man studiert weiter, selbst wenn einem das Fach nicht liegt und ungeachtet der Tatsache, dass die Klausurergebnisse dürftig ausfallen.
Man tritt den langersehnten Abenteuerurlaub an, selbst wenn man krank und ruhebedürftig ist.
Man lässt sein Auto nochmals reparieren, weil ohnehin schon so viel Geld in ihm steckt.
Man nimmt weitere Gitarrenstunden, auch wenn man inzwischen gemerkt hat, dass man kein Musiktalent ist.
Man verlässt seinen Partner nicht, weil dann die vielen gemeinsamen Jahre verloren wären.
In Politik und Wirtschaft erkennt man das fehlende Bewusstsein für die Natur von versunkenen Kosten gewöhnlich an folgendem Argumentationsmuster: „Nun wurde so lange investiert, nun muss das Projekt auch zu Ende kommen …“. Irgendwann taucht es in jeder Diskussion über ein Großprojekt auf, das finanziell aus dem Ruder gelaufen ist (vgl. u.a. ARKES 1993). Der folgende Satz zitiert den Anführer des Kriegszugs gegen Troja, Agamemnon: „Dieser Krieg muss fortgeführt werden, er hat schon zu viele Tote gefordert“ (SCHAUB 1997, S. 160). Ganz ähnliche Argumente konnte man hören, als es um die Entscheidung ging, den Vietnamkrieg weiterzuführen oder zu beenden. Auch auf dem angeblich von wirtschaftlicher Rationalität beherrschten Finanzmarkt offenbart sich nicht selten verfehltes Sunk-Cost-Denken. Ein Beispiel liefern Personen, die beim Verkauf einer Aktie in Rechnung stellen, zu welchem Kurs sie die Aktie gekauft hatten – ein Orientierungspunkt, der für die Beurteilung der Aktie schlichtweg irrelevant ist (Interesse verdient ausschließlich die zukünftige Entwicklung der Aktie), an dem sich oft allerdings selbst professionelle Anleger ausrichten (SHEFRIN/STATMAN 1985). Häufig tritt man auch bei Investitionsentscheidungen in die Sunk-Cost-Falle. So gehen Produkteinführungen am Markt oft mit hohen Kosten einher, erweist sich das Produkt nun als „Flop“, dann sollte man kühl bleiben und nicht – wie das oft geschieht – auf die bereits investierten Kosten starren, sondern sich bei der Entscheidung über die Zukunft des Projektes ausschließlich an den künftigen Ertragschancen orientieren.
Es gibt im Übrigen nicht nur materielle, sondern auch mentale Investitionen, die zu versunkenen Kosten werden können. Wer sein Leben bestimmten Überzeugungen gewidmet hat (z.B. einer bestimmten Theorie, einer Weltanschauung, einem religiösen Dogma) und sich an den entsprechenden Überzeugungen lange abgearbeitet hat, der wird sich schwer tun, sie über Bord zu werfen, wenn die Einsicht dämmert, dass man damit nicht weiterkommt und sich vielleicht sogar gründlich geirrt haben könnte. Eine der Ursachen für die Schwierigkeit, einmal gewonnene Überzeugungen aufzugeben (siehe den Abschnitt über die Bestätigungstendenz), liegt sicher auch im Investitionscharakter des Wissenserwerbs: „Überzeugungen sind wie Besitztümer“ (ABELSON 1986).
Die Problematik des Sunk-Cost-Denkens sei nochmals an folgendem Beispiel veranschaulicht. Am 10. Mai 1996 starben am Mount Everest acht Bergsteiger. Jedes Unglück entsteht aus der Verkettung vieler Umstände, es war daher auch hier nicht etwa ausschließlich der falsche Umgang mit versunkenen Kosten, der das tragische Geschehen bestimmte. Allerdings spielten Sunk-Cost-Überlegungen eine nicht unbedeutende Rolle (KRAKAUER 1997; ROBERTO 2002; TEMPEST/STARKEY/ENNEW 2007). Wenn man Achttausender bezwingen will, dann sollte man sich nicht die falschen Ziele setzen. Hat man den Gipfel erreicht, dann ist noch nicht einmal die halbe Arbeit getan. Die meisten Unfälle (am Mount Everest sind bereits über 160 Personen verunglückt) passieren beim Abstieg. Scott Fischer war einer der Bergführer vom 16. Mai. Von ihm stammt die berühmte Zwei-Uhr-Regel:
„Wenn Du nicht um zwei Uhr oben bist, ist es Zeit, umzukehren, die Dunkelheit ist nicht Dein Freund.“ Scott wurde nicht müde, diese Regel allen immer wieder in Erinnerung zu rufen, gleichgültig wie nah der Gipfel auch sein mochte, man muss rechtzeitig umkehren, um vor der Nacht wieder im Basislager zu sein (das Basislager IV, von dem der letzte Aufstieg unternommen wird, liegt etwa 12.500 Fuß unterhalb des Gipfels). Die bittere Ironie der Geschichte liegt darin, dass sich Scott an jenem 16. Mai selbst nicht an diese seine Regel hielt und beim Abstieg ums Leben kam. Nüchtern betrachtet, lässt sich leicht nachvollziehen, wie schwer es fallen kann, kurz vor dem Ziel umzukehren.
„Um erfolgreich zu sein muss man außerordentlich ambitioniert sein, aber wenn du allzu ehrgeizig bist, wirst du sterben. Außerdem wird in einer Höhe von mehr als 26.000 Fuß die Linie zwischen dem angemessenen Eifer und leichtsinnigem Gipfelfieber schmerzhaft dünn. Daher sind die Hänge des Everest mit Leichen übersät. Taske, Hutchison, Kasischke und Fischbeck [4 Teilnehmer der Expedition] hatten alle mehr als $ 70.000 ausgegeben und wochenlang Qualen ertragen für diese eine Möglichkeit, den Gipfel zu erreichen … und doch, mit dieser harten Entscheidung konfrontiert, waren sie unter den wenigen, die die richtige Entscheidung an diesem Tag trafen“ (KRAKAUER 1997, S. 84).
Fünfzehn Personen entschieden sich anders und erklommen den Gipfel (sie erreichten ihn z.T. erheblich nach 2 Uhr). Acht von ihnen kamen zu Tode, die übrigen trugen zum Teil irreparable Gesundheitsschäden davon.
Es ist nicht immer ganz leicht zu entscheiden, ob in einem konkreten Fall tatsächlich Sunk-Cost-Überlegungen im Spiel sind oder nicht. Häufig findet man beispielsweise zur Erläuterung des Sunk-Cost-Phänomens das Bushaltestellenbeispiel: Der Bus lässt auf sich warten und man denkt mit zunehmend verstreichender Zeit immer intensiver darüber nach, ob es überhaupt noch Sinn hat, weiter zu warten – verharrt dann aber dennoch, weil ja sonst die ganze Warterei vergeudet wäre. In diesem Beispiel mögen Sunk-Cost-Erwägungen tatsächlich eine Rolle spielen, wir haben es allerdings nicht mit einem „reinen“ Sunk-Cost-Effekt zu tun und zwar deswegen nicht, weil das weitere Warten nicht völlig umsonst ist, denn tatsächlich erhöht sich ja die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Bus dann doch kommt, mit jeder weiteren Minute des Wartens (jedenfalls meistens). Ähnliches gilt für den Langzeitstudenten: Weil anzunehmen ist, dass das Studium nicht gänzlich ohne Folgen bleiben wird. Es ist fast unvermeidlich, dass jemand, der lange genug studiert, schließlich auch Lernfortschritte macht. Gerade bei komplexen Entscheidungen ist es nicht immer klar, welche Rolle hierbei das Sunk-Cost-Denken spielt. So war den Verantwortlichen bei der Entwicklung der „Concorde“ schon früh klar, dass diesem High-Tech Überschallflugzeug kein wirtschaftlicher Erfolg beschieden sein dürfte, dennoch wurde das Projekt zu Ende geführt (EICHSTÄDT 1974). Wenn im Zuge derartiger Projekte falsche Sunk-Cost-Argumente ins Spiel gebracht werden, dann sind diese nicht zwangsläufig ernst gemeint, nicht selten dienen sie nur dazu, Projektgegner oder das staunende Publikum zu beeindrucken. Möglicherweise war auch Agamemnon nicht so naiv, seinem Argument wirklich zu glauben (s.o.) und nutzte es einzig zu dem Zweck, um seinen Kriegern einen Motivationsschub zu verpassen (SCHAUB 1997).