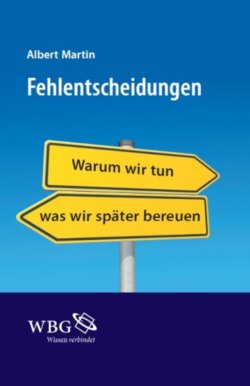Читать книгу Fehlentscheidungen - Albert Martin - Страница 6
1 Einführung
ОглавлениеDie menschliche Rationalität ist beschränkt. Das ist zweifellos ein Gemeinplatz. Man kann immer auf ihn zurückkommen, beispielsweise wenn man wieder einmal beobachten muss, wie jemand (z.B. man selbst) eine völlig unverständliche, ja „unvernünftige“ Entscheidung trifft. Besser als auf Gemeinplätzen zu verweilen ist es natürlich, wenn man sich etwas bewegt und nach möglichen Gründen für das jeweilige Verhalten Ausschau hält. Als hilfreich erweist sich hierbei die Verwendung von handlungstheoretischen Einsichten. Mit Hilfe einer Theorie kann man gewissermaßen „von oben“ auf das konkrete Geschehen herabblicken und es mit den – im Idealfall gehaltvollen – Kategorien beschreiben, die einem die Theorie zur Verfügung stellt. Problematisch ist hierbei die Selektivität, die sich zwangsläufig aus dem Gebrauch einer bestimmten Theorie ergibt. Ökonomen suchen überall nach dem Nutzen, der in einer Handlung steckt, Dissonanztheoretiker nach der Unordnung im Kopf, Psychoanalytiker nach verdrängten Impulsen usw. Und es gibt ein zweites Problem, mit der es jede Erklärung zu tun hat, die sich theoretischer Einsichten bedient. Theorien abstrahieren von der Vielfalt und Vielschichtigkeit ganz konkreter Vorgänge; man wird dem Geschehen aber nur dann gerecht, wenn man bei seiner Erklärung eben diese Komplexität nicht ignoriert. Ein Beispiel soll diese Überlegung verdeutlichen. Ein Freund hat sich beim Hausbau finanziell übernommen. Um sein Verhalten zu verstehen, bediene ich mich einer naheliegenden Erklärung, die entsprechend einfach ausfällt, und sage ihm auf den Kopf zu, er habe das Desaster seiner Extravaganz zuzuschreiben, schließlich hätte es ja auch ein kleineres Haus sein können. Er widerspricht mir heftig und kann (mit Recht) darauf hinweisen, dass er in vielerlei Hinsicht sehr bescheiden und meine Vermutung daher völlig abwegig sei. Dann müsse es eben ein anderes (übertriebenes) Bedürfnis sein, das ihn bewegt habe, so meine Schlussfolgerung, schließlich habe er sich von seiner Entscheidung ja etwas versprochen. Auf solche nichtssagenden Aussagen könne er gern verzichten, so seine Antwort. Also mute ich meinem Freund eine Analyse seiner Bedürfnisstruktur zu, versuche zu klären, welche Gedanken ihn bei seiner Entscheidung bewegten, wie er seine Einkommenssituation beurteilte, wie es zu dieser Beurteilung kam, welche Pläne er sich gemacht hatte, wie er sie umsetzte, was er sich von einzelnen Handlungsschritten versprach usw. Über manche dieser Punkte sind wir uns einig, über andere nicht, zu vielen können wir nichts Genaues sagen. Um meine oben angeführte „theoretische“ Aussage (Erwartungen und Bedürfnisse bestimmten das Handeln) zu konkretisieren, muss ich jedenfalls viel Detailwissen zur Anwendung bringen. Das ist immer so, wenn man einen Einzelfall mit Hilfe einer bestimmten Theorie erklären will: Man konstruiert ein Erklärungsmodell, verwendet hierzu die Konstrukte der Theorie, füllt sie mit dem empirischen Gehalt, den der konkrete Fall bereithält oder zumindest bereit halten sollte und versucht, die herausgearbeiteten Sachverhalte in den Zusammenhang zu bringen, den die Theorie postuliert. Das führt sehr schnell zu einer ziemlichen Verästelung der Überlegungen und zur Notwendigkeit, mit vielen ungeprüften Annahmen zu arbeiten. Die Theorieanwendung (wenn sie sorgfältig vorgenommen wird) ist also eine komplexe Angelegenheit. Dass sie sogar sehr komplex sein kann, wird einsichtig, wenn man darüber hinaus berücksichtigt, dass man konkrete Vorgänge nicht ausschließlich aus dem Blickwinkel einer einzelnen Theorie betrachten sollte. Im angeführten Beispiel ging es ja nur um die Nutzenabschätzung (und um Überlegungen, die hierbei eine Rolle spielen), eine konkrete Entscheidung kann jedoch noch von ganz anderen Größen beeinflusst worden sein. Vielleicht war die Nutzeneinschätzung des Freundes ja negativ ausgefallen (oder hat gar nicht stattgefunden) und die Entscheidung für das große Haus erfolgte auch deswegen, weil die Zeit drängte und sonst kein einigermaßen passables Haus angeboten wurde, weil die Verwandten ungeduldig waren, wegen der Freundlichkeit und Überzeugungskraft des Maklers, weil mein Freund gerade in einer großartigen ausgabefreudigen Stimmung war, weil er jemandem imponieren wollte oder warum auch sonst. Um derartige Einflüsse zu erklären gibt es eine Fülle weiterer Theorien, die man natürlich auch in Betracht ziehen sollte. Zusammengefasst haben wir es bei der Erklärung von Entscheidungen (und von Fehlentscheidungen als Beispielen beschränkter Rationalität) mit zwei Schwierigkeiten zu tun: zum einen mit der Reichhaltigkeit konkreter Geschehnisse, die von einzelnen Theorien nur schemenhaft erfasst werden können und zum anderen mit der Vielzahl von Theorien, die für eine fundierte Erklärung in Frage kommen.
Was heißt dies aber nun für das vorliegende Buch? Es geht darin um die Erörterung von Prozessen, die dafür verantwortlich sind, dass Menschen nur in einem sehr eingeschränkten Ausmaß rational handeln, oder, anders ausgedrückt, dass die häufig angestrebte Rationalität – die ja immerhin vorstellbar ist – aus nicht zufälligen Gründen oft verfehlt wird. Für die Erörterung der damit verbundenen Fragen taugen isolierte theoretische Betrachtungen und opulente Einzelfallbeschreibungen nur sehr bedingt. Glücklicherweise gibt es einen dritten Weg, der hier denn auch beschritten werden soll. Betrachtet werden im vorliegenden Buch typische und häufig auftretende Entscheidungsdefekte, und zwar jeweils aus dem Blickwinkel unterschiedlicher theoretischer Ansätze. Damit entfällt die Notwendigkeit, sich in unergiebigen Detailschilderungen einzelner Fehlentscheidungen zu verlieren, und es eröffnet sich die Möglichkeit, durch die gleichzeitige Inanspruchnahme unterschiedlicher theoretischer Perspektiven der Vielseitigkeit des konkreten Geschehens gerecht zu werden.