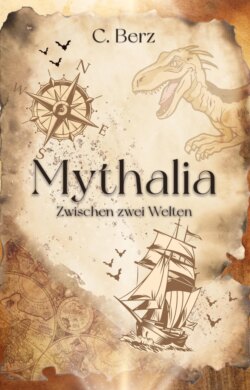Читать книгу Mythalia - C. Berz - Страница 11
Hoffnungsschimmer
ОглавлениеMarion litt. Als die Garde sie nach der schrecklichen Nacht im Hagelhaus hinausgeworfen hatte, war sie wie betrunken durch den Wald gestolpert. Sie war zurück ins Lager getorkelt, ins Zelt gestürzt, hatte nur ihre Schuhe ausgezogen und war in ihr Feldbett gefallen. Geschlafen hatte sie nicht – nur gegrübelt. Tia ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Marion hatte nur dagelegen in ihrem hübschen schwarz-blauen Kleid und gegen die Zeltplanen gestarrt. Den ganzen darauffolgenden Tag über hatte sie niemanden eingelassen. Ganz selten verließ sie das Zelt, um sich zu erleichtern oder wenn Hunger und Durst sie dazu zwangen.
Sie stand völlig neben sich. Starr saß sie manchmal da und blickte auf Tias Seite des Dirnenzeltes. Sie zermarterte sich den Kopf darüber, ob Tia hätte entkommen können und als ihr klar wurde, wie gering die Chance war, raubte ihr die Angst um ihre Freundin beinahe den Atem. Irgendwann zog sie schließlich den Vorhang zu, um die gähnende Leere von Tias Bett nicht mehr sehen zu müssen, die sie an ihre verlorene Freundin erinnerte.
Aber sie weinte nicht. Nach zwei Tagen versuchte sie, sich irgendwie abzulenken. Sie las Bücher, räumte auf, zog sich um, aß – aber das Zelt verließ sie kaum. Am vierten Abend schließlich hatte sie den größten Schock verdaut. Ihr wurde klar, dass sie nie erfahren würde, was mit ihrer Freundin geschehen war, wenn sie hier im Zelt versauerte. Von da an empfing sie wieder Kunden.
* * *
Als Marion am fünften Tag erwachte, rieb sie sich verschlafen die Augen, schwang sich aus dem Bett und kleidete sich an. Dann verließ sie das Zelt und ging spazieren. Eine lange Zeit über wanderte sie ziellos umher, versuchte an nichts zu denken und betrachtete ihre Umgebung. Sie lief durch das Lager, das sich noch im Tiefschlaf befand und ging ein paar Schritte durch den Wald.
Auf dem Rückweg folgte sie dem Flusslauf der Unser, wo sie auf zahlreiche Türmer traf, die ihre Kleidung oder sich selbst wuschen. Marion jedoch konnte diesen herrlichen Tag nicht genießen. Es gelang ihr nicht, den Frieden und die Glückseligkeit der anderen aufzunehmen. Sie blickte wie durch einen Schleier, nahm überhaupt nichts wahr, sie befand sich in einer Art Trance.
Als sie das Dirnenzelt erreichte, standen bereits zwei Männer vor dem Eingang und schnauzten sie ungeduldig an, wo sie denn bliebe. Die Lippen zu einem dünnen Lächeln verzogen, wies sie den Ersten an, ihr ins Zelt zu folgen. Starr und teilnahmslos gab sie ihm, was er verlangte – aber nicht mehr. Sie war dafür bekannt, ihren Kunden unvergessliche Stunden zu bereiten, sie zu umgarnen, regelrecht mit ihnen zu spielen – aber nicht heute. Ihre Augen waren leere Höhlen, hatten ihren Glanz verloren. Ihre Hände glitten matt und kraftlos über den Körper des Mannes und der Spaß war nur von kurzer Dauer. Stumm half sie ihm, sich anzuziehen, nahm sein Geld, eine Beschwerde und die Drohung, er suche sich eine andere Dirne, entgegen und wartete auf den Nächsten.
Als auch dieser gegangen war, lag Marion erschöpft auf ihrem Bett, alle Gliedmaßen von sich gestreckt, und starrte auf die Deckenzeltplane.
Nein, dachte sie, ich werde nicht wieder hier herumliegen und nichts tun! Ein Ruck ging durch ihren Körper und sie stand auf. Einen Moment lang stand sie unschlüssig im Zelt, dann fiel ihr Blick auf den Vorhang, der Tias Kammer von der ihren trennte. Mit zitternder Hand ergriff sie den samtenen Stoff und schob ihn langsam zur Seite. Ihre Augen flackerten und ihre Mundwinkel zuckten, als sie Tias Reich betrat. Sie berührte einige von Tias Kleidungsstücken und strich mit den Händen über ihre liebsten Dinge. Vorsichtig ließ sie sich auf dem Bett ihrer Freundin nieder. Ihre Finger glitten über die Decken und Kissen, strichen sie glatt, ordneten sie.
Plötzlich stießen Marions Finger gegen etwas Hartes. Verdutzt hielt sie inne. Es war aus Holz, sie konnte es spüren. Vorsichtig zog sie den Gegenstand zwischen den Kissen hervor – und traute ihren Augen nicht, als sie auf einmal ein Blasrohr in der Hand hielt. Es war aus dem Holz des Knallbuschgewächses gefertigt. Es war jenes Blasrohr, mit dem Tia von der Galerie aus auf den Freiherren geschossen hatte – das Blasrohr, das den weiß gefiederten Pfeil freigegeben hatte, der in Hagels Nacken steckengeblieben war. Dieses schmale, hölzerne Ding, etwa so lang wie Marions Arm, hatte Tia an jenem Abend bei sich gehabt. Dass es hier war, konnte nur eines bedeuten: Tia war entkommen!
Marion stieß einen spitzen Freudenschrei aus, rannte mitsamt dem Blasrohr aus dem Zelt und jauchzte lauthals in den Tag hinein. Draußen waberten Rauchschwaden umher und es roch nach verkohltem Speck. Eine alte Türmerin hockte vor ihrem Zelt und briet ihr Abendessen über einer großen Feuerstelle. Heißes Fett tropfte unablässig herab und erzeugte in kurzen Abständen kleine, blitzende Stichflammen. Der Qualm des angebrannten Specks zog hinüber zu Marions Zelt und hüllte die Dirne ein. So sah niemand, dass Marion nackt war. Der dichte Rauch verbarg Marion vollständig und somit auch ihre Blöße.
Sie scherte sich nicht um ihr Umfeld, sondern drehte gedankenverloren das Blasrohr zwischen ihren Fingern. Mit dem Daumen rieb sie über das Relief eines kleinen Zeichens, das ins Holz geschnitzt war. Ein von zehn Sternen umrahmter Eber – das Wappen von Wundern. In dieser Stadt hatte Tia die Waffe auf dem Schwarzmarkt am Hafen erworben. Marion erinnerte sich noch gut an diesen Tag. Sie seufzte glücklich und ließ das Blasrohr sinken. Auch wenn sie nicht wusste, wo sich Tia aufhielt – sie war hier gewesen. Dessen war sich Marion sicher. Tia lebte und war auf freiem Fuß. Marion konnte nicht anders, als sich darüber zu freuen – auch wenn es sie traurig stimmte, dass Tia sich ihr nicht gezeigt hatte und einfach verschwunden war …
Spät in der Nacht – leiser Regen trommelte sachte aufs Zelt – riss jemand die Eingangsplane abrupt zur Seite. Ein einzelner Mann in edler, weißer Reituniform trat ein. Er trug einen nachtblauen Umhang um die Schultern, wohl um Regen und Kälte abzuhalten. Die Kapuze hing ihm tief in die Stirn und verbarg seine Gesichtszüge. Im fahlen Licht der drei blauen Kerzen, die auf dem Tisch brannten, war nur ein grauer Schnurrbart über einem schmalen Mund zu erkennen.
Marion, die nur mit einem dünnen, weißen Unterkleid bedeckt auf Tias Bett lag, schreckte auf. Sie wartete darauf, dass der Mann die Kapuze abnahm und sich zu erkennen gab. Dass er es nicht tat, erfüllte sie mit Furcht.
Nach einem Augenblick des Schreckens fand sie ihre Stimme. „Mein Herr, es ist spät. Was führt euch zu dieser Stunde noch zu mir? Solltet ihr nicht Zuhause bei eurer Frau liegen?“
Ein verhaltenes Lächeln umspielte die Lippen des Fremden, sein Schnurrbart bebte leicht, als er sprach. „Da stapfe ich mitten in der Nacht durch den Regen, um mein einziges Kind zu sehen und werde so miserabel empfangen?! Nach über dreizehn Jahren hätte ich schon eine etwas freudigere Begrüßung erwartet.“
Noch bevor er die Kapuze seines dunklen Umhangs ganz zurückschlagen konnte, sprang Marion bereits auf und rannte auf ihn zu. „Vater! Du bist hier! Wie kann das sein? Ich dachte, ich sehe dich nie wieder …“
Etwa einen Schritt entfernt zögerte sie jedoch und anstatt ihn in eine Umarmung zu ziehen, blieb sie verunsichert stehen.
„Marion, mein Kind …“, flüsterte er nur und streckte eine Hand nach ihr aus. Sie ließ es zu, dass er ihr zärtlich über das schwarze Haar strich.
Eine ganze Weile standen sie einander gegenüber und sprachen kein Wort. Marion konnte es nicht fassen. Ihr Vater, den sie für immer verloren geglaubt hatte, war zurückgekehrt. Da sie selbst nicht die Initiative ergriffen hatte, ließ ihr Vater nun seine Hand aus ihrem Haar zu ihrer Schulter wandern und zog sie zu sich heran. Er drückte sie fest an sich, doch Marion konnte sich in seinen Armen nicht recht entspannen. Zu viele Fragen schwirrten in ihrem Kopf umher und die Erinnerung an den Schmerz, als er sie vor dreizehn Jahren verlassen hatte, kehrte mit ihm zurück. Schließlich schob sie ihn sanft aber bestimmt von sich, trat einen Schritt zurück und zwang ihrem Gesicht ein schmales Lächeln auf.
Ihr Vater wischte mit einem Finger eine einzelne Freudenträne weg, die soeben seine Wange hinabrinnen wollte. Dann nahm er seinen Umhang und hüllte Marion darin ein.
„Hast du keine Kleidung, dass du in diesem dünnen Fetzen schlafen musst?“
Da schlich sich wieder der elterliche Befehlston in seine Stimme, den er früher immer benutzt hatte, um sie zu tadeln, vermischt mit Sorge und schlechtem Gewissen.
„Ich bin allein, Vater“, erwiderte sie trotzig und ärgerte sich über seinen Tadel. Gleichzeitig erinnerte sie sich unwillkürlich an ihre Kindheit und spürte, wie sehr sie seine Stimme vermisst hatte, selbst diesen Tonfall. „Niemand stört sich da an meiner Nacktheit.“
Doch die Sorgenfalten auf seiner Stirn wurden tiefer.
„Jetzt aber bin ich zurück. Außerdem gehört es sich nicht vor den Kindern.“
Marion sah ihn fragend an. „Vor den Kin – ?“
Dann verstummte sie, als sie den kleinen Jungen sah, der – schwer auf einen grob geschnitzten Stock gestützt – durch einen Spalt zwischen den Planen ins Zelt hineinlugte. Nach kurzem, schüchternem Zögern trat er ein, wobei er sein linkes Bein kaum merklich nachzog. Gleich darauf folgten ihm drei weitere, etwas ältere Kinder nach – zwei Jungen und ein Mädchen. Marion gab sich keine Mühe, ihr Erstaunen zu verbergen.
„Vater, wie – ?“ Dann wandte sie sich direkt an die Kinder. „Wer seid ihr?“
„Mich nennt man Späher“, meldete sich der Älteste zu Wort, der den Stimmbruch bereits hinter sich hatte. An seinem Kinn spross ein wenig Bartflaum. Er musste fast das Mannesalter erreicht haben, Marion schätzte ihn auf etwa 16 Jahre ein. Er hatte kurzgeschnittenes, walnussfarbenes Haar, seine Kleidung war aus edlem Stoff gefertigt und zeugte von Qualität, war jedoch so zerschlissen, dass nicht einmal ein Bettler sie noch tragen würde. In seinem Gürtel steckte ein kurzer Dolch mit einem funkelnden Rubin im Knauf, für dessen Wert sich der Junge dreimal neu hätte einkleiden können! Auf dem Rücken trug er einen Reiterbogen sowie einen Köcher mit einem Dutzend Pfeilen. Marion wunderte sich still über diese höchst ungewöhnliche Zusammenstellung.
Da niemand sonst diese Aufgabe übernahm, fühlte sich Späher anscheinend verpflichtet, auch die anderen vorzustellen. So hieß der Kleine mit dem Stock und den krausen, dunklen Locken Johanni und war erst vier Jahre alt. Der andere Jungen und das Mädchen hielten einander an der Hand. Marion schätzte die beiden auf etwa zwölf Jahre: William, der das aschblonde Haar zu einem Zopf zurückgebunden hatte und ein verrostetes Messer am Gürtel trug und Robin, das Mädchen, mit blonden, hübsch frisierten Locken.
Anders als Späher stecken die Drei nicht in Lumpen. Die beiden Jungen trugen eine ähnliche Reituniform wie auch Marions Vater, nur dass ihre schwarz war. Das Mädchen ließ sich ein nachtblaues Kleid stehen, welches verblüffende Ähnlichkeit mit einem von Marions Kleidern aus der Kindheit hatte.
„Nun kenne ich eure Namen. Doch weiß ich nicht, wer ihr seid.“ Marion drehte sich zu ihrem Vater um: „Wer sind sie? Sie sind nicht etwa … meine Geschwister?“
Ihr Vater zögerte, also bohrte Marion weiter nach: „Was ist passiert, dass du wieder hier bist? Du bist doch in Ungnade gefallen und verbannt worden!“
Marion war erstaunt über ihren eigenen Tonfall. Sie sollte sich unbändig über seine Rückkehr freuen, die für sie einen Ausweg aus ihrem Leben als Dirne bieten musste. Stattdessen verspürte sie Unmut und Enttäuschung.
Anstatt auf ihre Fragen zu antworten, sprach ihr Vater die beiden Kinder mittleren Alters an: „Robin, William. Macht uns bitte einen Mondtee, ja?“ Er wandte sich an Marion: „Wasser und eine Kochstelle finden sie doch draußen?“
„Ja. Aber es regnet. Lass‘ mich das machen.“
„Nein. Das ist schon in Ordnung“, meinte ihr Vater. „Die beiden haben auf der Straße gelebt. Dieses bisschen Nieselregen macht ihnen nichts aus.“
Durch die kurze Debatte zunächst verunsichert, tauschten William und Robin einen langen Blick aus, bevor sie die Teeblätter annahmen, die Marion ihnen gab. Ohne ein weiteres Wort gingen sie Hand in Hand nach draußen.
Marion hob die Augenbrauen. „Auf der Straße? Sie sehen überhaupt nicht danach aus. Besonders das Mädchen nicht.“
„Setzen wir uns. Ich erzähle dir alles.“
Marion zog sich rasch ein weites, bequemes Leinenkleid über und gab ihrem Vater den edlen Umhang zurück. Die Dirnen besaßen keine Stühle, also saßen Marion, ihr Vater, Johanni und Späher auf Sitzkissen am Boden vor einem kleinen Tischchen, auf dem bereits heißer, herrlich duftender Tee in Tontassen dampfte. Die beiden anderen Kinder hatten sich kurz blicken lassen, um ihnen den Tee zu bringen, saßen nun aber wieder draußen am Feuer und unterhielten sich leise. Ihre Kinderstimmen drangen gedämpft durch die Zeltplanen.
„Fangen wir von vorne an“, begann Marions Vater und griff nach einer Teetasse. „Du erinnerst dich an die Geschichte mit der Frau, die ihren Verlobten nicht mehr wollte, weil ich sie angeblich umworben habe? Dass das nicht stimmt, brauche ich dir nicht erzählen.“
Marion nickte. „Die Sache hat sich Grau ausgedacht, damit der König dich entmachtet und verbannt und er selbst der neue Graf von Ruder wird.“
„Was letzten Endes erfolgreich war.“
Wieder nickte sie. „Kaum warst du fort, hat er sich die Burg zu Eigen gemacht, Hagel als Freiherren eingesetzt, neue Gesetze erlassen, die Steuern erhöht und jeden innerhalb seiner Ländereien, der sich nicht an die neuen Regeln hielt, bezahlen lassen – ab und an auch mal mit dem Leben.“
„Wie du weißt, hat sich Grau an den Vertreter des Königs gewandt. Er trug ihm seine Version dieser Frauengeschichte vor und nach einiger Überlegung und der guten Überzeugungskraft von Grau wurde das Urteil gefällt. Enthebung aus dem Adelsstand, Verlust aller Ländereien und Verbannung aus dem Pfauenreich.“
„Aber wo warst du? Warum bist du zurück?“
Ihr Vater stellte seine Tasse ab. Marion betrachtete ihn und fragte sich, welches Leid ihm in den letzten Jahren widerfahren sein mochte.
„Ich war mit dem Urteil nicht einverstanden und bin zur Pfauenfeste gegangen – dem Sitz des Königs. Der Weg ist ja nicht weit … dachte ich. Das Geschlecht der Kornblums ist dem König immer noch wichtig. Ich musste mit ihm sprechen, ihm alles erklären und unsere Familienehre wiederherstellen. Doch der König ist nicht hier. Er ist mit seinen Rittern im Verfluchten Land – eine halbe Armee hat er dabei.“
„Im Verfluchten Land? Herrscht dort nicht seit ewigen Zeiten Krieg?“
„Ja, das stimmt. Er und seine Männer wollen helfen, den schon tausende Jahre andauernden Konflikt der beiden Völker dort zu schlichten. Ich dachte mir: Gut, dann warte ich eben, bis er zurückkommt. Aber er kam nicht. Ein ganzes Jahr lang habe ich in der Nähe der Pfauenveste in den Straßen gelebt, immer in Sorge, erkannt zu werden. Und in Sorge um dich.“
Nach diesen Worten öffnete Marion den Mund, um etwas zu erwidern. Doch sie fürchtete, dass ihre Antwort alles andere als freundlich klingen würde, also schwieg sie und beschloss, ihn zuerst weiter anzuhören.
„Nachdem ich ein ganzes Jahr lang vergeblich auf seine Rückkehr gewartet habe, bin ich losgezogen.“
Marion staunte. „Vater. Du bist doch nicht etwa … ?“
Sie stutzte, als sie seinen schuldbewussten Gesichtsausdruck sah.
„Oh doch. Ich bin ins Verfluchte Land gereist.“ Er machte eine bedeutungsvolle Pause. „Und ich habe den König gefunden.“
„Verzeih, aber ich hätte nicht von dir erwartet, dass du solch eine Reise auf dich nimmst. Das ist so unvorstellbar weit weg.“
Da musste der Grauhaarige lachen. „Es war kein Spaß, mein Kind, das kannst du mir glauben. Aber ich musste das tun. Für dich. Sieben Jahre sind vergangen, bis ich dort war.“
„Sieben Jahre … Ich kann mir kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss. Wie hast du es gemacht? Also ich meine, bist du die ganze Zeit über geritten?“
„Den Großteil, ja. Manche Teile des Weges konnte ich an Bord von Schiffen bewältigen und ab und zu habe ich mich fahrenden Türmern angeschlossen und durfte in ihren Kutschen mitfahren, um meinen geschundenen Hintern auszuruhen. Wobei das auch weniger Kutschen als eher klapprige Karren waren.“ Ihr Vater hielt einen Moment inne, bevor er den Kopf hob und Marion fest in die Augen sah. „Es tut mir leid, dass ich dich verlassen habe. Und das für so lange Zeit. Aber ich konnte dich nicht mitnehmen. Ich war verbannt und damit vogelfrei – du nicht. Dich ins Exil mitzunehmen hätte die Immunität zerstört, die du Dank deines adligen Blutes noch immer hast. Und ich habe gehofft, dass sich die Schwestern gut um dich kümmern.“
„Das haben sie. Zumindest für die ersten zwei Jahre. Dann bin ich abgehauen.“
Es stimmte, Marion war es bei den Schwestern im Hospital gut gegangen. Es hatte ihr an nichts gefehlt – abgesehen von der Freiheit. Zudem war es mit zunehmendem Alter gefährlich geworden.
„Ich war kurz vor dem heiratsfähigen Alter, Vater“, sagte Marion schnell, bevor er etwas einwerfen konnte.
„Die Sicherheit einer Ehe wäre für dich nicht das Schlechteste gewesen. Ohne mich als Vormund … “
Marion unterbrach ihn empört. „Vater, ich heirate doch nicht irgendeinen fremden Mann, den ich kaum kenne! Da schlag‘ ich mich lieber alleine durch. Die Türmer bleiben von jedem Gesetz unberührt. Deshalb habe ich mich ihnen angeschlossen.“
„Ist ja gut.“ Marions Vater hob beschwichtigend die Hände. Seine Lippen zuckten ein wenig. „Du bist schon immer so stur gewesen. Ich konnte dich doch noch nie zu etwas zwingen. Wahrscheinlich hast du die bestmögliche Entscheidung getroffen. Wärest du nicht geflohen und hättest dich des Adelsstandes losgesagt, hätte man dich verheiratet, ja. Und so wie ich den Grafen kenne, hätte er dich glatt mit dem Freiherren von Hagel verheiratet.“
Marion griff fahrig nach ihrer Tasse, trank jedoch nichts, sondern hielt den Blick gesenkt, während ihre Gedanken abschweiften. Die Heirat mit Hagelchen war nicht der Auslöser für ihre Flucht gewesen. Sie hatte es einfach nicht ertragen, nicht mehr ihren Vater, sondern Grau – den glatzköpfigen, kleinen Mann, dem ein Schneidezahn fehlte – auf dem Herrschersessel des Grafen zu sehen. Hagel war ihm treu ergeben. Ohne diese Tatsache hätte sie einer Eheschließung mit dem entzückenden, gutaussehenden Freiherren, der sich ihr gegenüber noch dazu außerordentlich liebevoll verhalten hatte, mit dem größten Vergnügen zugestimmt. Weil ihr Vater aber nicht weiter auf das Heiratsthema zu sprechen kam, beschloss Marion, ebenfalls nicht tiefer darauf einzugehen. Sie stellte ihre unberührte Tasse wieder auf den Tisch.
„Wie dem auch sei. Du sagtest, du hast den König gefunden. Wie ist es dir ergangen? Immerhin bist du wieder zurück.“
Er nickte und fuhr sogleich mit seiner Erzählung fort: „Der Pfauenkönig hörte mich an und schenkte mir Glauben, so wie er es in all den Jahren, in denen ich Graf von Ruder war, stets getan hat. Er konnte das Wort seines Vertreters in der Pfauenfeste nicht gänzlich rückgängig machen – dazu war er zu weit von seinem Herrschaftsgebiet entfernt. Aber er widerrief die Verbannung und ernannte mich zum Gutsherren. Herr von Kornblum klingt doch gut, oder nicht? Marion, Herrin von Kornblum … Was sagst du?“
„Also … Das klingt doch … ganz gut“, erwiderte Marion knapp. Doch ihr wurde klar, was das bedeutete. „Heißt das, ich könnte mit dir zurückkehren? In ein Haus – einen Gutshof sogar?“
Der Herr von Kornblum nickte. „Aber ja. Wir sind frei, mein Kind. Man schenkt uns wieder Anerkennung.“
Marion schluckte geräuschvoll. Ein Leben auf einem Hof, elegante Kleidung, Geld, genug zu Essen und ein Titel. Dagegen standen ein Leben im Zelt, im niedrigsten Milieu, das man sich nur vorstellen konnte, einfache Kleidung, schlechte Hygiene, kleine Mahlzeiten und keinerlei Anerkennung. Und dennoch war sie zufrieden. Sie war ihr eigener Herr und von niemandem abhängig. Ihr Blick fiel auf den zugezogenen Vorhang zwischen den beiden Zelthälften. Wäre Tia hier, wäre Marions Entscheidung anders ausgefallen. Sie hätte die Jüngere nicht alleine gelassen. Aber nun hielt sie nichts davon ab, in ihr altes Leben zurückzukehren. Auch wenn sie tief in ihrem Inneren wusste, dass nichts mehr so sein würde wie damals vor dreizehn Jahren.
Zwischenzeitlich hatte ihr Vater seine Geschichte fortgesetzt. Er erzählte gerade davon, wie er die Kinder während seiner Reise auf der Straße aufgesammelt und unter seine Fittiche genommen hatte.
„Späher war der erste, den ich gefunden habe. Oder hast du mich gefunden?“ Der Herr von Kornblum zwinkerte dem Jungen zu, der schelmisch grinste. „Du musst wissen: er hat versucht, mich auszurauben.“
Späher stieß ein kurzes Lachen hervor, das die Züge seines jugendlichen Gesichts fast niedlich wirken ließ. Doch dann sprach er mit seiner tiefen Stimme:
„Ich hab‘ es nicht nur versucht.“
„Das stimmt allerdings. Du warst ein richtiger Gauner. Ein flinker Dieb.“
Spähers Grinsen wurde noch breiter. „Der beste Dieb im Verfluchten Land. Aber ich hab‘ mich dafür entschuldigt. Mehrmals!“
Beide Männer lachten. Marion brachte gerade noch rechtzeitig ein höfliches Schmunzeln zustande, damit niemand merkte, dass ihre Gedanken soeben abgeschweift waren. Während sie Späher betrachtete, kam ihr auf einmal eine Idee. Sie musterte den Dolch an seinem Gürtel und den Bogen, den er neben sich auf einem Kissen abgelegt hatte. Sicher nannte man ihn nicht ohne Grund Späher.
Beiläufig registrierte Marion, wie ihr Vater weiter erzählte, dass er anschließend Robin und William begegnet war. Dann berichtete er, wie man sie für den Heimweg mit mehreren Pegasi ausgestattet hatte und sie nach Hause geflogen waren. Und schließlich habe er Johanni auf dem Nachhauseweg aufgegabelt. Doch Marion hörte nicht mehr zu … Was war nur mit Tia? Warum war sie nicht zu ihr gekommen? Was war im Hagelhaus zwischen ihr und der Dirne vorgefallen, mit der sie den Saal verlassen hatte? Wie hatte sie es nur geschafft, zu entkommen? Sie hatte keine Chance, an Antworten zu kommen. Oder doch? Langsam legte sie sich im Kopf einen Plan zurecht.
„Dein Mondtee wird noch kalt.“ Eine tiefe Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
Marion blinzelte. Der Herr von Kornblum war immer noch tief in seine Erzählungen versunken. Es war Späher, der sie angesprochen hatte. Die Augenbrauen hochgezogen und den Kopf schiefgelegt, betrachtete er sie von der Seite. Es dauerte eine Weile, bis sie seine Worte begriff. Dann ergriff sie hastig die Tasse und schloss die Finger darum. Es drang kaum noch Wärme durch den Ton. Sie lächelte verlegen und trank einen Schluck von der inzwischen etwas bitter gewordenen, lauwarmen Flüssigkeit. Er hörte nicht auf, sie anzustarren. Ihr war, als sähe sie ein leichtes Schmunzeln um seine Lippen, als er den Kopf neigte, um an seinem Tee zu nippen.
Nach einer Weile wurde dem kleinen Johanni langweilig, sodass Späher mit ihm das Zelt verließ und sich mit den anderen beiden auf den Weg zum Gutshof ihres Vaters machte. Marion war es vor dem Aufbruch der Kinder gelungen, heimlich einen Zettel zu schreiben und diesen in Spähers Köcher zwischen die Pfeile zu stecken.
Triff mich in einer Stunde hinter dem Zelt
Der Herr von Kornblum schien ihre kleine Geste nicht gesehen zu haben. Obwohl es Späher dagegen nicht ganz entgangen sein konnte, ließ er sich nichts anmerken. Gut so, dachte Marion. Nun musste sie nur noch etwa eine Stunde dasitzen und höflich den Erzählungen ihres Vaters lauschen. Der Junge hatte bemerkt, wie sie ihm den Brief zugesteckt hatte, also würde er ihn wohl gleich öffnen und lesen …
Marion erschrak. Was, wenn er nicht lesen konnte? Für sie, als Grafentochter, war Lesen und Schreiben selbstverständlich. Aber ein schmutziger, ärmlich gekleideter Straßenjunge im Alter von 16 Jahren konnte diese Künste wohl kaum erlernt haben. Sie lehnte den Kopf an einen der dicken Holzbalken, die das Zelt stützten und schloss für einen Moment die Augen. Im Geiste verfluchte Marion sich für ihre Dummheit. Sie kippte den Rest des Tees in einem Zug hinunter und erschauderte, weil dieser inzwischen kalt war.
„Mmh“, machte sie unwillkürlich und schüttelte angewidert den Kopf.
Da horchte ihr Vater auf. „Marion. Langweile ich dich?“
Sie zwang sich zu lächeln. „Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid, ich war nur gerade etwas schläfrig. Das muss der Mondtee sein. Der macht mich immer müde.“
Er schmunzelte. „Nun ja, ich werde ohnehin nicht mehr lange bleiben.“
Doch es verging eine ganze Stunde, dann noch eine. Sie führten eine gute Unterhaltung, bei der auch Marion viel zu Wort kam. Ihr Vater bot ihr an, gleich am darauffolgenden Tag auf seinen Hof zu ziehen, was sie dankend annahm. Glücklicherweise fragte er nur ein einziges Mal, welcher Beschäftigung sie bei den Türmern nachgegangen war und sie konnte ihn nach einigem Gestotter und sichtlichem Zögern davon überzeugen, sie sei die Gehilfin einer Wahrsagerin, der das zweite Bett im Zelt gehörte. Er durfte nie erfahren, womit sie ihr Geld verdient hatte. Niemals.
Obwohl die Unterhaltung Marion ablenkte, ging ihr das misslungene Treffen mit Späher nicht aus dem Kopf. Es machte sie nervös, nicht zu wissen, was mit Tia geschehen war. Dabei hatte sie mit Späher die Lösung direkt vor der Nase gehabt. Sicher würde sie Späher in der nächsten Zeit häufiger begegnen, doch wenn sie erst auf dem Gutshof wären, würde es fast unmöglich werden, einen ungestörten Augenblick zu zweit zu bekommen. Die heutige Nacht wäre die beste Chance gewesen. Ständig verlagerte sie ihre Sitzposition, setzte sich aufrecht, sank wieder zusammen, überkreuzte die Beine, wechselte in den Schneidersitz …
Plötzlich wurde die Eingangsplane aufgerissen und der kleine Johanni stiefelte herein.
„Herr, Herr, wann kommst du?“
„Johanni, was machst du denn hier? Du solltest längst schlafen.“
„Dich vermissen.“ Für die Dauer eines Wimpernschlages hielt der Kleine inne, als müsse er sich an etwas erinnern. Dann stolperte er über seine eigenen Füße, ließ den Stock fallen und fiel auf die Knie. Ganz kurz war es still – dann fing er lauthals an zu weinen. Marion sprang sofort auf, um zu ihm zu eilen, aber als sie sich dem Jungen näherte, weiteten sich seine Augen und er fing an zu brüllen: „Nein! Herr, Herr!“
„Ist ja gut. Ich bin hier“, murmelte der Herr von Kornblum, während er sich neben Johanni auf den Boden kniete und den Jungen an sich zog. „Tut mir Leid“, flüsterte er Marion zu. „Er weint fast nie.“ Sanft wiegte er Johanni im Arm, der noch immer weinte. „Hast du dir wehgetan?“
Marion beschloss, in gebührendem Abstand stehen zu bleiben, da Johanni ihre Gegenwart wohl eher erschreckte. Und sie tat gut daran, sich nicht weiter vom Fleck zu bewegen, denn plötzlich durchschnitt ein Pfeil die Zeltplane. Sie konnte den Luftzug auf der Haut spüren und die Leitfeder kitzelte ihre Wange, so knapp pfiff er an ihrem Gesicht vorüber. Mit einem dumpfen Laut bohrte sich die Spitze in die dicke, hölzerne Zeltstange, an die sie vorhin noch ihren Kopf gelehnt hatte.
Der spitze Schrei, den sie ausstieß, ging in Johannis Gebrüll unter, sodass ihr Vater nichts mitbekam. Das war auch gut so. Denn als sie langsam den Kopf drehte – vorsichtig, aus Angst, sich in die Flugbahn eines zweiten Pfeils zu manövrieren – erkannte sie das Geschoss wieder. Dunkelbraunes Holz, braun-weiß gesprenkelte Legehennenfedern. Ein Pfeil aus Spähers Köcher. Am Schaft war mit einem dünnen Faden ein Zettel befestigt. Langsam ging sie zur Zeltstange, im Augenwinkel immer ihren Vater im Blick. Sie machte sich daran, den Knoten um den Brief zu lösen, doch dann schloss sie die etwas zittrigen Finger um den Pfeil und zog diesen mit einer leichten Drehbewegung aus dem Holz. Sie entfernte den kleinen Zettel rasch und schob sich den Pfeil kurzerhand in den Ausschnitt. Ein so unvorteilhaftes Leinenkleid ohne jegliches Dekolleté hatte doch gewisse Vorzüge.
Kaum war der Pfeil versteckt, hörte Johanni wie auf Kommando mit dem Weinen auf und schaute Marion zufrieden aus seinen schwarzen Augen an. Sie schüttelte schmunzelnd den Kopf, las den kurzen Text und verbarg auch den Brief in ihrem Ausschnitt. Es waren ihre Worte. Drei Worte waren jedoch mit einem Stück Kohle durchgestrichen worden.
Triff mich in einer Stunde hinter dem Zelt
Sie musste Späher suchen. Jetzt.
„Marion. Johanni bleibt wohl lieber bei uns. Ich möchte ihn nicht alleine im Dunkeln nach Hause schicken. Geht das für dich in Ordnung?“
„Jaja“, antwortete sie betont ruhig, um ihre Nervosität nicht zu zeigen. „Entschuldigst du mich für einen Moment? Ich muss … kurz austreten.“
„Aber natürlich, mein Kind“, sagte er, ohne auch nur aufzublicken.
Draußen war es dunkel und überraschend kühl, aber windstill. Es regnete nicht mehr, doch sie spürte den Kies nass und kalt unter ihren nackten Füßen. Zwischen den benachbarten Zelten flackerte der rötliche Schein knisternder Lagerfeuer. Fröstelnd verschränkte sie die Arme vor der Brust. Bevor sie ins feuchte Gras auf der Rückseite des Zeltes trat, zog sie den Pfeil aus ihrem Kleid hervor.
Nur ein paar Schritte weiter stand eine Gestalt, lässig an einen dürren, blattlosen Baum gelehnt. Ihr Fuß wippte ungeduldig auf und ab, die Arme hatte sie vor der Brust verschränkt.
„Späher?“
Im Mondlicht sah er weit älter aus als 16.
„Na endlich!“ Er stapfte auf sie zu, riss ihr wortlos den Pfeil aus der Hand und schob ihn zurück in seinen Köcher. „Was war los?“, fragte er, als er sich zurück an den Baum gelehnt hatte. „Du schreibst, du willst mich treffen und dann tauchst du nicht auf.“ Er machte nicht den Anschein, als würde er tatsächlich eine Antwort erwarten.
Sie war mit der Absicht gekommen, sich zu entschuldigen, hatte gefürchtet, ein Kind verunsichert zu haben und sich dabei nicht wohl gefühlt. Doch jetzt, da er vor ihr stand, arrogant und überheblich und sie als unzuverlässig brüskierte, dachte sie nicht mehr im Traum daran.
„Hüte deine freche Zunge, Bürschchen, wenn du mit einer Dame sprichst“, tadelte sie ihn. Es war lange her, dass sie solche Worte ausgesprochen hatte und dass sie sich selbst als Dame bezeichnet hatte.
Er betrachtete sie abschätzend. „Eine Dame, ja? Aber auch erst seit zwei Stunden. Und schon gackerst du wie eine aufgeblasene Hofhenne. Ich hatte vorhin den Eindruck, deine Zeit als Türmerin hätte dir die Augen geöffnet und dich zu einem wirklich charmanten, liebenswürdigen Menschen gemacht. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Du glaubst offenbar, du seist etwas Besseres, jetzt wo du wieder von oben auf andere herabsehen kannst.“
Marion war zu aufgebracht, um über die Wahrheit in seinen Worten nachzudenken. Sie wollte ihm gerade eine giftige Erwiderung entgegenschleudern, da fuhr er ihr erneut über den Mund. „Also, was gibt es nun?“
Marions Zorn wuchs. Sie war kurz davor, ihm ganz und gar nicht damenhaft ins Gesicht zu schlagen. Ihr Gegenüber starrte sie mit arrogant hochgezogenen Augenbrauen und schiefgelegtem Kopf an und wartete ihre Antwort ab.
„Jemand sollte dir wirklich Manieren beibringen“, zischte sie hinter zusammengebissenen Zähnen. Ich brauche seine Hilfe, besann sie sich. Also sprang sie über ihren Schatten, schluckte ihre Wut hinunter und fragte: „Man nennt dich Späher, ja?“
Er nickte nur kurz.
„Sag mir: Hält dieser Name, was er verspricht? Bist du ein Späher? Ein Auskundschafter?“
„Du willst jemanden ausspionieren.“ Sein Grinsen war an Überheblichkeit nicht zu überbieten. „Edel und rechtschaffen, wie Ihr seid, meine Dame, hätte ich das niemals von Euch erwartet.“
Marions Bedürfnis, mit der Faust in seine überraschend gleichmäßigen Zahnreihen zu schlagen, wurde immer stärker. Er verspottete sie, dieser dreiste Flegel. Was soll das, Marion!, schalt sie sich selbst in Gedanken. Du kannst dieses höfische Getue doch selbst nicht leiden! Sie konnte kaum glauben, wie schnell sie wieder in diese hochgestochene Sprechweise verfallen war.
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, ignorierte sie seine Bemerkung. „Nun … Ja. Aber dazu brauche ich jemanden, der genügend Geschick hat. Jemanden, der sich still und leise bewegen und gut zuhören kann, ohne entdeckt zu werden. Kannst du das?“
„Und verrätst du mir auch, wer der Glückliche – oder Unglückliche – ist, der deine Aufmerksamkeit erregt hat?“ Er schnaubte, als er keine Antwort erhielt. „Ja. Ja, ich habe dieses … Geschick. Ich pirsche mich heran, belausche dein Opfer und komme unbeschadet zu dir zurück, um Bericht zu erstatten. Ist es das, was die Dame möchte?“
„Ja. Ganz genau“, antwortete Marion betont lässig.
„Wen soll ich also beschatten? Und weshalb?“
Marion kaute auf ihrer Wange herum und überlegte, wie viel sie ihm sagen sollte. Konnte sie ihm vertrauen? Aber es half nichts.
„Ich fürchte, ich komme um eine Erklärung nicht herum.“ Also erzählte sie ihm von Tia, von dem Abend im Hagelhaus und dem Attentat.
„Moment! Ich bin kein Auftragsmörder.“
Sie schüttelte heftig den Kopf. „Nein, nein! Ich bitte dich, nein! Du verstehst mich falsch. Du sollst den Freiherren nur ausspionieren.“
„Verstehe.“
Das machte sie stutzig. „Du würdest das doch nicht etwa tun?“
Seine Augen waren plötzlich kalt und seine Stimme seltsam tonlos. Er wich ihrem Blick aus. „Nein, ich habe schon verstanden. Ausspionieren. Nicht töten. Irgendetwas Spezielles, das ich in Erfahrung bringen soll?“
„Meine Freundin.“
„Tia?“
„Ja. Sie ist verschwunden. Ich dachte, sie hätten sie gefasst, aber nun scheint es, als sei sie doch entkommen. Ich will die Wahrheit wissen. Was ist mit ihr geschehen? Wo ist sie? Sucht man nach ihr? Hat man mich ebenfalls ins Visier genommen?“ Marion hielt einen Moment inne und fügte dann noch hinzu: „Und ich will wissen, welches Miststück Tia verraten und unseren Plan vereitelt hat.“
Späher wirkte ein wenig überrascht ob ihrer Ausdrucksweise, aber sagte nichts darauf. Stattdessen nickte er. „Nun denn. Muss ich sonst noch etwas wissen?“
Marion überlegte kurz. „Ja! Kennst du dich dort denn aus? Weißt du überhaupt, wo du hinmusst und wie Hagel aussieht?“
„Ich kenne ihn – obwohl … Kennen ist zu viel gesagt. Ich habe von ihm gehört, ihn auch schon mal gesehen. Und mit dem Hagelhaus bin ich vertraut. Ich kannte die Familie recht gut, die vor ihm dort gewohnt hat. Noch bevor man es zu einem Mausoleum gemacht hat.“
„Die vorher darin gewohnt hat …?“
„Der Freiherr von Reichenherz und seine Familie.“
„Ah!“, rief sie aus. Diese Leute waren gute Freunde ihres Vaters gewesen. Bis es mit ihnen ein tragisches Ende genommen hatte. „Da gab es doch dieses schreckliche Feuer in dem Haus. Sie sind alle umgekommen …“
Späher schnaubte. „Ja, man erzählt sich von einem schrecklichen Unfall, der zu dem Feuer geführt hat, bei dem alle verunglückt sind. Das ist zumindest die offizielle Version der Geschichte.“
„Wie meinst du das?“
Er schien verärgert über ihre Unwissenheit. „Ganz einfach. Das war nur inszeniert. Das Feuer wurde gelegt.“
„Das ist doch Unsinn, warum sollte jemand – ?“
„Der Freiherr von Hagel hat das angestiftet – nur, dass er da noch kein Freiherr war. Genauso wenig wie Grau ein Graf war. Die beiden sind schon seit Ewigkeiten Geschäftspartner. Nachdem die Familie Reichenherz ausgelöscht war, wurde das Haus zu ihrer letzten Ruhestätte. Aber es hat nicht lange gedauert, bis Hagel – als frisch ernannter Freiherr – das Mausoleum in Besitz genommen hat.“ Späher schaute sie forschend an. „Kurz darauf fiel dein Vater plötzlich in Ungnade und rein zufällig ist sein Nachfolger kein anderer als Grau, der beste Freund von Hagel. Wenn du mich fragst, war das eine lange geplante Verschwörung, damit die beiden das Land von Ruder ergattern konnten.“
Marion war sprachlos. Zunächst hatte sie die Geschichte für an den Haaren herbeigezogen gehalten. Nun aber bezog er ihren Vater mit ein und rückte die Sache damit für sie in ein ganz anderes Licht. Ihr war immer klar gewesen, dass man ihrem Vater Unrecht getan hatte und dass er unschuldig war. Dass Grau ein machthungriger Verräter war, hatte sie gewusst – aber Hagelchen … ? Nun, er hatte den einen oder anderen Mord begangen – wäre es da so verwunderlich, dass er ein solches Komplott schmiedete? Marion war innerlich hin- und hergerissen.
„Wie kannst du dir so sicher sein? Woher weißt du so viel darüber?“
Er räusperte sich unbehaglich. „Wie gesagt, ich kannte die Familie Reichenherz. Ist doch auch egal. Der Punkt ist: Ich kenne das Hagelhaus und finde mich dort zurecht. Das war es doch, was du wissen wolltest, oder?“
„Ja.“
„Dann gibt es nicht mehr dazu zu sagen.“
Marion wurde klar, dass es keinen Sinn machte, noch einmal nachzufragen. „Ich nehme an, du machst das nicht umsonst. Was verlangst du?“, fragte sie ihn stattdessen.
„Ich werde gerne im Voraus bezahlt.“
Ohne ein weiteres Wort stieß er sich von dem Baum ab und kam mit ausladenden Schritten auf sie zu. Die Pfeile klapperten leise in seinem Köcher. Einem inneren Impuls folgend, verspürte Marion plötzlich den Drang, vor ihm zurückzuweichen – aber da hatte er auch schon die Hände um ihre Taille gelegt. Er war groß – so groß wie Marion, weshalb sie einander einen Herzschlag lang direkt in die Augen sehen konnten. Dann beugte sich Späher rasch vor und drückte seine Lippen auf ihre.
Mit einem empörten Brummen stemmte sie sich gegen ihn, drückte die Hände an seine Brust, um ihn fortzuschieben. Aber er war kräftiger als sie erwartet hatte. Schließlich resignierte sie. Sie war in den letzten Jahren von unzähligen Männern geküsst worden. Einige von ihnen waren grob gewesen, hatten ihr wehgetan. Spähers Kuss dagegen war der wohl sanfteste und vorsichtigste, den sie je bekommen hatte. Zart, aber keineswegs unbeholfen. Sie war verwirrt und doch gleichzeitig beeindruckt von ihm. Sie erwiderte seinen Kuss nicht, obwohl sie sogar ein wenig Gefallen daran fand.
Schließlich ließ Späher sie los und trat zurück. Er grinste. Einen Moment lang wusste Marion nicht, wie sie sich verhalten sollte. Da besann sie sich, dass sie sich so etwas nicht gefallen lassen musste. Sie holte zum Schlag aus.
Doch Späher war nicht nur kräftig, sondern auch schnell. Er packte ihr Handgelenk und wehrte die Ohrfeige ab. Forsch zog er sie erneut zu sich heran. Sein Gesicht verschwamm vor ihren Augen, ihre Nasenspitzen berührten sich, so nah standen sie beieinander.
„Nein, nein“, sagte Späher kopfschüttelnd. „Bezahlung, nicht Bestrafung. Ich glaube, du hast da etwas missverstanden.“
Marion wand sich und riss sich schließlich los. „Unverschämt“, murmelte sie leise, meinte es aber gar nicht so.
Späher lachte laut. „Was hast du erwartet? Geld will ich nicht, was soll ich damit? Ein Kuss ist doch viel, viel schöner. Und das war nur die Anzahlung.“
Marion hob die Augenbrauen.
„Nicht das, was du denkst. Nun, wir werden sehen, wie sich die Dinge zwischen uns entwickeln.“ Mit seinem rätselhaften Lächeln auf dem Gesicht entfernte er sich von ihr. „Wir sehen uns. Wünsch mir Glück.“
Marion stand eine Weile in der Dunkelheit und dachte über den jungen Bogenschützen nach. Bald würde sie mehr über Hagelchen erfahren. Und sie fürchtete sich vor der Wahrheit. Es fing wieder an, leise zu regnen.