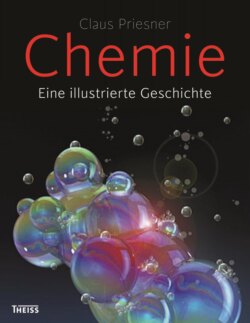Читать книгу Chemie - Claus Priesner - Страница 10
Gebrannte Erde – die Keramik
ОглавлениеAbgesehen von der Nutzung des Feuers zum Kochen oder Braten von Speisen ist es für zwei der ältesten Kulturtechniken des Menschen unerlässlich, der Erzeugung von Keramik und Glas. Die Herstellung gebrannter keramischer Produkte ist nach derzeitigem Kenntnisstand seit 12.000 bis 13.000 Jahren bekannt (Gegenstände aus ungebranntem Ton oder Lehm können derart lange Zeiträume nicht überstehen, weshalb entsprechende Funde fehlen). Älteste Funde bei niedrigen Temperaturen gebrannter Keramik stammen aus Japan und sind etwa 12.500 Jahre alt.1 Im 6. Jahrtausend v. Chr. wurde in Kleinasien die Töpferscheibe erfunden; von da ab war es möglich, rotationssymmetrische Objekte (Schalen, Becher, Teller, Vasen etc.) relativ einfach und schnell zu erzeugen. Besonders in Griechenland erreichte die Töpferkunst schon zu Zeiten Homers einen sehr hohen Grad technischer und künstlerischer Vollendung.
Aus welchen Stoffen bestehen keramische Produkte und wie verändern sich diese auf dem Weg vom Roh- zum Fertigprodukt? Die Basis jeder Keramik ist Ton oder Lehm. Dabei handelt es sich um Verwitterungsprodukte vulkanischer Gesteine, die mit dem Sammelnamen Feldspat bezeichnet werden. Es gibt viele Feldspate, die alle Kieselsäure enthalten. Reine wasserfreie Kieselsäure kennen wir als Quarz; er hat die chemische Formel SiO2. Enthält die Kieselsäure chemisch gebundenes Wasser, kann sie mit Natrium, Kalium, Calcium oder Aluminium Salze, sog. Silikate bilden. In der Regel enthalten die Feldspate auch physikalisch gebundenes »Kristallwasser«. Diese Eruptivgesteine sind hart und kompakt. Durch langsame Verwitterungsprozesse entstehen mehr oder minder feinkörnige Pulver, die sich mit Wasser gut mischen und kneten lassen und die sich fettig anfühlen. Diese nennt man Tone. Wenn ein solcher Ton mit sandigen, oft eisenhaltigen Beimengungen vermischt ist, dann handelt es sich um Lehm. Beide sind nicht zu verwechseln mit der Tonerde, die keine Kieselsäure enthält und auch im feuchten Zustand nicht gut knetbar ist. Sie besteht aus Aluminiumoxid (Al203). Tonerde kann dem Ton oder Lehm als sog. Magerungsmittel zugesetzt werden. Sie ist praktisch unschmelzbar, der Schmelzpunkt liegt oberhalb von 2000 °C. Auch Ton und Lehm sind schwer schmelzbar, lassen sich aber aufgrund ihres Gehalts an Kieselsäure versintern. Dabei schmelzen die einzelnen Körnchen oberflächlich an und backen zusammen. Je nachdem, wie dicht der dabei entstehende »Scherben« ist, unterscheidet man die diversen Sorten der Keramik. Ist der Scherben porös und klebt an der Zunge, handelt es sich um Tongut, auch Steingut oder Irdenware genannt, die bei relativ niedrigen Brenntemperaturen von etwa 850–950 °C entsteht. Bei Brenntemperaturen von mehr als 1000 °C erhält man Sinterware oder Steinzeug, zu dem auch die edelste Form der Keramik, das Porzellan, gehört.
Die Venus von Dolní Věstonice.
Man kann sich recht gut vorstellen, wie es zur Entdeckung der Töpferei kam. Ton oder Lehm kommen überall auf der Erde vor und das Bestreben, aus dieser plastischen Masse etwas zu formen, kann man schon bei kleinen Kindern beobachten. Wenn ein solches Objekt ins Feuer fällt oder hineingebracht wird, verhärtet es sich. Eine solche Beobachtung wurde zu unterschiedlichen Zeiten sicherlich an sehr vielen Orten gemacht und später auch gezielt genutzt. Es gibt auch die Theorie, dass die Töpferei ursprünglich mit der Korbflechterei verbunden war, man also die Zwischenräume in den Geflechten mit Ton oder Lehm ausgekleidet und das Ganze dann im Feuer gehärtet haben könnte. Dies ist aber archäologisch kaum zu beweisen und spielt für uns auch keine Rolle. Sicher ist, dass die Beschäftigung mit dem Ton nicht nur praktischen Bedürfnissen diente, sondern auch der künstlerischen Betätigung. Neben den steinzeitlichen Höhlenmalereien sind gebrannte Tonobjekte die frühesten Beispiele für eine künstlerische bzw. kultische Betätigung von Menschen. Die sog. Venus von Dolní Věstonice in Mähren ist eine Schöpfung der mittleren Jungsteinzeit und wird auf ein Alter von 25.000 bis 29.000 Jahren geschätzt. Zu dieser Zeit waren der Gebrauch und die Herstellung von Keramik sicher noch nicht verbreitet; ihre Herstellung und Nutzung in größerem Ausmaß ist Teil der »Neolithischen Revolution«, die vor ca. 12.000 Jahren begann.
Um Gefäße aus Irdenware wasserdicht zu machen, benötigt man eine Glasur. Porzellan bzw. Steinzeug ist von sich aus dicht. Bei der Glasur handelt es sich um einen glasartigen Überzug, der aus einem vollständig geschmolzenen Material besteht. Glasuren zeichnen sich durch eine vergleichsweise niedrige Schmelztemperatur aus und sind oft chemisch leichter angreifbar als die Keramik selbst. Sie bieten nicht nur einen schützenden und dichtenden Überzug, sie können auch gefärbt werden. Normalerweise wird eine Grundmischung aus Bleioxid mit Ton, Lehm oder Sand hergestellt, die äußerst fein geschlämmt wird. Dazu werden diverse Metallsalze oder -oxide gegeben, die die Masse durchgehend färben. Kobaltverbindungen wie das bekannte »Kobaltblau« ergeben blaue Überzüge, Eisenverbindungen grüne oder rote, Antimonverbindungen gelbe, Kupfersalze grüne bzw. blaue und Braunstein (Mangandioxid) schwarze. Will man ein gemaltes Motiv aufbringen, kann man die Objekte entweder vor dem Brennen bemalen, anschließend in die Glasur tauchen und dann brennen, oder man bemalt sie nach dem Brennen, glasiert sie und brennt sie dann nochmals. Eines der frühesten und eindrucksvollsten Zeugnisse der Glasur von Keramik ist das Ishtar-Tor bzw. die Prozessionsstraße der Stadt Babylon, die im 6. Jh. v. Chr. von König Nebukadnezar II. (605–562) geschaffen wurde.
Beispiele für mehrfarbig bemalte und glasierte Tonwaren sind die Fayencen, benannt nach der italienischen Stadt Faenza, und die Majoliken, deren Name sich von der Insel Mallorca ableitet. Dort errichteten die Araber zur Zeit ihrer Herrschaft in Spanien Töpfereien, die diese Verzierungskunst beherrschten. Im 14. und 15. Jh. etablierte sich diese Kunsthandwerksgattung dann in Faenza und Urbino in Italien. Bekannt wurden auch die mit Kobaltblau bemalten und mit einer farblosen bzw. weißen Zinnglasur versehenen Delfter Kacheln, mit denen im 17. Jh. die teuren chinesischen Porzellanobjekte nachgeahmt wurden und die nach und nach zu begehrten eigenständigen Produkten avancierten. Das simpelste Verfahren der Glasur kann man bei Steinzeug anwenden, indem man einfach Kochsalz (Natriumchlorid) in den Brennofen wirft, das bei den herrschenden hohen Temperaturen mit dem bei der Verbrennung des Brennstoffes (z.B. Holz) freiwerdenden Wasserdampf reagiert und Salzsäuredämpfe freisetzt. Das Natrium des Kochsalzes bildet mit dem ebenfalls vorhandenen Verbrennungsprodukt Kohlendioxid Natron (Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3), das sich an die Wände der Objekte anlegt und aufschmilzt.
Das Ishtar-Tor im Pergamon-Museum in Berlin.
Bedenkt man, wie alt die Töpferei ist, dann kann man durchaus feststellen, dass das Porzellan eine recht junge Erfindung ist. In Europa glaubte man lange, dass dessen Erfindung durch die Chinesen schon in den frühen Dynastien erfolgte. Heute geht man davon aus, dass die Chinesen die Porzellanherstellung im frühen 7. Jh. n. Chr. entwickelten. Porzellan besteht aus drei Komponenten, Kaolin, Feldspat und Quarzsand. In der Regel erfolgt nach dem Formen der Rohlinge ein erster Brand bei moderaten 900 °C, dann erfolgt die Bemalung und Glasur und der zweite Brand bei 1450 °C. Man muss die richtige Sorte Feldspat einsetzen, was nicht so einfach ist, da es, wie gesagt, viele Feldspatvarietäten gibt. Für das Porzellan soll der Feldspat im Wesentlichen ein Kalium-Aluminium-Silikat darstellen und nur wenig Natrium, Calcium und Magnesium enthalten. Das eigentliche Geheimnis der Porzellanfabrikation bildete aber das Kaolin. In Europa war bekannt, dass man diese »Erde« benötigte, wenn man Porzellan machen wollte. Was man hingegen nicht wusste war, welchen Stoff die Chinesen mit dem Wort »Kaolin« bezeichneten. Lange Zeit schlugen alle Versuche, das Rätsel zu lösen, fehl, bis am 15. Januar 1708 der auf der Festung Königstein gefangengehaltene Alchemist und Goldmacher Johann Friedrich Böttger das europäische Porzellan entdeckte. Inzwischen wissen wir, dass Kaolin eine spezielle Form eines Aluminiumsilikats darstellt.
Chinesische Porzellanvase.
Mit der Fabrikation von Keramik hatte man gelernt, Öfen zu bauen, in denen man längere Zeit relativ hohe Temperaturen aufrechterhalten konnte. Dies spielte bei der Herstellung von Baumaterialien wie Ziegelsteinen und Dachziegeln eine entscheidende Rolle. Die massenhafte Fabrikation wasserbeständiger Bausteine ermöglichte den Bau fester Gebäude auch in Gegenden, in denen es öfter regnete. Zudem war es einfacher, ein Haus aus Ziegelsteinen zu errichten, als dafür Natursteine zu verwenden. In trockenen Gebieten verzichtete man auf das Brennen der Ziegel (auch, weil dafür häufig nicht ausreichend Holz vorhanden war) und verbaute luftgetrocknete Lehmziegel.