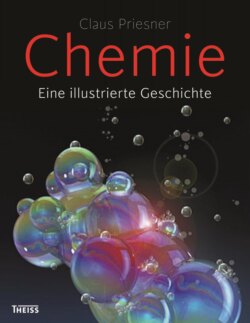Читать книгу Chemie - Claus Priesner - Страница 20
Das Salz
ОглавлениеJeder Mensch kennt und verwendet Salz. Unser gewöhnliches Salz, das Kochsalz, ist nur ein Vertreter einer großen Gruppe chemischer Verbindungen, die gewisse gemeinsame Eigenschaften aufweisen und mit dem Sammelbegriff »Salze« bezeichnet werden. Ein Salz besteht immer aus einem elektrisch positiv geladenen »Kation« und einem negativ geladenen »Anion«. Diese Bezeichnungen hängen mit den Namen der Pole einer Batterie oder eines Akkumulators zusammen, deren negativer Pol »Kathode« und deren positiver Pol »Anode« heißt. Die »Kationen« streben zur Kathode, sind also selbst positiv geladen, die negativ geladenen »Anionen« zieht es zur Anode. Die Kationen der Salze sind in aller Regel Metallionen, also Metallatome, denen ein oder mehrere Elektronen fehlen. Dadurch werden die positiven Ladungen der im Atomkern sitzenden Protonen nicht mehr komplett ausgeglichen und das Kation sucht daher nach einem negativ geladenen Partner, einem Anion. Die Anionen sind meist – aber nicht immer – aus mehreren Atomen zusammengesetzt und stammen von einer Säure, die eine positive Ladung in Form eines Protons verloren hat. Kation und Anion zusammen ergeben dann ein Salz. Die Bezeichnung der Salze erfolgte die längste Zeit hindurch mit willkürlich gewählten »Trivialnamen«, die keine Rückschlüsse auf die chemische Beschaffenheit des jeweiligen Salzes zuließ. Jöns Jakob Berzelius (1779–1848) ein schwedischer Chemiker, führte die heute immer noch übliche systematische Nomenklatur der Salze ein, in der am Anfang das Metall und danach die Säure genannt wird, aus der ein Salz zusammengesetzt ist.
Das Kochsalz heißt demnach Natriumchlorid, weil es aus dem Metall Natrium und der Chlorwasserstoffsäure besteht, die meist mit ihrem Trivialnamen »Salzsäure« benannt wird. Dieser Name ist viel älter als die Nomenklatur von Berzelius und wird verwendet, seit eine chemische Beziehung zwischen Kochsalz und Salzsäure empirisch bekannt war. Bemerkenswert ist die völlige Veränderung der Eigenschaften, die ein Element durch Abgabe oder Hinzufügung eines oder mehrerer Elektronen erfährt. So ist metallisches Natrium ein silberweißes, weiches Leichtmetall, das mit einer Dichte von nur 0,97 g/cm3 leichter als Wasser ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 97,8 °C, bei 881 °C siedet es. Natrium ist ein sehr unedles Metall, d.h., es verbindet sich äußerst leicht mit Sauerstoff oder Wasser. Während z.B. Eisen durch Wasser nur langsam angegriffen wird, also rostet, verläuft dieser Vorgang bei Natrium extrem rasch und so heftig, dass dabei Feuer entsteht (der bei der Reaktion mit Wasser gebildete Wasserstoff entzündet sich durch die freiwerdende Wärme).
Das Natriumion hingegen, das bei dieser Reaktion gebildet wird, ist völlig unscheinbar, farb- und geruchlos. Genauso verhält es sich beim zweiten Bestandteil des Kochsalzes, dem Chlor. Elementares Chlor ist ein gelbgrünes, erstickend riechendes, die Atemwege verätzendes sehr giftiges Gas, welches etwa zweieinhalb Mal so schwer ist wie Luft. Nimmt das Chloratom dagegen ein Elektron auf und wird zum Chloridion, ist es ebenfalls geruchlos, nicht ätzend und – in geringen Mengen – ungiftig.
Plinius bemerkte in seiner »Naturgeschichte« zutreffend: »Sonne und Salz sind unentbehrlich für alles Leben.« Manche Naturvölker, die sich vorwiegend oder ausschließlich von Tieren ernähren, benötigten wenig oder gar kein Salz, alle anderen Menschen mussten ihren Speisen Salz hinzufügen, und zwar umso mehr, je weniger Fleisch sie aßen. Die Ursache hierfür ist der unterschiedliche Gehalt an Natrium- und Kaliumionen in Tieren und Pflanzen. Der Tagesbedarf eines Erwachsenen mit hierzulande üblicher Mischkost liegt bei etwa 5–6 Gramm pro Tag, die Angaben hierzu variieren aber. Natriumionen sind wichtig bei unterschiedlichen Körperfunktionen, so bei der Nervenleitung von Signalen und bei der Muskelbewegung. Diese komplizierten elektrophysiologischen Vorgänge benötigen auch weitere Metallionen, daher ist Kochsalz nicht das einzige Salz, das der Organismus benötigt, wohl aber jenes, das in der relativ größten Menge bereitgestellt werden muss. Unser Magensaft besteht nämlich hauptsächlich aus recht starker Salzsäure (der sog. pH-Wert liegt bei 1,2 bis 1,7), die immer wieder ergänzt werden muss, wofür die Chloridionen des Kochsalzes nötig sind (die Natriumionen steuern vielfältige weitere physiologische Abläufe.) Das eiweißspaltende Magenenzym »Pepsin« enthält zwar selbst kein Chlor, benötigt aber Salzsäure zu seiner Bildung.
Schöne Salzkristalle.
Eine weitere wichtige Eigenschaft des Salzes besteht darin, verderbliche Nahrungsmittel, besonders Fleisch und Fisch, zu konservieren. Beim »Pökeln« wird den Speisen einerseits Wasser entzogen, wichtiger aber ist die Eigenschaft des Salzes, Mikroorganismen unschädlich zu machen, indem es diese entweder abtötet oder verhindert, dass sie chemische Reaktionen mit den Nahrungsmitteln eingehen. Auch pflanzliche Produkte können mit Salz haltbar gemacht werden. So wird das Sauerkraut, ein durch Milchsäuregärung konserviertes Weißkraut, bis zum Eintreten der Gärung durch einen gewissen Zusatz von Kochsalz konserviert.
In der »Neolithischen Revolution«, beim Übergang zur sesshaften Lebensweise mit vermehrter Pflanzenkost, begann wahrscheinlich die Abhängigkeit der Menschen von der Zufuhr von Kochsalz. In Mitteleuropa begann dieser Prozess vor ca. 5000 Jahren mit dem Anbau von verschiedenen Getreidesorten und Leguminosen sowie der Haltung von Haustieren. Damit wurde Salz zu einem Handelsgut, dessen Besitz bzw. dessen Kontrolle von strategischer Bedeutung war.
Auf Wasser brennendes Natrium.
Es gibt drei Hauptvorkommen von Kochsalz, die alle genutzt wurden und werden, nämlich das Meerwasser, salzhaltige Solequellen und festes Steinsalz. Welche der genannten Möglichkeiten aktuell genutzt wird, hängt von der jeweiligen geographischen Situation ab. Grundsätzlich wird immer eine Salzlösung, eine Sole, erzeugt und langsam das Wasser verdampft oder verdunstet, wobei das Kochsalz auskristallisiert. Kochsalz kommt in praktisch unbegrenzter Menge im Meerwasser vor, das einen Salzgehalt von durchschnittlich 3,5 % aufweist. Das Meersalz besteht durchschnittlich zu 78 % aus Kochsalz, dazu kommen 10 % Magnesiumchlorid, 6 % Magnesiumsulfat und 4 % Calciumsulfat (Gips). Eine Vielzahl weiterer Salze findet sich in Spuren.
Seit wann Salzgärten zur Gewinnung von Meersalz angelegt wurden, lässt sich nicht sagen. Manche verweisen auf den römischen König Ancus Martius (regierte 641–616 v. Chr.), der die Salinen an der Tibermündung angelegt haben soll. Es ist jedenfalls anzunehmen, dass die natürliche Verdunstung von Meerwasser in Lagunen oder nur zeitweise gefluteten Becken hier als Vorbild diente. In Ägypten wurde am Mareotis-See, einer Lagune bei der Stadt Alexandria, schon in der Antike und bis in die Gegenwart Salz gewonnen. Man rammte dazu Holzpfähle in den Seegrund, an denen sich das Salz in groben Kristallen absetzte.
Neben der Eindampfung von Sole bzw. Meerwasser und der Salzgewinnung durch Verdunstung des Wassers gab es schon in vorgeschichtlicher Zeit den Salzbergbau. Im Erdinneren lagern an vielen Stellen mächtige Sedimentschichten aus Salz, die von ausgetrockneten urzeitlichen Meeren stammen. An manchen Stellen treten diese Salzmassen in Form der »Salzgletscher« zutage, so in Cardona in Katalonien. Obwohl hier ziemlich reines Kochsalz vorliegt, verliert der Salzgletscher in einem Jahrhundert nur etwa 10 cm an Höhe, was natürlich auch dem trockenen Klima geschuldet ist.
Normalerweise tritt Steinsalz aber nicht an der Erdoberfläche aus, sondern muss bergmännisch gefördert werden. Dieser Salzbergbau ist uralt und in Mitteleuropa besonders mit dem Volk der Kelten verbunden. Alle Ortsnamen, die mit Salzlagerstätten oder Solequellen in Verbindung stehen und »Hal« enthalten (Hall in Tirol, Halle an der Saale, Schwäbisch Hall, Hallein, Hallstatt, Reichenhall etc.), verweisen auf das keltische Wort für Salz und zeigen an, dass hier zu keltischer Zeit Salz gewonnen wurde. Der chemische Begriff »Halogen« umfasst die »Salzbildner« Fluor, Chlor (»Salzsäure«), Brom und Jod bzw. deren Säuren.
Das am längsten durchgehend betriebene Salzbergwerk der Welt befindet sich in Hallstatt im oberösterreichischen Salzkammergut. Archäologische Befunde lassen vermuten, dass hier schon vor ca. 7000 Jahren Salz gewonnen wurde, allerdings im Tagebau bzw. durch Nutzung von Solequellen. Um 900 v. Chr. begann der bergmännische Abbau von Steinsalz. 1734 entdeckte man bei Reparaturen in einem teilweise eingestürzten Stollen den »Mann im Salz«, einen ausgezeichnet erhaltenen (allerdings stark komprimierten) Leichnam eines keltischen Bergmanns, der vermutlich mehr als zwei Jahrtausende im Salz eingeschlossen war.
Ein anderes, ebenfalls uraltes Bergwerk besteht in Wieliczka in Polen. Auch dort wurde um 3500 v. Chr. schon Sole versotten, um 1250 begann dann nach dem Versiegen der Solequellen der Abbau von Steinsalz. Zeitweise war Wieliczka eines der größten Salzbergwerke Europas. Berühmt war es aber nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen der prunkvollen Gestaltung einzelner Salzkavernen. Salz war ein bedeutendes Handelsgut. Wer über Salzvorkommen gebot oder die Salzhandelsrouten kontrollierte, besaß Macht und Einfluss. Da in Mitteleuropa wichtige Salzlagerstätten existierten, wurden schon früh Kriege wegen des Salzes geführt, von denen etwa der römische Geschichtsschreiber Tacitus (um 58 – um 120) berichtet.
Im volksmagischen Brauchtum (immer noch vielfach falsch und abwertend als Aberglauben bezeichnet) nimmt bzw. nahm das Salz eine hervorragende Stelle ein. Salz musste immer im Haus sein, um es vor bösen Mächten zu schützen, und wurde daher oft auch schon in die Mauern oder Fundamente eingearbeitet. Salz zu verschütten, bringt Unglück – ein Hinweis auf die frühere Kostbarkeit dieses Stoffes und ein noch heute anzutreffender Glaube. Gemeinsam genossenes Salz bei Tisch verbindet die Tischgenossen und ein Fremder steht unter dem Schutz des Gastrechts, sobald er vom Salz des Hausherrn gegessen hat. Salz ist auch ein Symbol der Treue und Beständigkeit, was vielleicht mit den früher unentbehrlichen Eigenschaften des Salzes als Konservierungsmittel zusammenhängt. Brot und Salz als elementare Lebensmittel werden noch heute beim Einzug in ein neues Heim geschenkt, um Unheil und Mangel fernzuhalten. Salz kann allen bösen Zauber unwirksam machen, weshalb Hexen, Teufel und Dämonen es verabscheuen.
Die St. Kinga-Kapelle im Salzbergwerk Wieliczka.