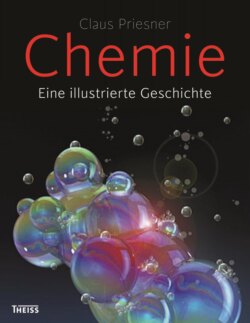Читать книгу Chemie - Claus Priesner - Страница 11
Geschmolzene Erde – das Glas
ОглавлениеEng verbunden mit der Töpferkunst ist die Geschichte des Glases. Obwohl Unsicherheit hinsichtlich der Ursprünge der Glasbereitung herrscht, steht doch fest, dass die Geschichte der Glasbereitung weitaus kürzer ist als die der Töpferei. Die Schätzungen reichen vom 5. oder 4. bis in die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. Vermutlich sind die ersten Gläser bei Versuchen zur Herstellung von Glasuren entstanden. Im Lauf der Zeit haben sich aus diesen Anfängen dann eigenständige Techniken zur Herstellung farbiger und durchscheinender Schmelzen entwickelt.
Das Wort »Glas« wurde im germanischen Sprachgebrauch ursprünglich für Bernstein verwendet und danach auch auf aus dem Römischen Reich eingeführte farbige Glasperlen angewandt, die man als Ersatz bzw. als Nachahmung farbiger Edel- und Halbedelsteine ansah. In der Anfangsphase waren diese noch undurchsichtigen kleinen Glasobjekte ähnlich selten und wertvoll wie echte Edelsteine. Im Gegensatz zur Keramik sind Gläser echte Schmelzen. Wichtigster Rohstoff des Glases ist der Quarzsand (wasserfreie Kieselsäure, SiO2). Sein Schmelzpunkt liegt mit über 1500 °C sehr hoch. Flussmittel wie Soda (Natriumcarbonat, Na2CO3) oder Pottasche (Kaliumcarbonat, K2CO3) machen die Mischung leichter schmelzbar. Allerdings wird das Glas mit steigendem Alkalianteil auch immer leichter wasserlöslich, bis hin zum »Wasserglas«, das man früher zum Einlegen von frischen Eiern benutzte. Um die Wasserempfindlichkeit zu reduzieren, setzt man Kalk (Calciumcarbonat, CaCO3) zu. Die diversen Glasmischungen werden in geeigneten Glasöfen zusammengeschmolzen. Die Öfen entwickelten sich aus den bei der Töpferei verwendeten Brennöfen. Glas wurde seit 1600 v. Chr. in Mesopotamien als kompakter Klumpen (»künstlicher Stein«) gewonnen. Gegen 1400 v. Chr. entstand die »Sandkerntechnik« zur Hohlglasfabrikation. In Alexandria fertigte man um 300 v. Chr. berühmte Mosaikgläser. Um 50 v. Chr. erfolgte in Phönizien die entscheidende Erfindung, das bis heute gebräuchliche Blasen von Glas mit der Pfeife. Jetzt konnte man dünnes, durchsichtiges Glas in großer Menge produzieren. Eine Vielzahl von Glashütten machten das Glas bereits im 1. Jh. n. Chr. zur Massenware.
Während des Mittelalters und der Neuzeit erfolgten zahlreiche Verbesserungen und Weiterentwicklungen, etwa das Bleikristallglas oder der Strass-Schmuck. Ersteres ist vor allem in Böhmen und im Bayerischen Wald hergestellt worden und hat seinen Namen von einem Zusatz von Bleioxid, der dem Glas einen hohen Brechungsindex und dadurch einen schönen Kristallglanz verleiht.
Porträt von Johannes Kunckel (um 1630–1703).
Der Elsässer Georg Friedrich Strass (1701–1773) entwickelte diese Technik weiter und ihm gelang es, mit Bleikristallgläsern Diamanten zu imitieren. Da am Hof König Ludwigs XV. ein beträchtlicher Bedarf an edel aussehendem Schmuck vorhanden war, wurde der Strass-Schmuck ein echter Verkaufserfolg und Strass sogar zum Hofjuwelier ernannt.
Aufsehen erregte auch der Alchemist Johannes Kunckel (1630/38–1702/03), der am Hof des Kurfürsten Johann Georg II. von Sachsen wirkte. Er beschäftigte sich ausgiebig mit der experimentellen Erforschung von Glasmischungen und entdeckte dabei ein rubinrotes Glas. Tatsächlich ist das »Goldrubinglas« eine kolloidale Lösung von Gold in der Glasmasse.
Der Becher aus Goldrubinglas mit dem Deckel aus dem Besitz der Wittelsbacher wird traditionell Johannes Kunckel zugeschrieben.