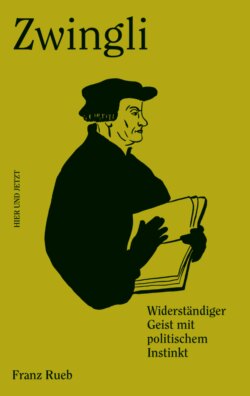Читать книгу Zwingli - Franz Rueb - Страница 13
WIEN
ОглавлениеNach nur zwei Jahren in Bern erlangte der junge Zwingli erstaunlicherweise bereits die Reife für die Universität. Noch im Herbst 1498 hat er sich an der Universität Wien immatrikuliert; die Einschreibung liegt vor, sein gewollter Eintritt ins Studium ist belegt. Er war noch nicht ganz 15-jährig, ein Rätsel im Rahmen unserer heutigen Bildungsvorstellungen. Sicher ist er zu Fuss nach Wien marschiert oder gewandert, mindestens zwei bis drei Wochen wird er unterwegs gewesen sein, vermutlich in Begleitung von anderen jungen zukünftigen Akademikern, denn die Wiener Universität wurde von mehreren Schweizern aufgesucht. Was heute ein unvorstellbarer Gewaltsmarsch wäre, galt in jener Zeit als nicht aussergewöhnlich.
In Wien gab es anscheinend an der Universität Probleme, denn Zwinglis Eintragung «Udalricus Zwingly de Glaris» ist durchgestrichen, daneben steht mit fremder Handschrift «exclusus». Dieser Umstand hat in der Geschichtsschreibung grossen Rumor ausgelöst und einige Autoren zu feindseligen Spekulationen verleitet. Es ist nie bekannt geworden, was vorgefallen war, was der Grund war für den Ausschluss, ob wirklich ein solcher stattgefunden hat. Es gibt die Vermutung, diese Eintragung sei ein paar Jahrzehnte später, wohl am ehesten in der Zeit der Gegenreformation, von einem Fanatiker neben den Namen des Ketzers gesetzt worden. Auch Zwingli hat sich später nie dazu geäussert, konnte wohl gar nicht, sollte diese Eintragung neueren Datums gewesen sein. Oder war ihm die Episode zu unbedeutend, war sie ihm vielleicht unangenehm? Es wird vermutet, der junge Schweizer sei in eine studentische Rauferei verwickelt gewesen, denn es ist zu bedenken, dass es die Zeit des Schwabenkriegs war.
Vielleicht sind deutsche und schweizerische Studenten aufeinandergeprallt. Vermutlich ist er zu Fuss ebenso selbstverständlich wieder zurückgewandert in die Schweiz. Aber auch darüber wissen wir nichts Genaues. Anderthalb Jahre später, im Sommersemester 1500, findet sich die zweite Immatrikulation, diesmal folgendermassen: «Udalricus Zwingling de Lichtensteig im Toggenburg». Der Grund für den Ausschluss im Herbst 1498 konnte also nicht allzu gravierend gewesen sein. Seltsamerweise kommt kaum ein Kommentator auf diese Konklusion zu sprechen. Und zudem fällt auf, wie Oskar Farner sagt, dass der Vermerk und die in solchem Falle übliche Notiz «reincorporatus» oder «reinclusus» für wieder Aufgenommene in den Hochschulverband fehlt. Farner stellt auch fest, dass kein einziger Zeitgenosse von dem Vorfall Kenntnis hatte. Zwingli war hochprominent, als «Ketzer» einer der bestgehassten Existenzen der Zeit, es wäre doch höchst verwunderlich, wenn seine Feinde, wäre denn hier ein ernstzunehmendes Fehlverhalten Zwinglis nachzuweisen, davon niemals Gebrauch gemacht hätten. Der Erste, der diese «Exclusus»-Geschichte entdeckt und in Umlauf gebracht hatte, war der Abt von Einsiedeln in der Zeit der Gegenreformation ein halbes Jahrhundert nach Zwinglis Tod. Von da an wurde sie unermüdlich nacherzählt, aber nie nachgeprüft.
Aber eine andere Frage bleibt: Wo war der junge Zwingli in den anderthalb Jahren dazwischen? In den Vermutungen taucht Paris auf, dann auch Tübingen. Belege für beide Annahmen gibt es keine. Wir wissen es also nicht. Und er hat nie dazu Stellung genommen. Ob er nun in Paris an der Universität der Scholastik oder in Tübingen seine Studien fortgesetzt hat, man braucht sich heute für keine der beiden Varianten zu entscheiden, von Bedeutung ist, dass er die Zeit genutzt hat, und das dürfen wir wohl annehmen. Zwingli war inzwischen ein Kenner der Lehren des Thomas von Aquin, und er war in jungen Jahren ein ausgezeichneter Aristoteliker, er wurde von seinen Freunden sogar «der Aristoteliker» genannt, was dafür sprechen könnte, dass er in Paris gewesen ist.
In Wien, an der Hochburg des damaligen europäischen Humanismus, betrieb er zwei Jahre lang seine Studien. Wie er dort gelebt hat, wissen wir aber nicht. Er wird in einer der Bursen oder einer Coderie gewohnt haben, einer Art Studentenpension in der Umgebung des Hochschulgebäudes, unter mehr oder weniger strenger Aufsicht der Universitätsbehörden, mit vorgeschriebener Kopfbedeckung, einem bestimmten Gürtel, nur so waren die Studierenden berechtigt, an den Privilegien teilzunehmen. Da es immer wieder zu Schlägereien und kleinen Strassenschlachten zwischen Gruppen und Nationalgrüppchen gekommen war, hat die Universität das Tragen von Waffen, Säbeln und Degen verboten. Der junge Zwingli war dort in Gesellschaft von einigen Studenten aus dem Toggenburg, aus Glarus, aus Chur, aus Schaffhausen und aus Zürich. 1501 kam der St. Galler Joachim von Watt, latinisiert Vadian, ein Mediziner und später vom Kaiser gekrönten Dichter, nach Wien, wo er es bis zum Rektor brachte.
Er wurde ein enger Mitarbeiter und Freund des Reformators Zwingli und setzte in St. Gallen als Stadtarzt und Bürgermeister die Reformation durch. Zwingli belegte in Wien Kurse in der Kunst des Briefeschreibens. Kein Wunder, dass er später zu einem grossen und reichhaltig bewegenden Briefschreiber wurde, der mit Gelehrten ganz Europas Briefwechsel führte. Die Studenten übten mit Professoren Komödien und Tragödien des klassischen Altertums ein, auch das eine Disziplin, die der Reformator in den 1520er-Jahren mit seinen Studenten und Schülern in der Zürcher Prophezei immer wieder mit Genuss durchspielte.
Es gab im Studentenleben Zwinglis ein starkes literarisches Erlebnis des ganz jungen Ulrich. Er unterstrich und glossierte Sätze von Pico della Mirandola (1463–1494), dem Florentiner Philosophen, wonach es dem Menschen oft missrate, wenn er nicht die nötige Wortgewandtheit aufbringe, um seine Absicht durchzubringen. Daneben schrieb der junge Scholar, dies sei ihm auch passiert, als er eine Nachricht nach Hause geschickt habe, die dem Vater seinen Lebenswandel, sein Studium hätte empfehlen sollen. Er habe seine Musik, die Instrumente mitsamt den Geselligkeiten aufgezählt. Der Vater aber habe nur geantwortet, ihm wäre ein Philosoph lieber als ein sogenannter Komödient. Es ist die einzige und zudem gewichtige Äusserung des Vaters über seinen Sohn.
Die Beschäftigung mit dem jugendlichen Philosophen Pico della Mirandola hat sich dann über Jahre hinweg weitergezogen. Zwingli nennt ihn einen Mann von grossem Scharfsinn, aus welchem, wenn Gott ihn hätte zur Reife kommen lassen, etwas Göttliches geworden wäre. Mirandolas Rede über die Würde des Menschen ist berühmt geworden, ausserdem schrieb er über die Willensfreiheit, die er ein charakteristisches Merkmal des Menschen nannte. Er formulierte 900 Thesen zu theologischen und philosophischen Fragen. Der Papst verurteilte diese Thesen, der Autor geriet in Rom unter Häresie-Verdacht. Doch er stand unter dem Schutz des Fürsten von Florenz, Lorenzo der Prächtige. Mirandola starb an einem Fieber, er war erst 31-jährig.
Zwingli hat sich intensiv mit dem jugendlichen Philosophen beschäftigt. Er las seine Schriften, kommentierte sie, strich wichtige Sätze an. Er war geradezu ein Bewunderer dieses Pico della Mirandola.