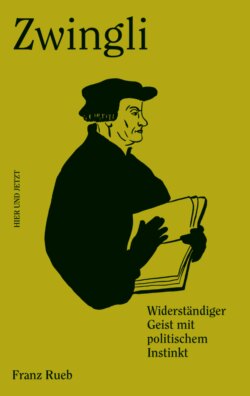Читать книгу Zwingli - Franz Rueb - Страница 9
ZÜRICHS GERINGE WIRTSCHAFTSKRAFT
ОглавлениеDie Jahrzehnte vor der Reformation im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert waren gekennzeichnet durch ein überwiegendes politisch-kriegerisches Interesse dieser urtümlich heldenhaften Eidgenossen. Die wirtschaftliche Kraft der einzelnen Orte des Bundes ging wegen der steten Kriege fast überall zurück. Die Dominanz der Kriegsmentalität, der Kriegsschrecken und die Kriegsopfer von mehreren Generationen vor der Reformation können nicht genug betont werden. In der publizistisch-populären Zwingli-Literatur liest sich die Schlacht bei Kappel im Jahre 1531 vielerorts so, als habe hier Zwingli in einer Zeit grosser und langanhaltender Ruhe im friedlichsten Land einen Krieg angezettelt, dem er dann selbst zum Opfer gefallen sei.
Während die St. Galler Leinwandindustrie ihre Stellung zu behaupten vermochte und in viele europäische Länder exportierte, hatte in der Limmatstadt Zürich das Gewerbe um 1500 nur noch lokale Bedeutung, das heisst, man exportierte kaum noch Güter. Die einst blühende Seidenindustrie war nun fast ganz verschwunden. Es blieb die gute Verkehrslage der Stadt zwischen den Alpenpässen zum Süden und den Städten im Reich. Die wirtschaftliche Situation war, trotz Vieh-, Getreide- und Salzhandel, so schlecht, dass fast alle gesellschaftlichen Gruppen Stagnation und sogar Rückgang wahrnahmen. Und das machte sie hellhörig und empfindlich.
Die Bauern klagten über die Abgaben und die Handelsbeschränkungen für ihre Produkte. Die Handwerker jammerten über steigende Lebenshaltungskosten, steigende Löhne der angestellten Gesellen und über höhere Materialpreise. Die reichen Pfründner bemerkten einen Vermögensrückgang und die Kaufleute wetterten über die Gebühren, Zölle und Steuern. Alle produktiv Tätigen waren unzufrieden. Nur die Soldherren, die «Pensionenritter», die dem Papst, dem Kaiser und den diversen Königen und Fürsten Schweizer Soldaten und Waffen verkauften, diese Pensionäre strichen fortwährend dicke Gewinne ein, liessen sich schmieren und bestechen, Hauptsache, der Gulden rollte.
Die Gesellenorganisationen in allen Berufen strebten danach, ihre Freizeit im Kreise ihrer Alters- und Berufsgenossen in eigenen Trinkstuben und Gesellenherbergen zu verbringen, sich von der Kontrolle ihrer Meister zu lösen und selbstständige Sicherungen für Krankheit, Tod und Begräbnis zu schaffen. Sie machten lediglich 10 bis 12 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die Gesellen wurden aber immer stärker von Meister, Zunft und Stadt unter Kontrolle gestellt.
Die jungen Männer in der freien Schweiz waren so frei, das Interesse für eintönige Handels- und Gewerbetätigkeit oder die Feldarbeit zu verlieren und von sich zu weisen, sie fanden keinen Gefallen mehr an den bescheidenen, engen Verhältnissen in den Bergtälern der Innerschweiz, am langweiligen Handwerk oder an der Scholle hinter dem Wald. Unter diesen Bedingungen spross ein zynisches Verhältnis zum Vaterland, zur gebremsten und fehlgeleiteten Entwicklung des eigenen Landes, besonders bei denen, die gross mit dem Vaterland prahlten. Diese Entwicklung spürte der Student Zwingli und später noch verschärft der junge Priester auf dem Land schmerzlich. Man kam und ging, wie es gerade passte, man warf mit dem Geld um sich, das man mit dem Kriegshandwerk in fremden Diensten verdient hatte, man haute die geplünderte Beute auf den Kopf, egal, ob man ein körperlicher oder seelischer Krüppel war. So wurde der Reislauf (der Eintritt in fremden Dienst als Söldner) zum Hauptübel der Gesellschaft, und er beschleunigte die wirtschaftliche, soziale, politische wie moralischsittliche Verluderung. Dies ist nicht nur die Deutung Zwinglis und seiner Mitstreiter. Mehrmals, bereits einige Jahre vor Zwingli, wurden die sogenannten Blutsverkäufer bekämpft, die Reisläuferei wurde verboten und strengere Sittenmandate erlassen; die Verbote wurden nach kurzer Zeit wieder fallen gelassen. Das war überhaupt ein wichtiges Kennzeichen der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Vor-Zwingli-Zeit: Sittenmandate wurden immer und immer wieder erlassen, aber sie wurden kaum befolgt. Die Obrigkeit konnte sich nicht durchsetzen, was sich übel auswirkte auf das Gemeinwesen und somit auf die Gesellschaft der damaligen Zeit. Die sittliche Lage war katastrophal.
Ganze Stadt- und Staatshaushalte, vor allem in den inneren Orten, waren von den fremden Pensionen abhängig. Der französische König zahlte weitgehend die «Betriebskosten» dieser Gemeinwesen. Rom zahlte den Priestern bescheidene Unterstützungsgelder, um sie an das Papsttum zu binden. Von den unermesslichen Reichtümern, welche überall aus dem Volk herausgepresst und nach Rom abtransportiert wurden, verteilte man ein paar Gulden an die kirchlichen Statthalter, die dafür zu sorgen hatten, dass die römische Kirche im Dorf blieb.
Soldverträge und Reislaufen kamen der Allgemeinheit wirtschaftlich kurzfristig zugute, mochten die Schäden sonst noch so bedenklich ins Gewicht fallen. Die Gesellschaft war im gefährlichen Würgegriff «konformer Korruption» auf sämtlichen Gebieten. Die kirchlichen und behördlichen Missstände waren den ohnmächtigen Räten längst entglitten. Die Obrigkeit begann, kirchliche Befugnisse an sich zu reissen.
Man wollte zwar keinen Bruch mit dem Alten, man wollte behutsame Änderungen, unter eigener Regie. Die erwachte Zürcher Bürgerschaft wollte aus der Auslandsabhängigkeit herauskommen. Das ging nur, wenn es gelang, das eigene wirtschaftliche Potenzial zu entwickeln und zu stärken. Man wollte nicht mehr die eigene Haut oder das eigene Blut, dafür mehr eigene handwerkliche Artikel auf die internationalen Märkte tragen. Gegner dieses politökonomischen Willens der Handwerkermeister und Kaufleute in der Zünfterstadt Zürich waren die inländischen Kriegsdienstherren, und zwar, und das ist wichtig, lange vor der Reformation und vor Prediger Zwingli. Es fehlten Arbeitskräfte, weil die jungen Männer scharenweise auszogen auf die Schlachtfelder Europas. Die Lohnforderungen zu Hause stiegen, da die Männer im Waffendienst besser entlöhnt und zudem korrumpiert wurden durch die Möglichkeit, sich an brutalen Beutezügen zu beteiligen. Das Gemeinwesen zu Hause verrottete. Der Gegensatz zum Klerus und zum Adel wurde schärfer, zu gerne hätte man beide abgeschüttelt. Das Selbstbewusstsein der Gewerbetreibenden stieg. So wurden die Zürcher Zunftherren, die im Grossen Rat sassen, durch ihre wirtschaftspolitischen Interessen zu Gegnern des Solddienstes. Und ihr zentrales Bestreben war die Emanzipation von Papst, König und Kaiser, vor allem die Eindämmung der Macht und des Einflusses der römischen Kurie.
Das waren die Voraussetzungen dafür, dass dieser humanistisch gebildete Toggenburger Leutpriester, der in Einsiedeln durch seine evangelischen und antipapistischen Predigten von sich reden gemacht hatte, von den Zünftern und Räten nach Zürich geholt wurde. Er sollte die Emanzipationsbewegung der republikanischen Stadtgemeinschaft aus der bischöflichen Oberhoheit religiös und ideologisch untermauern und befördern. Der Mann ging mit einem solchen Schwung und mit solcher Radikalität zu Werke, dass die Bürger gezwungen waren, mitzuziehen.