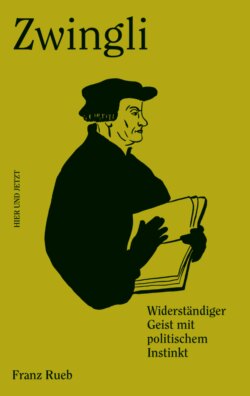Читать книгу Zwingli - Franz Rueb - Страница 6
ZWINGLIS TOD
ОглавлениеSein Tod war sinnlos. Er ist in der Schlacht gefallen, in einer der blödsinnigsten Schlachten aller blödsinnigen Schlachten. Aber wir wissen nicht, ob er gekämpft hat; es sind alles nur Vermutungen. Es ist nicht anzunehmen, dass er mit der Waffe in der Hand gekämpft hat. Doch er ist auf dem Schlachtfeld zu Tode gekommen, das ist unbestritten. Ihn heute deswegen als Kriegsgurgel zu diffamieren, wie das oft getan wird, ist demagogisch, und ihn im Denkmal als finsteren Mann mit Schwert darzustellen, wie das in Zürich im 19. Jahrhundert durch einen katholischen Tiroler Bildhauer geschah, abgesegnet und prämiert von den reformierten Stellen der Zürcher Kirche und ihres Staates, wird weder der Geschichte noch Zwingli als Menschen und seinen Leistungen sowie seiner Bedeutung gerecht. Er ist als teilnehmender Feldprediger in der Schlacht gefallen. Der Gipfel dieses Unsinns, nämlich gesund und stark, geistig leistungsfähig im Alter von 47 Jahren auf dem Schlachtfeld, und zwar nach dem Kampf, abgestochen oder erschlagen zu werden, wurde dadurch erreicht, dass er selbst wohl einiges dazu beigetragen hat, dass es überhaupt zu diesem überflüssigen Kampf mit Schwertern und Hellebarden gekommen ist. Dass er aufgerufen hat zum unausweichlichen Waffengang gegen die feindlichen und feindseligen und schlachtbereiten Katholiken der Innerschweiz. Das war wohl seine Untat schlechthin, das hat ihn sein bewundernswürdiges, fruchtbares Leben gekostet. Und es ist einer der Gründe für seinen unberechtigt fragwürdigen Ruf in der oberflächlichen populären Wahrnehmung.
Altgläubige Schlachtteilnehmer haben den Säntis-Galöri, wie er in der Innerschweiz seit Jahren genannt wurde, gefunden.
Sie haben ihn erkannt, sie werden sich mit triumphalem Geschrei auf ihn gestürzt haben: Er war damals der bekannteste Mann im Land, und in dem altgläubigen Teil der verhassteste. Er lag wahrscheinlich bereits verwundet auf der Erde, stöhnte und röchelte, vielleicht lag er sogar schon tot unter einem Baum, wir wissen es nicht. Sie schlugen, aufgehetzt vom Hass, auf seinen Schädel ein. Die Schlachtopfer lagen kreuz und quer und nach ihrer konfessionellen Zugehörigkeit gemischt auf dem Feld herum. Er war als evangelischer Prediger irgendwie gekennzeichnet. Mit Geheul haben sie ihn gevierteilt, verbrannten wahrscheinlich seinen Leib und verstreuten seine Asche in einem Wäldchen in Kappel. Vielleicht haben sie ihn auch einfach verscharrt, wie gesagt, es ist nicht belegt, was genau geschah. Aber es war am 11. Oktober 1531 und es war die zweite Schlacht bei Kappel.
Zwingli wurde als Toter noch einmal hingerichtet. Und seither wurde er noch ungezählte Male hingerichtet. Das Ende des Landesverräters und Ketzers wurde unheimlich laut gefeiert. Die Eidgenossenschaft war zu der Zeit in einem ungeahnten Mass gespalten, in städtische und ländliche Gebiete. Die zwei Lager standen einander in einer Art bisher nie gekannter Todfeindschaft gegenüber, dass es rückblickend sogar fast wie ein kleines Wunder wirkt, dass das Land, genauer das Bündnisgeflecht, damals an diesem Gegensatz und am Hass nicht auseinandergebrochen ist. Die Reformation hat in der Schweiz, wie in Europa, einen ungeheuren geistigen Aufbruch initiiert, aber gleichzeitig mit der religiösen Spaltung ganz neuartige explosive Gegensätze und Feindschaften hervorgebracht. In allen Ländern Europas gingen die Konfessionen in den kommenden Jahrzehnten aufeinander los, die Starken verfolgten die Schwachen, die Schwachen ergriffen die Flucht, um ihr nacktes Leben zu retten.
Zwinglis frühes Ende wurde von den Gegnern als Beweis für die Falschheit seiner Lehre genommen, als hätte Gott Regie geführt. Doch seine Lehre ist noch heute gültig. Verbreitet und geglaubt wurde die Behauptung mit Schadenfreude, Gott selbst habe ihn gerächt. Selbst Martin Luther triumphierte, da die beiden Reformatoren sich in einigen theologischen Anschauungen diametral und grundsätzlich gegenüberstanden, vor allem was den Abendmahlsstreit anbelangt. Zwinglis Lehre war in allen Teilen radikaler als diejenige Luthers. Darum: Zwinglis Fall sei Gottes Urteil, posaunte Luther.
Was ist an Dummheiten darüber geredet und geschrieben worden, vor allem über Zwinglis Tod. Fünfhundert Jahre wurde dieses die Geschichte entstellende Gerede durch die Zeiten gejagt. Es sind viele Geschichten erfunden worden.
Bleiben wir vorerst kurz beim Ende, welches später zusammen mit dem Kriegsverlauf noch genauer beschrieben werden soll. Darüber gab es langes und breites Spekulieren und Behaupten. Als sie sich auf ihn stürzten, müssen sie ihm zyklopenhaft, wie von den Bergen heruntergestürzt, mit Felsbrocken und gewaltigen Waffen in ihren Armen und Händen erschienen sein, da er bereits dem Ende entgegendämmerte. Sie werden ihm in die Augen geschaut haben, er schaute müde, schmerzverzerrt zurück, einer stiess ihm mit einer riesenhaften Gabel ins eine Auge, während ihm der andere mit einer Hellebarde auf den Kopf schlug und seinen Schädel zertrümmerte. Es ist nicht belegt, ob er Helm trug oder baren Hauptes war. Im Landesmuseum wird ein gespaltener Helm museal aufbewahrt und gezeigt. Aber es ist nicht gesichert, ob der Säntis-Galöri noch lebte oder bereits tot war und ob er überhaupt einen Helm getragen hat. Ein Mann, der wie Zwingli im Fadenkreuz der Feindschaften gestanden hat, der löste zu allen Zeiten ungeahnte widersprüchliche Geschichten aus.
Zwei Jahre zuvor, als die Schlacht vor Beginn gestoppt worden war, wie die Chronisten nachträglich schrieben, und die Parteien sich mit ihrem Kriegsgerät auf dem Feld operettenhaft in die Wiese hockten und die Milchsuppe der Innerschweizer, darin das Brot der Zürcher, ausgelöffelt hatten, war selbst das nicht so lustig, wie es von Genremalern über die Jahrhunderte dargestellt worden war. Historienmalerei nannte man das. Mit der Historie war diese Malerei geistig kaum in Berührung gekommen. Ihr Naturalismus ist lächerlich, ohne geschichtsphilosophischen Anspruch. Die Wahrscheinlichkeit des gepinselten Geschehens war astronomisch weit weg von den tatsächlichen Ereignissen. Die Künstler versuchten eine Art antiquarische Genauigkeit, sie malten museale Schlitz-Wämschen, Blech-Rüstungen, Helmchen, bunte Federbüsche auf den Köpfen, sie zeichneten grosse Bärte und auffallende Schnurrbärte und verwegene Blicke. Sie inszenierten ein folkloristisches Milch-Suppen-Picknick von fröhlich herausgeputzten, hübsch kostümierten Kriegsknechten, die zu den Löffeln greifen. Auf diesen Bildern sieht alles so adrett und unschuldig aus wie auf den Bühnen der Tellspiele in den innerschweizerischen Ortschaften. Der kriegerische Feldzug ist hier nicht spürbar, obwohl wir doch mitten in der Zeit der Söldnerei lebten und ungezählte Innerschweizer jahrelang Reisläuferei betrieben. Bedrohung, Hass zwischen den Konfessionen, verbreiteter Schrecken oder Angst, nichts von all dem lässt sich auf den Bildern ahnen. Hier befindet man sich auf einem Ausflug einiger theatralischer Waffenbrüder, die sich im Feld romantisch gestimmt bei der Vesper treffen. Damals gab es noch keinen Cervelat und keine Feuerstellen für die Schweizer Familie, sonst hätten die Mannen Würste gebraten.