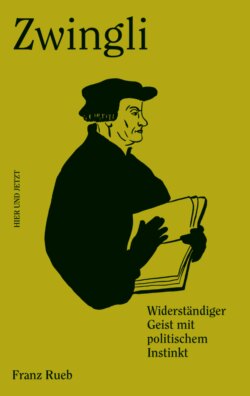Читать книгу Zwingli - Franz Rueb - Страница 17
PFARREI IN GLARUS
ОглавлениеIn diesem europäischen Umfeld also bewegte sich der junge Zwingli. Er war noch keine 22 Jahre alt, da bewarb sich die Gemeinde Glarus, deren Pfarrer gestorben war, um seine Dienste. Man kann annehmen, dass die Empfehlung von Weesen ausgegangen war, dass Onkel Bartholomäus und der frühere Basler Lehrer Gregor Bünzli den jungen Theologen vorgeschlagen hatten. Zwingli hielt in Rapperswil seine Probepredigt, die zur Zufriedenheit ausfiel, er wanderte – oder ritt – im Sommer 1506 nach Konstanz und liess sich dort vom Bischof zum Priester weihen. So kam der Toggenburger also zu seiner ersten Pfarrstelle. Und da sollte er denn zehn Jahre bleiben. Er musste bei den Glarnern Geld aufnehmen, um die Pfründen des üblen Schmarotzers und Römergünstlings Heinrich Göldli abzugelten. Die Summe war so horrend, dass er die ganzen zehn Glarner Jahre brauchte, um die Schuld abzutragen. Er schrieb an Balthasar Stapfer in Schwyz, ohne Datum, doch es muss sich um die Zeit handeln, als er von Glarus nach Einsiedeln wechselte: «Ich habe so friedlich und freundlich bei meinen Herren in Glarus geweilt, dass ich mit ihnen nie einen Streit hatte, und ich stand drum bei meinem Wegzug in solcher Gunst bei ihnen, dass sie mir die Pfrund noch zwei Jahre lang weiter überliessen, indem sie hofften, ich werde wieder zu ihnen zurückkehren, was ich auch gern getan hätte, wenn ich dann nicht nach Zürich gekommen wäre; und als ich dann die Stelle aufgab, haben sie mir die 20 Gulden geschenkt, die ich wegen der Pfrund noch schuldig war, sie hatte mich nämlich viel über 100 Gulden gekostet. In Einsiedeln bin ich noch heute dem Herrn Verwalter und der Bevölkerung lieb und wert, und das alles beweist doch, dass ich nicht ein hässiger Mensch bin.»
Der Pfründenreiter aus Zürich machte dem jungen Toggenburger das Leben schwer, denn der liess sich von Zwingli die Stelle für viel Geld abkaufen. Er war zwar von Rom, aber weder von der Gemeinde und noch vom Bischof dafür bestellt. Zwingli zahlte die ganzen zehn Jahre an diesen Heinrich Göldli seinen Obolus. Auch das gehörte zum schmerzhaften Anschauungsunterricht über die Kirchenverhältnisse unseres jungen Geistlichen.
Das gab ihm aber auch Einsicht in die kommerzialisierten Strukturen der Organisation sämtlicher Kirchenämter. Der junge Zwingli hat am eigenen Leib erfahren, wie ein Günstling der Kurie die gesamte Kirchenorganisation ausser Kraft setzen konnte. Die Glarner wollten ihn, der zuständige Bischof hatte ihn geweiht, doch Rom und die Kurie kümmerten sich nicht einen Deut darum. Die Verkündigung von Gottes Wort war ein Geschäft.
Die Glarner erwiesen sich allerdings als grosszügig, nicht ganz so entgegenkommend waren sie mit dem Pfarrhaus, denn ihnen waren die Mängel des Hauses wohlbekannt. Doch als Zwingli 1516 seine Entlassung beantragte, boten sie ihm an, ein neues Pfarrhaus zu bauen, damit er bleibe. Der junge Seelsorger hatte zeitweise drei bis vier Kapläne, die ihn entlasteten. Die beiden Kirchen St. Fridolin und St. Hilarien wurden von ihm abwechslungsweise mit Predigten versorgt. Zwingli war darin begabt, eine Volksnähe zu praktizieren, obwohl er zeit seines Lebens ein Studiosus und ein intellektuell vielseitig interessierter Gelehrter war, dazu künstlerisch begabt in der Musikausübung auf verschiedenen Instrumenten.
Die Glarner Pfarrei umfasste mehrere Ortschaften, neben Glarus waren das Riedern, Netstal, Ennenda und Mitlödi. Der Hauptort Glarus umfasste rund 1300 Bewohner. Wir wissen sehr wenig über Zwinglis Tätigkeit. Es ist bei ihm kaum Kritik an der Kirche erkennbar. Noch immer las er die Messe und erteilte die Absolution. Von grösster Bedeutung ist aber die Tatsache, dass der junge Zwingli an den Italien-Feldzügen der Glarner für den Papst gegen die Franzosen in der Lombardei teilnahm.
Im Laufe der Zeit lernte er wohl seine Kirchenmitglieder kennen. Er übernahm geistliche Patenschaften für mehrere Kinder. In den zehn Jahren, die er in Glarus verbracht hat, diesem schmalen, voralpinen Tal, das durch die Produktion von Ziger von sich reden machte, bildete sich der junge Theologe intensiv weiter. Mit grossem Eifer studierte er die antiken Klassiker sowie die Kirchenväter. Da begegnete er zum Beispiel dem grossen Römer Seneca, dem Lehrer von Nero, einem reichen Mann und genialen Schreiber. Er las diese wunderlichen Sätze in der Schrift Die Kürze des Lebens von Seneca: «Jeder überstürzt sein Leben und leidet an der Sehnsucht nach dem Kommenden. Der hingegen, der jeden Augenblick zu seinem Nutzen verwendet, der jeden Tag so einteilt, als wäre er sein Leben, sehnt sich nicht nach dem folgenden Tag und fürchtet sich nicht davor. Alles ist bekannt, alles bis zur Sättigung genossen. Über das andere mag das Glück nach Belieben verfügen. Das Leben ist schon in Sicherheit. Diesem Menschen kann man noch etwas dazu geben, wegnehmen nichts.» Welch wunderbare stoische Haltung!
1513 begann Zwingli Griechisch zu lernen, konnte dann bald den Urtext des Neuen Testaments lesen, den Erasmus von Rotterdam im Jahre 1516 herausbrachte. Durch Erasmus lernte der Lernbegierige einen neuen Sinn in den biblischen Texten zu finden. Das eröffnete ihm einen neuen befreienden Zugang zur Bibel. Denn trotz der Stille des Glarner Bergtals korrespondierte Zwingli mit den gelehrten Häuptern seiner Zeit, er war bestens unterrichtet über das Erscheinen neuer Bücher. Am Ende seiner Glarner Jahre besass er als intellektueller Kopf die erstaunliche Zahl von weit über 100 Büchern. Und in seinem Nachlass umfasste seine Bibliothek 210 theologische und etwa 100 philosophische Werke.
Eines ist wohl sicher: Zwingli war stets bestrebt, sein Wissen weiterzugeben. Auf seine Initiative hin stimmte die Landsgemeinde im Jahr 1510 der Gründung einer Lateinschule zu. Man stelle sich das vor: im Jahre 1510 eine Lateinschule in Glarus! Zwingli wurde Lateinlehrer. So kam es, dass der spätere bedeutende Chronist der Eidgenossenschaft, Aegidius Tschudi, Zwinglis Schüler wurde. Wir wissen ungefähr, was Zwingli in seinen zehn Glarner Jahren gelesen und was er etwa mit seinen Schülern durchgenommen hat, es reicht von Titus Livius zu Plutarch, von Sueton zu Herodian, von Plinius zu Caesar. Und wir ahnen, dass Zwingli ein Prediger war, der aus den römischen Klassikern schöpfte für seine Predigten, obwohl wir sonst über diese Predigten herzlich wenig wissen.
Der Toggenburger war noch nicht 20-jährig, als er sich schon didaktisch und pädagogisch betätigt hatte. Später sind mehrere Briefe von Schülern an Zwingli oder über Zwingli an uns gekommen. Es sind samt und sonders bewundernde, begeisterte und dankbare Zeugnisse von späteren Studenten. Zwingli war zwischen 22 und 32 Jahre alt, da wird ihm «väterliches Wohlwollen» bescheinigt, «weise und gütig» sei er ihnen «mit Rat und Tat zur Seite gestanden», habe auch «bei ihren Eltern als verständnisvoller Mittelsmann ihre Anliegen vertreten». Aus dem Jahr 1515 finden wir am Rand eines Erasmus-Buches folgende schöne Handnotiz von Zwingli: «Lass die Bursten, das heftige Dreinfahren! Damit bringt man die Kinder bloss zum Heulen». Immer wieder kommt uns das Bild des gütigen Lehrmeisters entgegen in den ungezählten Briefen von späteren Studenten. Was für Liebesbezeugungen! «Nie habe ich etwas so hoch geschätzt, als die Freundschaft eines solch gelehrten und gütigen Mannes geniessen zu dürfen.» Oder: «Du bist der teuerste der Lehrer und der Liebenswerteste unter den Teuersten.» Oder: «Mein ganzes Glück und all mein Wissen verdanke ich dir, und mein Schicksal hängt völlig von dir ab.» Und im Kreise seiner humanistischen Freunde galt er als führende Gestalt unter den Schweizer Humanisten, seine Brieffreunde sprachen ihn an als Humanisten, als Philosophen oder aber als Philosophen und Theologen.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde in der eidgenössischen Politik darüber gestritten, ob die Zusammenarbeit des Papstes mit dem Kaiser oder mit den Franzosen gesucht werden sollte. In wessen Dienste sollen die Glarner Söldner sich stellen? Zwingli votierte für den Papst, worauf sich dieser mit einer stattlichen Pension von 50 Gulden bedankte.
Zwingli hatte sehr viel zu tun mit Witwen und Waisen und Eltern und Geschwistern. Da kam von 1600 Teilnehmern an italienischen Feldzügen ein Viertel gar nicht mehr nach Hause, und etliche kamen als Krüppel zurück, von seelischer Verwahrlosung gar nicht zu reden.
Doch im Oktober 1515, unmittelbar nach der Schlacht von Marignano, war es aus mit der schweizerischen Grossmachtpolitik, vor allem durch die vernichtende Niederlage gegen die Franzosen. Zwingli votierte gegen den französischen Friedensschluss und für den Papst in Rom. Die Stimmung in der Eidgenossenschaft und auch in Glarus schlug zugunsten der Franzosen um. Zwinglis politische Haltung wurde unhaltbar. Er hatte zwar grossen Rückhalt in der Bevölkerung, war jedoch politisch isoliert.
Er hatte in seiner Glarner Zeit die einheimischen Söldner zweimal als Feldprediger nach Oberitalien begleitet, wo der deutsche Kaiser, der französische König und der Papst mit militärischen Mitteln um Einfluss und Macht rangen. Mal standen Schweizer auf der einen, dann auf der anderen und manchmal gar auf beiden Seiten einander feindlich gegenüber.
Das wurde für Zwingli zu seiner paradigmatischen Erfahrung und führte zu seiner ersten grundsätzlichen Einmischung in die Politik. Gerade diese Erfahrung formte den jungen Priester, Prediger und Lehrer zum eidgenössischen Patrioten.
Ja, die kriegerischen Erfolge der Schweizer waren ihre sicht- und spürbare Stärke, aber gleichzeitig auch ihre Schwäche, da halb Europa ihre Söldner begehrte. Man gewann zwar das Tessin und das Veltlin. In den südlichen Gebieten des Heiligen Römischen Reichs wurden die Schweizer für ihre Freiheit beneidet. Dort hatten die «Freiheitskriege» enorme Wirkung. Andererseits hatte der Schweizer den Ruf des unbezähmbaren, anarchischen Kriegers. Die Wehrpflicht wurde zum Vorbild, doch die Reisläuferei war vornehmlich von Abenteuerlust und Habgier geprägt. Vor allem führten die zahlreichen Soldbündnisse und Soldverträge, die den Schweizer Räten fette Geldzuflüsse bescherten, schliesslich zur faktischen Abhängigkeit von ausländischen Mächten, vor allem vom französischen König und vom Papst. Die Eidgenossenschaft war weit offen für Korruption. Die Tagsatzung erliess 1503 ein Verbot für Einzelpersonen, fremdes Geld wie auch fremde Kriegsdienste anzunehmen. Sie versuchte so, das ausufernde Pensionen- und Solddienstwesen unter obrigkeitliche Kontrolle zu bringen. Durchgesetzt hat sich der Versuch nicht. Erst die Zwinglische Reformation hat für Zürich und die reformierten Stände die dringlichen Massnahmen durchgesetzt.
Für diese Entwicklung haben wir ein Zeugnis von ungeahnter Strahlkraft aus dem Jahr 1510, eine starke poetische Leistung: «Uolrich Zwingli, Priesters fabelisch Gedicht von eim Ochsen und etlichen Tieren, ietz louffender Dinge begrifflich» (was heissen soll, sich mit gegenwärtigen Vorkommnissen befassend). Also eine hochaktuelle Dichtung zu grundsätzlichen Fragen der Zeit und der Eidgenossenschaft. Natürlich praktizierte der junge Geistliche hier eine Fähigkeit, die er in der Ausbildung sowohl in Wien als auch in Bern bei Lupulus gelernt hatte.