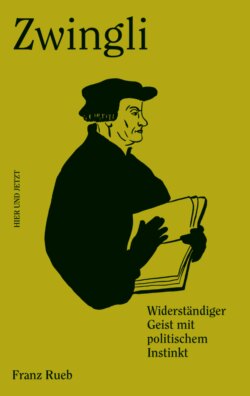Читать книгу Zwingli - Franz Rueb - Страница 19
MARIGNANO
ОглавлениеEigenartig ist, dass nach dieser Vorgeschichte von Zwinglis Beschäftigung mit der eidgenössischen Politik ein so gewaltiges Ereignis wie die Schlacht von Marignano in seinem Leben kaum Erwähnung fand. War er nun als Feldprediger in Marignano dabei? Hat er seine Glarner Kämpfer tatsächlich begleitet? Es gibt von ihm keine persönliche Erwähnung dieses so wichtigen, ja schwerwiegenden Falles, es gibt keine Briefzeile darüber, jedenfalls ist keine erhalten. Nie geht Zwingli auf diese gigantische, schmählich verlorene Schlacht ein. Man muss doch annehmen, dass sie einem Teilnehmer, und sei er nur Beobachter gewesen, als traumatisches Erlebnis stets in Erinnerung geblieben ist. Oder war er gar nicht Beobachter der Schlacht?
Der französische König wollte Mailand zurückerobern, mit Schweizer Söldnern, und der Papst wollte es wieder befreien, auch mit Schweizer Söldnern. Mailand war eine Stadt, die 100 000 Einwohner zählte. Die einwohnerstärkste Stadt auf Schweizer Boden war damals Basel mit 10 000 Bewohnern.
Am 6. September 1515 kamen die Schweizer Truppen in Lonza an. Zwei Tage später predigte Zwingli seinen Glarner Landsleuten auf dem Marktplatz in Lonza kurz vor der vernichtenden Niederlage, ermahnte sie zur Einigkeit und zur Treue zum päpstlichen Bündnis. Es gibt einige Zeugen für Zwinglis Anwesenheit in Marignano. Doch von ihm selbst ist kein Wort aufzufinden.
Da die Tagsatzung, die damalige Zusammenkunft der führenden Männer der eidgenössichen Orte, das Söldnerproblem nie in den Griff bekam, war es möglich, dass im französischen Heer eine stattliche Zahl Schweizer Söldner gegen die eigenen Landsleute kämpfte. Dem jungen König Frankreichs mit Namen Franz gelang es, das eidgenössische Heer zu spalten. Er bot den Schweizern 700 000 Kronen, wenn sie ihm das Herzogtum Mailand überliessen. Daraufhin zogen rund 10 000 Mann aus Bern, Solothurn, Freiburg und dem Wallis ab und kehrten nach Hause zurück, was durchaus ein Verrat an der Eidgenössischen Tagsatzung war. Doch diese reagierte nicht.
Nun waren die Franzosen zahlenmässig in noch weit stärkerer Übermacht. Die Gegner hatten viel mehr Artillerie, also Kanonen, und weit mehr Krieger. Die Eidgenossen verloren in der folgenden Schlacht mehrere Tausend Mann. Die eidgenössischen Krieger setzten auf die falschen Kriegsmittel, sie waren mit ihren Hellebarden waffentechnisch unterlegen und wurden zudem taktisch übertölpelt. Aber sie hatten auch keine Einigkeit, keine Moral, keine Disziplin, noch konnten sie sich auf ihre übliche Schlagkraft verlassen. Das föderalistische System der Eidgenossenschaft, das muss man so sagen, war Nährboden für Gespaltenheit. Die Gier nach Eroberungen und nach Beute der Krieger lockte sie zu militärischen Ausschweifungen nach Oberitalien. Sie wurden grossmachtsüchtig und sie rannten fast blind ins Verderben. Unter den Schweizer Söldnern drohte sogar ein Bruderkrieg.
Zwingli hatte wohl gegen die Spaltung des eidgenössischen Heeres gepredigt, wie der Zuger Ammann Werner Steiner als Chronist festhielt. Hätte man auf Zwingli gehört, wäre diese Katastrophe nicht über die Schweizer hereingebrochen, meinte der Chronist.
1516 unterzeichneten die Eidgenossenschaft und Frankreich in Freiburg einen Friedensschluss. Franz I. warb weiterhin Schweizer Söldner an. Nur der Stand Zürich machte bei dem Bündnis mit Frankreich nicht mit. Zwar war die Expansionspolitik der Tagsatzung mit der Niederlage in Marignano zu Ende. Aber die Soldbündnisse, die Söldnerei, die Reisläuferei nahmen ihren Fortgang vor allem für die französischen Könige. Einheitliche Positionen waren allein schon durch die Reformation in der Eidgenossenschaft nicht mehr möglich, denn es gab fortan eine katholische und eine reformierte Schweiz und weit und breit keine Einheit.
Die Erfahrungen in der furchtbaren Schlacht bei Marignano als den Beginn der Neutralitätspolitik der Eidgenossenschaft zu sehen, ist eine heuchlerische, unschöne Mär. Die Soldbündnisse mit dem französischen Staat hielten an, die Reisläuferei junger Schweizer Männer ging noch lange weiter, die Abhängigkeit von der Kurie in Rom wie von Frankreich reichte bis zu Napoleons Zeiten. Da ist nirgends ein Hauch von Neutralität. Eigentlich sind Zwingli und dann durch ihn der Stand Zürich die ersten und lange die Einzigen, die diesem Geschwür der fremden Dienste und der fremden Gelder konsequent den Kampf ansagten. Zwingli sah den Blutzoll, das Elend und die Verrohung seiner Landsleute. Es dauerte noch mindestens bis zum Jahr 1648, dem Westfälischen Frieden nach dem Dreissigjährigen Krieg im Heiligen Römischen Reich, bis die Vision einer Neutralität in der Schweiz Form anzunehmen begann. Und erst 1815 durch die Resultate des Wiener Kongresses wurde sie vollends konkret.
Vor der Schlacht in Marignano tauchte im Lager der Schweizer der Walliser Kardinal Schiner auf, der zur allgemeinen Verunsicherung unter seinen Landsleuten gehörig beitrug. Zwingli hatte ja bereits jahrelange Erfahrung mit dem fremden Solddienst, er beobachtete und kommentierte schon lange die Grossmachtpolitik der Schweizer und ihre Dienste bei fremden Mächten. Er wird auch hier in dieser Predigt, unmittelbar vor der Schlächterei, nicht mit klaren Worten gespart haben. Und hinterher, nach dem grossen Gemetzel, verabscheute er für immer den Solddienst, gegen den er jahrelang einen Kampf geführt hat. Er sprach von «Kriegsgurgeln, von Blutkrämern, von schandbarem Schacher […] die den Schweizer mit jungem Blut treiben liessen, für den schnöden Mammon». Für Ludwig XII. seien 5000 Schweizer in Neapel umgekommen. In Novara seien 1500 gefallen. In Marignano seien über 6000 liegen geblieben. Die Schweizer seien in ihren eigenen kriegerischen Auseinandersetzungen immer siegreich geblieben, in fremden Diensten aber oft sieglos. Die Vorfahren hätten sich für Freiheit geschlagen. Bei den fremden Herren gehe es nur um Geld. Unter dem Eindruck der Katastrophe von Marignano hat Zwingli 1516 begonnen, das Evangelium zu predigen. Schon Jahre vorher hat er eingesehen, dass «Kriegführen im Sold fremder Herren unmenschlich, schamlos und sündhaft sei».