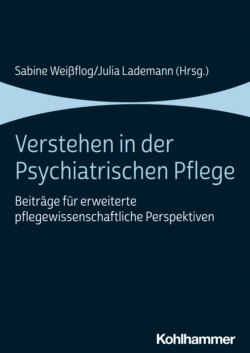Читать книгу Verstehen in der Psychiatrischen Pflege - Группа авторов - Страница 30
1.6 Bedeutung der Phänomenologie und des Konzepts Lebenswelt für die psychiatrische Pflege
ОглавлениеDie Phänomenologie nach Schütz erweist sich für die psychiatrische Pflege als nützlich für die Analyse der Lebenswelt, die das Verstehen sowie die Sinnkonstitutions- und Sinndeutungs-Prozesse im subjektiven Bewusstsein strukturiert. Das Wissen um die sinnhafte Vorstrukturiertheit der Sozialwelt hat Konsequenzen für die psychiatrische Pflegepraxis. Ihre Aufgaben und Tätigkeiten orientieren sich am Alltagshandeln und der individuellen Wirklichkeit des einzelnen Menschen. Vor dem Hintergrund ihrer Vorbehaltsaufgabe liegt die Konsequenz im individualisierten Arbeitshandeln, welches Manfred Hülsken-Giesler als ein nicht standardisierbares und situatives Handeln bezeichnet (Hülsken-Giesler 2008).
Sowohl inhaltlich wie auch methodisch hielt sich Schütz eng an Husserl. In der phänomenologischen Klärung lebensweltlichen Verstehens setzte er sich jedoch von Husserl ab. Die Analyse der Strukturen der Lebenswelt begründen auf den »Idealmenschen«, weil Schütz nicht die individuellen Wirklichkeiten der Menschen untersuchte. Auf diese Weise vernachlässigte er die Leiblichkeit und damit die leibliche Perspektive, die unsere Erkenntnis erst ermöglicht und gleichzeitig auch begrenzt. Um mit der Hinwendung zum Alltag der Menschen auch die Umweltbedingungen berücksichtigen zu können, fügt Björn Kraus (2006) dem Lebensweltansatz aus konstruktivistischer Sicht der Wirklichkeit die Realität hinzu und führt im Kontext der Lebenswelt den Lebenslagenbegriff ein, den er auf Marx, Neurath (1931) und Weisser (1956) rückbindet (Kraus 2006).
Psychisch erkrankten Menschen stehen objektive (ökonomische) Handlungsbedingungen nach festgelegten Regeln, aufgrund staatlicher Absicherung und des Teilhaberechts, zur Verfügung. Ihre subjektiv wahrgenommene Wirklichkeit ist deshalb auch das Ergebnis der subjektiv wahrgenommenen Lebenslage. Die subjektive Wirklichkeit kann die Realität Lebenslage nicht abbilden. Die Lebenslage stellt aber die Voraussetzung zum Konstruieren dar (Kraus 2006). Im Hinblick auf das Pflege-Klienten-Geschehen im Rahmen des Pflegeprozesses und handlungstheoretischer Problemkonstellationen sollte die objektive (Lebenslage) und subjektive Perspektive (Lebenswelt) verbunden werden.
Den Alltag erleben auch psychisch erkrankte Menschen als gegeben. Sie möchten durch ihr Wirken Veränderungen am Auferlegten herbeiführen. Sie erfahren und verstehen in einer gemeinsam geteilten räumlichen Lebenswelt, wie im Rahmen der Pflegebeziehung, über die Wir-Beziehung in der Unmittelbarkeit. Auch im Rahmen einer Beziehung vertrauen die Menschen bei jeglichem Handeln und Tun auf das eigene Bewältigungsvermögen. Die psychische Krise erschüttert die Sinnstruktur und das Vertrauen, weil sie mit einer erfahrbaren Diskrepanz zwischen dem Erfahrungsvorrat und der aktuellen Erfahrung einhergeht. Die Motivation für Veränderungen liegt im Auflösen der Diskrepanz, wonach das Handeln im Handlungsentwurf seinen Sinn findet. Dem Recovery-Ansatz folgend kann Gesundung/Genesung nur dann gelingen, wenn die Menschen, ihre Familien und Freunde und u. a. auch die Pflegefachpersonen an der Hoffnung festhalten. Ein hoffnungsvolles und erfülltes Leben trotz bestehender Einschränkungen aufgrund der Erkrankung führen zu können, bedeutet für psychisch erkrankte Menschen einen persönlichen und einzigartigen Veränderungsprozess der freien Persönlichkeitsentfaltung gehen zu können und gleichzeitig die Ermöglichung eines Weges zu Entidentifizierung bzw. Ent-Subjektivierung.
Unterdessen läuft der Recovery-Ansatz, der Elemente des singularistischen Lebensstils der Spätmoderne aufgreift – Authentizität, Selbstverwirklichung und Lebensqualität –, Gefahr, unter dem Begriff »Eigenverantwortung« institutionalisiert zu werden, wenn von Seiten der Behandlungsinstitutionen nicht die Perspektive der individuellen Fähigkeiten eingenommen wird (Rankin & Petty 2016). Um Gesundheitsleistungen messen, erklären und finanzieren zu können, ist die am Individuum orientierte Grundhaltung in verallgemeinerbaren und standardisierten Richtlinien operationalisiert, die ihrer eigenen dynamischen Logik folgt. In der Folge wurden aus den Individuen die Patienten.
Nach den ersten Versuchen, die psychiatrische Pflege mit naturwissenschaftlichen Methoden erklären zu wollen, ausgerichtet am Vorbild der Medizin, wird es zunehmend wichtiger, die Methode des Verstehens zu erschließen. Im Rahmen des Pflegeprozesses werden objektive Rahmenbedingungen, wie z. B. die materiellen Ressourcen und daraus ableitend die Handlungsmöglichkeiten der erkrankten Menschen, erhoben und objektivierbar sowie messbar aufbereitet. Dafür wird u. a. das Verhalten der »Patienten« beobachtet und anschließend interpretiert. Wie wir seit Schütz wissen, führt die Interpretation ohne die gemeinsame Reflexion nicht zum gemeinsamen Verstehen. Denn auch wenn die Pflegebeziehung eine räumliche und zeitliche Nähe zwischen den Pflegefachpersonen, den von Erkrankung betroffenen Menschen und den Angehörigen herstellt, können die jeweiligen subjektiven Bedeutungszuschreibungen divergieren. Haben die Pflegefachpersonen das gemeinsame Gespräch gesucht und mit ihren Gesprächspartnern die jeweiligen Wirklichkeiten erfahren, teilen sie sich in der Situation eine gemeinsame Wirklichkeit – wobei die gemeinsam geteilte Wirklichkeit noch nichts darüber aussagt, ob es auch zu einem gemeinsamen Verstehen kommt. Denn die »[…] Fraglosigkeit und Vertrautheit dieser Welt ist nämlich keineswegs homogen. Unser Wissen von ihr und unsere Vermöglichkeit, in ihr und auf sie zu wirken, zeigen mannigfache Aufschichtungen« (Schütz 1971, S. 154).