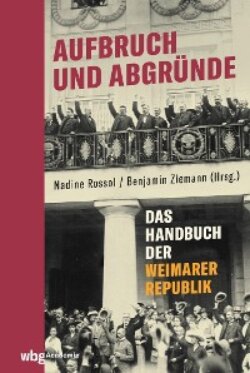Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 26
Koalitionsbildung und politische Fragmentierung 1924–1930
ОглавлениеMatthew Stibbe
Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre haben konservative Intellektuelle der Bundesrepublik das konstitutionelle Gefüge der Weimarer Republik heftig kritisiert. Vor allem bemängelten sie, die traditionelle, historisch gewachsene Idee des Staates sei nicht mit den besonderen Sicherheitsanforderungen einer modernen, permanent krisenanfälligen parlamentarischen Demokratie in Einklang gebracht worden. In ihren Augen hätte der Staat, insbesondere seine Regierbarkeit und Handlungsfähigkeit, prinzipiell Vorrang haben müssen vor dem Recht organisierter politischer Bewegungen auf Vertretung der materiellen Interessen oder ideologischen Glaubenssätze ihrer Massenmitgliedschaften.1 Dieses Prinzip sei, wie sich gezeigt habe, in der Weimarer Republik unmöglich aufrechtzuerhalten gewesen. Als Gründe hierfür nannten diese Kritiker einerseits die schiere Menge politischer Parteien im Reichstag, aber auch deren Unvermögen, zusammenzuarbeiten und stabile Mehrheiten zur Verteidigung der bestehenden verfassungsrechtlichen Ordnung zu bilden. Stattdessen habe es lediglich negative Mehrheiten gegen die rechtsstaatliche Grundlage der Republik oder deren Handhabbarkeit gegeben. Erschwerend hinzugekommen sei die vermeintliche Tendenz der Parteien, ihrer eigenen inneren Geschlossenheit Vorrang vor dem Schutz der legitimen Macht der Regierungen einzuräumen, insbesondere in Zeiten enormer Herausforderungen von innen und außen.2
Während einer der periodisch auftretenden Krisen seiner Minderheitsregierung rief Reichskanzler Hans Luther, ein parteiloser Technokrat, in einer Reichstagsplenarsitzung im Januar 1926 den sich befehdenden Parlamentariern in Erinnerung, dass Deutschland doch „irgendwie regiert werden“ müsse. Für diese Bemerkung erntete er öffentlich Hohn und Spott.3 Das beschämende Schauspiel drückt aus, wie tief das Ansehen der regierenden Klasse seit den Tagen Bismarcks gesunken war. Ein weiteres Beispiel für diesen Autoritätsverlust stellen die Annahmen der Amnestiegesetze von 1928 und 1930 für vor 1924 begangene politische Morde dar. Zwar wurde diese Amnestie de jure im Namen von Reichspräsident Paul von Hindenburg ausgesprochen, war aber de facto vom Reichstag (anstatt von den Gerichten) initiiert und von allen Parteien mit Ausnahme der SPD unterstützt worden. Viele Kritiker prangerten diese Maßnahme als eines konstitutionellen Rechtsstaates unwürdig an.4 Zur Vermeidung solch chaotischer Situationen und demokratischer Exzesse, die vermeintlich so typisch für die Weimarer Republik gewesen waren, schufen die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1948/49 die sogenannte „Kanzlerdemokratie“. Dieses liberale parlamentarische System sollte dem Amt des Kanzlers als föderaler Regierungschef sein Ansehen zurückgeben und die Bildung von „verantwortungsbewussten“ politischen Parteien befördern. Diese hatten nun den Auftrag, größtmögliche Unterstützung nicht nur für sich selbst und ihre Partikularinteressen, sondern auch für den verfassungsmäßigen Staat zu gewinnen.5
Im Folgenden sollen die Unzulänglichkeiten dieser konservativen Kritik an der Weimarer Demokratie aufgezeigt werden. Nicht nur leitet sie sich aus einem überholten, dem Staat verpflichteten Historismus ab, der an Fritz K. Ringers „deutsche Mandarine“ und ihre Tradition erinnert.6 Sie basiert außerdem auf einem einseitigen Verständnis der deutschen politischen Kultur während der 1920er Jahre. Gewiss kamen und gingen die Kabinette unter dem Weimarer System mit alarmierender Häufigkeit, vor allem im Vergleich mit der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Insgesamt gab es zwischen 1919 und 1933 21 verschiedene Reichsregierungen und 13 Reichskanzler. Außenstehende Beobachter konnten kaum Anzeichen einer „Neuorientierung“ im Verhalten von Koalitions- und Oppositionsparteien gegenüber den parlamentarischen Regierungen und deren Rolle beim Aufbau demokratischer staatlicher Strukturen entdecken, und dies nicht einmal in den politisch ruhigeren, „mittleren Jahren“ der Republik, so das kritische Urteil des Historikers Michael Stürmer und anderer.7 Es steht jedoch außer Zweifel, dass Regierungsbildungen auf Reichs- und Länderebene unmöglich gewesen wären, hätte es nicht zumindest eine rudimentäre Bereitschaft zum Kompromiss und zur Koalitionsbildung gegeben. Der Mordanschlag auf Reichsaußenminister Walther Rathenau 1922 durch ehemalige Freikorps-Mitglieder, die Hyperinflation und die Ruhrkrise von 1923, gefolgt von einem kommunistischen Aufstand in Hamburg, Reichsexekutionen gegen linke Koalitionsregierungen in den Ländern Sachsen und Thüringen sowie der gescheiterte Hitler-Putsch in München im Herbst desselben Jahres schufen den Wunsch nach einer stabilen, rationalen Politik als notwendige Entsprechung zur Währungsreform, und dies quer zu den „bisherigen Grenzen zwischen liberalen und konservativen Visionen von Macht“.8
Auch die Reichswehr, die zu diesem Zeitpunkt lieber hinter den Kulissen agierte, hatte ein Interesse an der Beendigung des reichsweiten militärischen Ausnahmezustands, den Reichspräsident Friedrich Ebert im September 1923 ausgerufen hatte, und an der Rücknahme der außerordentlichen Exekutivbefugnisse, die dem Chef der Heeresleitung Hans von Seeckt am 8./9. November 1923 verliehen worden waren. Die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustands am 28. Februar 1924 – und zwar nicht durch zivile Reichsministerien, sondern von Generalstabschef von Seeckt initiiert – war ein einschneidender Moment.9 Er ermöglichte die Abhaltung der Reichstagswahlen am 4. Mai (und danach am 7. Dezember) desselben Jahres in einer Atmosphäre relativer Ruhe. Er bewirkte weiterhin die Außerkraftsetzung von Schutzhaftbefehlen, die Aufhebung des Verbots der KPD und verschiedener rechtsextremer Gruppierungen sowie die Wiedergewinnung parlamentarischer Souveränität über die Gesetzgebung, die über die folgenden sechs Jahre bestehen blieb. Außerdem kehrten in Bayern, Sachsen und Thüringen verfassungsgemäße Regierungen zurück und die Gewaltenteilung wurde bis zu einem gewissen Grad wiederhergestellt, nachdem in den Jahren 1923 und 1924 von der bayerischen beziehungsweise Reichsregierung ernannte zivile Staats- oder Reichskommissare diese Länder regiert hatten.10
Der vorliegende Beitrag untersucht, auf welche Weise die politischen Parteien in den Jahren von 1924 bis 1930 Machtteilung verhandelten und kommunizierten. Einen Schwerpunkt bilden dabei die beachtenswerten Erfolge der Koalitionsregierungen, insbesondere die Verabschiedung eines neuen Reichsgesetzes zur Einführung einer staatlichen Arbeitslosenversicherung im Jahr 1927. Außerdem soll das Konzept der Koalitionsbildung ausgeweitet und auch auf den Bereich der Direktwahlen angewendet werden, bei denen die Parteien die deutschen Wähler als einen unteilbaren, das gesamte deutsche Volk umfassenden Wahlkörper betrachteten – oder vielmehr die Wähler dazu aufforderten, sich selbst als einen solchen zu sehen. Im Mittelpunkt stehen hier vor allem die 1925 in zwei Wahlgängen durchgeführte Wahl des Reichspräsidenten, welche der ehemalige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg knapp gewann, und die Wahlkampagnen für die Volksentscheide von 1926 und 1929. Beim ersten Plebiszit ging die Linke eine vorübergehende Allianz im Kampf um die Fürstenenteignung ein, beim zweiten taten sich nationalistische und rechtsradikale Gruppierungen kurzfristig gegen den Young-Plan zusammen.
Keine der hier untersuchten Regierungs- oder parteiübergreifenden Allianzen war jedoch stabil oder unumstritten, und so soll im dritten Teil des Beitrages die wachsende politische Fragmentierung während der ausgehenden 1920er Jahre in den Blick genommen werden. Die Forschungsliteratur hat bisher vor allem die zunehmende Zersplitterung der politischen Rechten betrachtet, besonders das schlechte Abschneiden der national-konservativen DNVP bei den Reichstagswahlen von 1928, die schwindende Zustimmung der Wähler für die liberalen Parteien DVP und DDP und den politischen Aufstieg von wirtschaftlichen Interessenparteien des Mittelstandes.11 Doch es gab auch Anzeichen für Brüche innerhalb der Linken. Nicht nur verschlechterten sich die Beziehungen zwischen SPD und KPD, auch spaltete sich die KPD-O (Kommunistische Partei-Opposition) von der Kommunistischen Partei ab. Der Beitrag schließt mit dem Versuch einer Erklärung und Bewertung dieser Fragmentierungen. Lag ihre Ursache vor allem in dem Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlichen Beschränkungen und utopischen Erwartungen, wie Detlev J. K. Peukert in seinem bahnbrechenden, 1987 erstmals erschienenen Buch über die Weimarer Republik argumentierte?12 Oder benötigen wir einen Ansatz, der stärker kommunikative, performative, symbolische und räumliche Dimensionen der politischen Erfahrung berücksichtigt? Thomas Mergel hat dies kenntnisreich in seiner Kulturgeschichte des Reichstages, der höchsten gesetzgebenden Körperschaft der Weimarer Republik, demonstriert.13 Dieser Ansatz ist ebenfalls nutzbringend für die Untersuchung der oben erwähnten Reichspräsidentenwahlen von 1925 und der Volksentscheide von 1926 und 1929, bei denen sich alternative, direktere Wege der „Repräsentation des Volkes in seiner Gesamtheit“ herauskristallisierten.14 Und schließlich ist zu fragen, wie die Periode der Koalitionsbildung und politischen Fragmentierung zu sehen ist in Bezug auf umfassendere Fragen nach Kontinuität und Wandel, Stabilität und Krise in der Weimarer Republik.