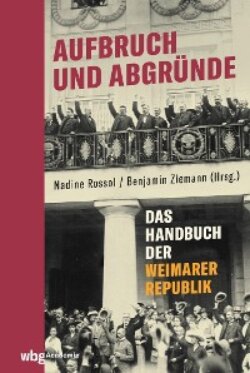Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 28
2. Koalitionsbildung und Direktwahlen
ОглавлениеDirektwahlen, also Volksentscheide und Präsidentschaftswahlen, fanden während der Weimarer Zeit zwar weniger häufig als Parlamentswahlen statt, doch waren sie gleichermaßen wichtig für den doppelgleisigen kulturellen Prozess von Koalitionsbildung und politischer Fragmentierung.53 Die bei Direktwahlen geschlossenen Allianzen hielten nur für einen sehr begrenzten Zeitraum und konnten daher die Tendenz einer Fragmentierung kaum aufhalten. Andererseits offenbarten sie einen eigentümlichen Konsens zwischen Parteien und Kommentatoren über die Bedeutung symbolischer Politik in den konkurrierenden Visionen der Nation. Direktwahlen gaben oft den Anlass für eine reale oder imaginäre Zunahme von Straßengewalt und emotionalen Kämpfen um öffentliche Räume.54 Und, wie Joseph Addison, Botschaftsrat an der Britischen Botschaft in Berlin, am 11. Juni 1926 an den konservativen Außenminister Sir Austen Chamberlain schrieb, vergifteten sie den öffentlichen Diskurs, indem sie „jedes erdenkliche legale und moralische Problem aufgriffen[,] […] politische Gedanken jeglicher Couleur wachriefen [und] die öffentliche Aufmerksamkeit unter Ausschluss aller anderen Themen monopolisierten“.55
Bei Direktwahlen musste eine breite Masse an Wählern mobilisiert werden, die entweder noch unentschieden oder weniger an tatsächlichen Inhalten als an einem symbolischen Sieg interessiert waren. Diese Tendenz vergrößerte das Störpotenzial von Direktwahlen. Im Wahlkampf kam es vor allem darauf an, dem eigenen Kandidaten räumliche und symbolische Dominanz zu verschaffen; dazu benutzte man Flaggen, politische Farben und anderweitig überpublizierte Themen, deren „Erfolg“ sich gewöhnlich an der Zahl der Wahlkampfveranstaltungen, -versammlungen und -plakate maß.56 So berichtete die KPD Anfang Juni 1926, dass sie für den Volksentscheid zur Fürstenenteignung Wahlkampfmaterialien in einer Auflage von 33 Millionen Exemplaren drucken lassen wolle, dass die SPD weitere 20 Millionen bereitstelle und die „Monarchisten“ bereits 22 Millionen Flugblätter in Berlin allein verteilt hätten.57 Schließlich tendierten Direktwahlen auch dazu, komplizierte politische Probleme auf die Wahl zwischen einem einfachen Ja oder Nein zu reduzieren. Neutralität war hier keine mögliche Option, womit Direktwahlen politische Gemeinschaften gleichzeitig totalisierten und zerteilten. Erschwerend kam hinzu, dass sich trotz eines möglicherweise demokratischen „Ergebnisses“ der jeweilige politische Konflikt nach einer Direktwahl nicht unmittelbar reduzieren ließ, da er nicht in das eher opake und weniger polarisierende Feld der parlamentarischen Verfahrensweisen und technischen Abläufe des Gesetzgebungsprozesses überführt werden konnte. In diesem Sinne war die „Gewalteskalation der letzten Weimarer Jahre“ schon „in den vermeintlich ruhigeren mittleren Jahren angelegt“, wie Dirk Schumann argumentiert.58
Die in zwei Runden ausgetragene Präsidentschaftswahl von 1925 gewann am 26. April der Kandidat des Reichsblocks, Paul von Hindenburg. Bei dieser ersten Weimarer Direktwahl wurden entscheidende politische Fragen vollständig umgangen, indem sich der Wahlkampf einzig auf die „heldenhafte“ und „opferbereite“ Kandidatur des 77-jährigen ehemaligen Generalstabschefs konzentrierte. Bei der ersten Abstimmung am 29. März, die unentschieden ausging, hatte der aus Mitte-rechts- und rechts-protestantischen Parteien bestehende Reichsblock zunächst den polarisierenden Duisburger DVP-Bürgermeister und ehemaligen Reichsminister des Innern Karl Jarres als Kandidaten aufgestellt. Aus taktischen Gründen verzichtete Jarres zugunsten Hindenburgs auf die Kandidatur, was im Gegenzug die Bedingung für den gleichzeitigen Rückzug Heinrich Helds von der BVP war. Dieser Schritt ermöglichte es dem Reichsblock, sein Wählerpotenzial über das protestantisch-nationalistische Bürgertum hinaus auf rechte katholische Wähler in Bayern und anderswo auszudehnen. Selbst einige national gesonnene Demokraten, die nicht bereit waren, den offiziellen Kandidaten des republikanischen Volksblocks Wilhelm Marx in der zweiten Runde zu unterstützen, schwenkten so über zu Hindenburg. Doch der Sieg des Generalfeldmaschalls hatte seinen Preis. Er verwässerte die rechtsgerichtete Botschaft und verwischte politische Unterschiede, sodass er schließlich nicht mehr als ein klarer Sieg des Monarchismus über den Republikanismus deklariert werden konnte. Franz Seldte, Bundesführer des monarchistischen Veteranenverbandes „Der Stahlhelm“, sah dies in einem vertraulichen Rundschreiben vom 10. April 1925 an die Leiter seiner örtlichen Vereine voraus:
Es gibt gar keinen Zweifel daran, dass Millionen von Wählern, die am 26. April für Hindenburg stimmen, nach der Wahl umgehend zu ihren traditionellen Parteien und Interessenbindungen zurückkehren werden. Das Wahlergebnis wird daher nicht die Stärke der nationalen Bewegung widerspiegeln, es wird lediglich ein Zeichen für die Breite und Größe der Bewunderung sein, die große Teile der Bevölkerung für Hindenburg hegen.59
Der Wahlkampfstil Hindenburgs verstärkte diese Besorgnis. Er verweigerte Interviews mit sympathisierenden rechtsgerichteten Journalisten und lehnte es ab, durch das Land zu reisen und vor seinen Kernwählern zu sprechen. Während er zu Hause in Hannover blieb, setzte sein Wahlkampfteam alles daran, seine Gegner zu unterminieren, anstatt den eigenen Kandidaten anzupreisen. Insbesondere benutzte es die Angriffe des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, der Hindenburg als „Massenschlächter“ und „Niederlagengeneral“ brandmarkte, um das gesamte „anti-Hindenburg“ Lager einschließlich des moderaten katholischen Republikaners Marx als „unpatriotisch“ und respektlos gegenüber dem Andenken an die Kriegstoten zu brandmarken.60 Wenn Hindenburg öffentliche Erklärungen abgab, beispielsweise am 24. April in einer Radiosondersendung, vermied er jeglichen politischen Inhalt und versuchte vielmehr, eine direkte Beziehung mit dem deutschen Volk als dessen nationaler Erlöser aufzubauen.61 Diese Taktik war erfolgreich; immerhin gewann Hindenburg die Wahl mit über vier Millionen mehr Stimmen als Jarres in der ersten Runde und 14,66 Millionen gegenüber 13,75 Millionen Stimmabgaben für Marx in der zweiten. Doch war es kein überwältigender Sieg und keineswegs ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das nationalistische Lager nun ohne Einschränkungen Oberwasser hatte. Tatsächlich stimmten fast ebenso viele Menschen – 14,46 verglichen mit 14,66 Millionen – am 20. Juni 1926 in dem von den linken Parteien initiierten Volksentscheid zur Fürstenenteignung.62
Dieses Plebiszit fand während einer Periode starker politischer Spannungen auf Reichsebene statt, die vom Zusammenbruch der ersten Luther-Regierung im Dezember 1925 über den Abschluss der Verträge von Locarno bis hin zur Bildung der neuen Bürgerblock-Regierung im Januar 1927 andauerte. Während dieses Zeitraums mussten die Minderheitenkabinette unter Luther und Marx ad hoc Vereinbarungen mit den Oppositionsparteien eingehen, um ihre Gesetzesvorlagen durchs Parlament zu bringen. Einer dieser Legislativvorschläge war das von der DDP eingebrachte und vom Kabinett Luther bewilligte Reichsgesetz zur Regelung der Entschädigung der ehemaligen Fürstenfamilien für die nach ihrer Abdankung 1918 zurückgelassenen Besitztümer unter Abwägung der Interessen des Volkes und des Staates gegenüber dem Prinzip der Wahrung der Eigentumsrechte. Die DNVP mit ihrer Wählerklientel von Landbesitzern widersetzte sich jeglicher Gesetzgebung, die eine Konfiszierung oder Enteignung von Land vorsah. Am anderen Ende des Spektrums forderte die KPD die komplette Konfiszierung ohne Entschädigungs- oder Berufungsanspruch, sekundiert vom linken Flügel der SPD und der Deutschen Liga für Menschenrechte. Weil die SPD-Führung die einzig andere zur Wahl stehende Option in dieser Frage – nämlich die Gesetzesvorlage der DDP im Reichstag – nicht unterstützen wollte, entschied sie sich, wenn auch widerstrebend, für einen Volksentscheid. Sie glaubte, dass dies selbst bei einer Niederlage ihre Glaubwürdigkeit als linke Partei symbolisch stärken würde.63
Die Organisation eines Volksentscheids, noch dazu über ein so umstrittenes Thema, war kein einfaches Unterfangen – und bis dahin gänzlich unerprobt. Ein solches unter den geltenden Regularien zu gewinnen, war geradezu unmöglich. In einem ersten Schritt musste dazu eine Koalition zwischen Parteien und Interessenverbänden einen Gesetzesvorschlag im Namen des Volkes initiieren, in diesem Fall die entschädigungslose Enteignung der Fürsten. Zwar konnten sich SPD und KPD auf die Formulierung eines Gesetzesentwurfs einigen. Doch gelang es ihnen in der Folge nicht, die bürgerlichen Parteien der Mitte, wie zum Beispiel die DDP oder das Zentrum, für das Projekt zu gewinnen, was dem Wahlkampf von Anfang an einen ausgesprochen sektiererischen Charakter verlieh. Die nächste Phase sah ein Volksbegehren, also eine Unterschriftensammlung von mindestens 10 Prozent der Stimmberechtigten vor. Dies gelang mit überraschender Leichtigkeit: Mehr als 12,52 Millionen Menschen, über dreimal mehr als erforderlich, unterschrieben zwischen dem 4. und dem 17. März die Petition.64 Zuletzt jedoch reichte bei der eigentlichen Abstimmung nicht nur die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sondern 50 Prozent aller Stimmberechtigten mussten sich für den Volksentscheid aussprechen – eine deutlich höhere Hürde. Die gegnerische Seite hatte nichts weiter zu tun, als so viele Menschen wie möglich zu überreden, erst gar nicht zur Wahl zu gehen, denn eine Enthaltung kam de facto einem Nein gleich.65 Die „Ja-Seite“ war demgegenüber gezwungen, sowohl für das Volksbegehren als auch für den Volksentscheid selbst aktiv Wähler für sich zu gewinnen, dabei auch solche, die politisch eher indifferent waren oder keine festen Parteibindungen besaßen. Hierzu mussten politische Emotionen mobilisiert werden, was auf lokaler Ebene oft den Rückgriff auf symbolische Ressentiments gegen das „System“ erforderte, die zu diesem Zweck zu nationalen oder gar „welthistorischen“ Angelegenheiten aufgewertet wurden. Die KPD im Berliner Arbeiterbezirk Neukölln und seine paramilitärische Organisation, der Rotfrontkämpferbund (RFB), äußerten sich dazu in einem im Januar 1926 im Parteiblatt „Die Rote Fahne“ veröffentlichten Artikel:
Abb. 3.1: Agitprop, der Einsatz von Kunst und Theater für politische Zwecke, war eine wichtige politische Strategie der KPD. Im Bild sind Mitglieder der „Roten Truppe“ auf der Bühne, der Agitpropgruppe der KPD in Dresden. Mit ihrer Groteske „Die Fürstenparade“ parodieren sie die bis zur Revolution 1918 regierenden Fürstenhäuser und deren Lakaien. Die Groteske unterstützt damit die Kampagne der KPD im Volksentscheid zur Fürstenenteignung 1926.
Niemals zuvor sind die Rotfrontkämpfer von der Neuköllner Bevölkerung empfangen worden wie am letzten Sonntag. Sie wurden in deren Häuser eingeladen, es wurde ihnen Schokolade, Bier, Cognac, Wein, Zigarren und Zigaretten angeboten, aus schierer Freude, dass die unersättlichen Mäuler der Hohenzollern und ihresgleichen nun endlich gestoppt werden. Wieder und wieder haben die Leute betont: ‚Wir sind bestimmt keine Anhänger der Kommunisten, aber in dieser Frage sind wir vollständig mit ihnen einig.‘66
Dabei sollte allerdings nicht übersehen werden, dass Neukölln zu diesem Zeitpunkt schon zu den wichtigsten Hochburgen der KPD gehörte. Seit Kriegsende war es hier zu zahlreichen gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der preußischen Polizei und der revolutionären Linken gekommen, die um die symbolische Eroberung des öffentlichen Raums kämpfte.67 Außerdem war der Artikel in der „Roten Fahne“ schon verfasst worden, bevor die SPD-Basis ihre Führung zur Unterstützung des Volksbegehrens gezwungen hatte – also noch bevor die KPD überhaupt wissen konnte, dass ein Referendum ernsthaft in Betracht käme. Die Mobilisierung von 12,52 Millionen Unterschriften für das Volksbegehren im März, davon 1,6 Millionen allein in Berlin, zusammen mit den 14,46 Millionen Ja-Stimmen am Wahltag, dem 20. Juni 1926, war daher sehr viel beeindruckender als die „Eroberung“ Neuköllns, da dazu eine wesentlich breitere politische Basis erforderlich war. Hier sei kurz darauf hingewiesen, dass die Nationalsozialisten demgegenüber auch auf der Höhe ihres Erfolges im Juli 1932 nur 13,75 Millionen Stimmen gewannen.68 Doch im Juni 1926 machten 14,46 Millionen Stimmen nur 36,38 Prozent der Wahlberechtigten aus und blieben damit deutlich unter der 50-Prozent-Hürde. Der Volksentscheid zur Fürstenenteignung erreichte also kein konkretes Ergebnis, was wahrscheinlich ein schwererer Schlag für die Sozialdemokraten als für die Kommunisten war. Die KPD hatte sich mit großer Geste für das „Volk“ und gegen die ehemaligen Fürsten eingesetzt. Die SPD konnte demgegenüber nun kaum zum politischen Alltag zurückkehren und im Reichstag die Gesetzesvorlage der DDP, das „kleinere Übel“, unterstützen. Die neue Regierung Marx ließ diese ohnehin im Juli 1926 offiziell fallen.
Das Ausbleiben einer Lösung auf Reichsebene überließ die Angelegenheit den Ländern. Doch die Verwirrung der Öffentlichkeit hätte nicht größer sein können, als die preußische Landesregierung unter dem Sozialdemokraten Otto Braun tatsächlich zu einer Vereinbarung mit den Anwälten des Hauses Hohenzollern kam, die der preußische Landtag im Oktober 1926, allerdings bei Enthaltung der SPD-Abgeordneten, billigte.69 Währenddessen blieben politische Zusammenschlüsse im Reichstag unsicher und instabil. Die SPD unterstützte weiterhin Stresemanns prowestliche Außenpolitik, konnte aber nicht verhindern, dass eine Mehrheit aus bürgerlichen Parteien im Dezember 1926 mit 248 zu 158 das sogenannte Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schmutz und Schundschriften annahm. Liberale und linksgerichtete Stimmen kritisierten diese Gesetzesvorlage als Wiedereinführung der Zensur und Unterminierung der künstlerischen Freiheit. Doch auch die spätere von der SPD geführte Große Koalition machte nach 1928 keinen Versuch, dieses Gesetz wieder zurückzunehmen, was einen „überparteilichen Konsens im Reichstag über die Notwendigkeit des moralischen Schutzes der Jugend“ widerspiegelt.70
Abb. 3.2: „Straße Frei am 1. Mai der KPD“. Der genaue Standort dieses Schornsteins mit der KPD-Parole lässt sich nicht feststellen. Er stand aber aller Wahrscheinlichkeit nach in Stuttgart.
Für linksgerichtete Wähler waren die Ereignisse des Jahres 1926 dem Ansehen des Reichstags und der Länderparlamente als Bastionen republikanischer Werte gegen einen (vermeintlich) reaktionären, monarchistischen Reichspräsidenten sicher nicht förderlich. Demgegenüber sahen manche nichtsozialistische Politiker die Wahl Hindenburgs als Chance für einen gemäßigt konservativen Konsens, der Monarchismus und Republikanismus, Autoritarismus und Parlamentarismus zu verbinden vermochte, um eine, wie Luther es im Januar 1926 nannte, „Regierung der Mitte“ zu bilden.71 Dieser „gemäßigte“ Konservatismus war ein hochkomplexes und sich stetig veränderndes Konstrukt, das bisweilen größere Offenheit versprach (nach links gegenüber der SPD und nach rechts gegenüber der DNVP), bisweilen eine Verengung der Optionen und eine Präferenz für autoritäre Regierungsformen bedeutete oder gar eine „Diktatur innerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens“.72 Ein weiteres Zeichen für das Störpotenzial und den destabilisierenden Impetus von Direktwahlen waren die quer durch die Parteien verlaufenden Risse, die der Volksentscheid zur Fürstenenteignung hinterließ. Betroffen waren hier vor allem die Parteien der „Regierung der Mitte“, in erster Linie das Zentrum und die DDP.73 Die Deutschen Demokraten waren gezwungen, ihre Gesetzesvorlage im Reichstag zu verteidigen, während sich ihre Jugendorganisation, die Reichsorganisation der Demokratischen Jugend, offen auf die Seite der Referendumsbefürworter stellte, ebenso wie ein kleiner Teil der Reichstagsfraktion unter Ludwig Bergsträsser und Ernst Lemmer.74
Die SPD-nahe republikanische Veteranenorganisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die auch Mitglieder aus dem „gemäßigten“ Teil der DDP und dem Zentrum in ihren Reihen hatte, war in der Frage der Fürstenenteignung offiziell zur Unparteilichkeit verpflichtet. Der Reichsbannervorstand geriet 1926 in eine recht unbequeme Lage, als sich einige linksgerichtete, aber auch gemäßigte Lokalverbände unter Missachtung dieser Vorgabe für ein zustimmendes Votum aussprachen.75 Im sächsischen Leipzig forderten KPD und Rotfrontkämpferbund die lokale Reichsbannerorganisation auf einem Banner dazu auf, ihre Neutralität aufzugeben und mit ihnen zusammen eine „Einheitsfront“ im Wahlkampf zu bilden unter der – wenig neutralen – Parole: „Weg mit dem Reichstag der Fürstenknechte! Weg mit Hindenburg und Marx!“76 In Berlin versuchte die KPD Reichsbannermitglieder zur Unterstützung des Volksentscheids zu überreden, indem sie behauptete, dass die gemeinsame Agitation von KPD und SPD für das Volksbegehren es bereits geschafft habe, „einen großen Teil früherer Hindenburg-Wähler […] vom Hindenburg-Block“ loszulösen.77
Unter diesen Umständen war eine Fragmentierung der „Mitte“ unvermeidlich, sehr zum Nachteil der neuen Minderheitsregierung unter Wilhelm Marx, welche sich mit offengebliebenen Fragen auseinandersetzen musste, die der Volksentscheid aufgeworfen hatte. Als Erstes legte die Regierung dem Reichstag den Entwurf eines Gesetzes vor, das weitere Volksentscheide auf der Basis einer Initiative von nur 10 Prozent der Wahlberechtigten verhindern sollte. Da es sich hier jedoch um eine Verfassungsänderung handelte, war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, welche die extremistischen Parteien mit Leichtigkeit verhindern konnten. Auch die preußische Regierung fühlte sich bloßgestellt, nicht zuletzt weil das Haus Hohenzollern die Hauptzielscheibe antimonarchistischer Gefühle in Deutschland vor und nach dem Volksentscheid gewesen war. Die SPD lernte ihre Lektion und unterstützte keine weiteren plebiszitären Initiativen während der verbleibenden Weimarer Jahre (und darüber hinaus). Die Anti-Weimar-Parteien fühlten sich demgegenüber umso mehr ermutigt, Volksentscheide zur Aufhetzung der öffentlichen Meinung gegen den Reichstag und die das System tragenden Parteien zu instrumentalisieren. So leitete die KPD im Oktober 1928 ein Volksbegehren gegen den Bau des Panzerkreuzers A ein, wobei sie erneut auf ihre Strategie der „Einheitsfront“ setzte und die Unstimmigkeiten zwischen den vier sozialdemokratischen Reichsministern auf der einen Seite und SPD-Reichstagsfraktion und Mitgliederbasis auf der anderen auszunutzen versuchte. Es gelang den Kommunisten jedoch nicht, die für einen Volksentscheid erforderlichen Unterschriften einzuholen; statt der benötigten 10 Prozent unterstützten nur 2,94 Prozent der Wahlberechtigten ihre Petition, vor allem weil die SPD das Projekt nicht befürwortete – auch wenn die sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag weiterhin gegen den Bau des Panzerkreuzers A opponierten.78
Zwölf Monate später lancierte eine neue außerparlamentarische Allianz zwischen DNVP, NSDAP, Stahlhelm, Reichslandbund und Alldeutschem Verband ein Volksbegehren gegen den Young-Plan. Diese provisorische „Nationale Opposition“ erreichte mit 4,14 Millionen oder 10,02 Prozent der Wahlberechtigten knapp das erforderliche Quorum. Doch der Volksentscheid vom 22. Dezember 1929 entpuppte sich im Vergleich mit dem von 1926 als deutliche Niederlage: Nur 5,84 Millionen Deutsche oder 13,81 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für den von der Nationalen Opposition vorgeschlagenen Gesetzesentwurf, der es Reichsministern und Reichstagsabgeordneten unter Androhung einer Gefängnisstrafe wegen Landesverrat verbot, die Übernahme neuer Reparationszahlungen zu ratifizieren.79 Es gelang den Konservativen und der radikalen Rechten also offenbar nicht, den Young-Plan zu einer Streitfrage zu stilisieren, die nationale, mit der Republik unzufriedene bürgerliche Wähler mobilisieren konnte. Ähnliches gilt auch für die wirtschaftspolitischen Splitter- und Antisteuerparteien, die bei den Reichstagswahlen von 1928 nur 14 Prozent der Wahlberechtigten aus Protest gegen die großen Weimarer Parteien und die DNVP gewannen.80
Nach dem gescheiterten Volksentscheid beriet der Reichstag im März 1930 über den Young-Plan und ratifizierte ihn mit einer deutlichen Mehrheit von 265 gegen 192 Stimmen, Reichspräsident Hindenburg unterschrieb ihn gemäß seiner verfassungsmäßigen Pflichten, und er trat als Gesetz in Kraft.81 Trotz ihres Scheiterns an den Urnen hatte die Kampagne gegen den Young-Plan das Renommee der Nationalsozialisten bis zu einem gewissen Grad aufbessern und sie als die authentische nationale Stimme des Volkes gegen das republikanische System etablieren können. Dabei half auch, dass ihre Haltung konsequenter war als die der „gemäßigten“ DNVP und des Stahlhelms, die sich im Wahlkampf vor Generalangriffen auf Hindenburg gescheut hatten.82 Dies war keineswegs allein Hitler zu verdanken, sondern die „kollektive Leistung“ der Partei, die bewusst die „Massen“ angesprochen hatte, vor allem dort, wo die DNVP die wichtigste Konkurrentin der NSDAP darstellte.83 Der echte Durchbruch der Nationalsozialisten gelang allerdings erst bei den Reichstagswahlen im September 1930 und hatte weniger mit einer emotionalen Ablehnung des Young-Plans zu tun. Vielmehr war er die Folge der ungeliebten Deflationspolitik Brünings und seiner Entscheidung, eine vorzeitige Auflösung des Reichstags anzustreben, nachdem keine Mehrheit für seine Budgetkürzungen zustande gekommen war.