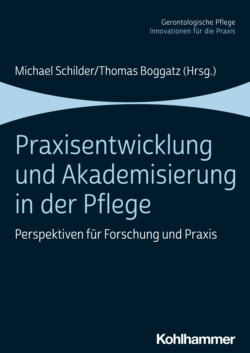Читать книгу Praxisentwicklung und Akademisierung in der Pflege - Группа авторов - Страница 29
2.9 Innovation – ein erweiterter Begriff
ОглавлениеGesundheit und langes Leben sind damit kein absolutes Ziel. Gerade im Kontext der gerontologischen Pflege wird dies deutlich. Hier geht es nicht nur um die Frage nach dem Erhalt des Lebens, sondern auch um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Ende. Die Pflege alter Menschen ist mit den Grenzen der Medizin und der Machbarkeit konfrontiert und muss lernen, diese anzuerkennen. Das heißt natürlich nicht, dass Innovationen in der Gerontologie keine Rolle spielen. Auch Hospize und Palliativstationen sind eine Innovation. Allerdings sind sie nicht unbedingt Orte der Optimierung im Sinne einer effektiven und effizienten Erreichung von Outcomes. Es ist nicht ihr Anliegen, die Patienten möglichst kostengünstig und schnell aus dem Leben zu entfernen. Vielmehr geht es ihnen darum, den Sterbenden Zeit und Raum zu geben, um sich vom Leben zu verabschieden und auf ihren Tod vorzubereiten. Dabei spielt zwar eine Linderung von körperlichen Beschwerden eine Rolle, die es auch wünschenswert macht, nach verbesserten Methoden der Symptomlinderung zu suchen, allerdings kommt der entsprechenden Behandlung nur eine unterstützende Funktion zu. Der eigentliche Sterbeprozess kann und soll dem Sterbenden nicht abgenommen werden.
Da Hospize eine Innovation darstellen, die aus einer Kritik an der einseitigen Orientierung der Kliniken an einer gesundheitsbezogenen Ergebnisverbesserung entstanden sind, scheint es ratsam den Innovationsbegriff und die daraus sich ableitende Vorstellung ihrer Implementierung zu erweitern. Implementierung kann hier nicht einseitig auf evidenzbasierte Prozessoptimierung hinauslaufen. Dies bedeutet nicht, dass eine Evidenzbasierung von Pflegemaßnahmen überflüssig oder gar abzulehnen wäre. Es kommt jedoch auf einen angemessenen Umgang mit Forschungsergebnissen an. Diese können nur sagen, was machbar und effektiv ist. Die Frage, ob die von ihnen getesteten Maßnahmen den Bedürfnissen der Kranken und Pflegebedürftigen entsprechen oder nicht, wird von ihnen nicht beantwortet. Dies kann nur im Rahmen eines Dialogs mit den Pflegebedürftigen geschehen, der den Aufbau einer Vertrauensbeziehung erforderlich macht.
In diesem Kontext verdient das Konzept der person-zentrierten Pflege nach Kitwood (2000) Beachtung, welches auch in den kürzlich erschienenen Expertenstandard zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz (DNQP 2019) Eingang gefunden hat. Auch dieses fordert eine Verabschiedung einer auf Funktionalität und Effizienz ausgerichteten Pflege und die Entstehung einer neuen Pflegekultur, in der durch Pflegeangebote offene Situationen entstehen, in denen sich die Pflegenden auf die Bedürfnisse der Pflegeempfänger einlassen und ihnen so Sinnfindung und Selbstbestimmung ermöglichen. Der Unterschied zwischen der alten und der anvisierten neuen Pflegekultur lässt sich anhand der von Heidegger (1979) geprägten Begriffe einer einspringenden und einer vorausspringenden Fürsorge verdeutlichen. Unter einer einspringenden Fürsorge versteht Heidegger eine Fürsorge, die für die Pflegebedürftigen und an ihrer Stelle Entscheidungen trifft und sie durch das Abnehmen ihrer Sorge um sich selbst zu Abhängigen und Beherrschten macht (ebd. S. 122). Sie führt im Extremfall zu einem Überprotektionismus und versteht dabei Pflege in einem rein technologischen Sinn, weil sich Pflegebedürftigen ihre Sorge um sich selbst nur dann abnehmen lässt, wenn man davon ausgeht, dass man sie einer Behandlung unterziehen kann, die dann mehr oder minder zuverlässig zu gewünschten, messbaren Outcomes führt. Wird diese Haltung verabsolutiert, werden Pflegebedürftiger zu behandelbaren Objekten degradiert, die lediglich dazu dienen, anhand von statistischen Kennwerten die Behandlungserfolge der Einrichtung zu demonstrieren.
Dieser Haltung wird von Heidegger die vorausspringende Fürsorge gegenübergestellt, die dem Anderen »in seinem existentiellen Seinkönnen vorausspringt, nicht um ihm die Sorge abzunehmen, sondern erst eigentlich als solche zurückzugeben.« (ebd.). Eine solche Fürsorge »verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu werden.« Einfach gesagt: sie gewährt ihm einen Freiraum, der ihn dazu befähigt, seine eigentlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und dadurch sein Dasein selbst zu bestimmen. Diese Art der Fürsorge ist das Grundprinzip der humanistischen Psychologie nach Carl Rogers (2016), bei der es nicht darauf ankommt, für die Klientinnen und Klienten eine Lösung ihrer Probleme zu finden, sondern ihnen eine Auseinandersetzung mit sich selbst zu ermöglichen, die dann zu Sinnfindung, Selbstbestimmung und Persönlichkeitsentwicklung führt. In gleicher Weise sollte in einer Pflegebeziehung den Pflegebedürftigen diese Möglichkeit zugestanden werden. Dies ist das Grundprinzip der person-zentrierten Pflege, die sich in ihrem Selbstverständnis aus der humanistischen Psychologie herleitet. Selbstbestimmung kann dabei bei Menschen mit Demenz durch wertschätzenden Umgang, aktives Zuhören, Eingehen auf non-verbale Signale und deren Beteiligung an Entscheidungsfindungen gefördert werden (DNQP 2019, S. 40). Person-zentrierte Pflege ist damit eine Innovation, die den Innovationsbegriff erweitert. Es ist keine Technologie zur Reduktion der Unsicherheit beim Erreichen eines gewünschten Outcomes, vielmehr basiert sie auf einer Haltung, die auf Kontrolle verzichtet und das Risiko auf sich nimmt, eine Beziehung zu einer pflegebedürftigen Person einzugehen, in der dieser die Pflege mitbestimmt, was immer zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen kann.
Eine derartige Fürsorge schließt ein technologisches Machbarkeitsdenken nicht aus, sie lässt sich nur nicht von ihm bestimmen. Einspringende Fürsorge ist bedingt sinnvoll, nämlich da, wo sich Pflegebedürftige nicht selbst versorgen können, weil ihnen die Fähigkeit oder das Wissen hierzu fehlen. Einspringende Fürsorge sollte dabei auch effektive Technologien verwenden und auf externer Evidenz basieren. Sie muss jedoch in eine person-zentrierte Pflege eingebettet sein und durch diese begrenzt werden. Primär geht es darum, interne Evidenz zu gewinnen und das Anliegen der Pflegebedürftigen zu verstehen, erst dann lässt sich externe Evidenz zu Rate ziehen, um die Pflege mit ihnen abzustimmen. Eine derartige Person-Zentrierung ist auch das Anliegen des von McCormack et al. (2013) vorgeschlagenen Konzepts Praxisentwicklung. Folgt man diesem Ansatz, so kann eine Weiterentwicklung der Pflege nicht nur aus einer kritischen Bewertung von Studien zu innovativen Maßnahmen bestehen, die dann im Falle nachweislicher, positiver Effekte in der Praxis implementiert werden sollen. Sie erfordert vor allem eine hermeneutisch-dialogische Kompetenz, um zu verstehen, worum es den Pflegebedürftigen in ihrem Leben und ihrer Behandlung bzw. Betreuung geht. Auf dieser Grundlage kann dann entschieden werden, ob eine Maßnahme für sie sinnvoll ist oder nicht. Nur eine Weiterentwicklung der Pflege, die sich dieser zweifachen Aufgabe stellt, kann dem Anspruch gerecht werden, welcher der Pflege innewohnt.