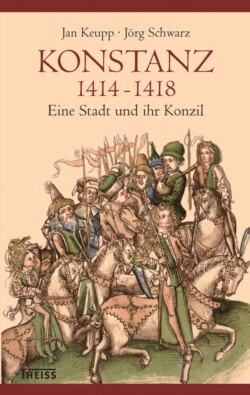Читать книгу Konstanz 1414-1418 - Jörg Schwarz - Страница 11
Vom Avignonesischen Exil zum Großen Abendländischen Schisma
ОглавлениеVon Katharina von Siena († 1380) und Birgitta von Schweden († 1373) gedrängt und durch zwei umfassende Legationen des kastilischen Kardinals Aegidius Albornoz († 1367) vorbereitet, kehrte Gregor XI. (Papst seit 1370) 1377 nach Rom zurück. Keine Rückkehr im Triumph – im Gegenteil, Probleme häuften sich über Probleme. Als er bereits ein Jahr darauf in Rom verstarb, wählten die Kardinäle am 8. April 1378 Bartolomeo Prignano, den Erzbischof von Bari, als Urban VI. († 1389) zum Papst. Die Wahl verlief chaotisch. Römer, in das Konklave eingedrungen, forderten einen italienischen Papst, den ihnen das französisch majorisierte Kolleg in der Gestalt Prignanos schließlich zu gewähren schien. Unerbittlich allerdings ging Urban noch in den ersten Wochen seines Pontifikats gegen die Franzosen vor. Er verdammte ihren Lebensstil, hielt ihnen − scharf und schneidend − ihre Verfehlungen vor, erweiterte das Kardinalskolleg primär um Italiener. Alte, nie verheilte Gegensätze brachen wieder auf, Italiener gegen Franzosen, Franzosen gegen Italiener, die Romanen untereinander mochten sich nicht. Einige französische Kardinäle flohen aus Rom. Urban, eben noch von ihnen ins Amt gebracht, wurde für amtsunfähig erklärt; in Fondi wählte man noch im September desselben Jahres den französischen Kardinal Robert von Genf als Clemens VII. († 1394) zum neuen Papst. Natürlich kehrte Clemens nach Avignon zurück.
Nach dem Avignonesischen Exil nun also das Große Abendländische Schisma; nachdem 1054 eine Spaltung die Christenheit endgültig in eine West- und eine Ostkirche zerteilt hatte, zerspaltete sich die westliche Christenheit nun selbst. Jeder der beiden Päpste – der römische und der avignonesische – verfügte über bestimmte Stützpunkte, über Obödienzen, auf die er sich zumindest einigermaßen verlassen konnte. Der in Avignon residierende Clemens VII. wurde von Frankreich, Neapel, Schottland und Spanien anerkannt. Italien, England, die skandinavischen Länder, Polen, Ungarn und das Reich hingegen betrachteten Urban VI. als ihr geistliches Oberhaupt, als ihren, den einzig wahren Papst.
Die Gefolgschaft des römischen Papstes erstreckte sich indessen nicht über das gesamte Reich. So waren zum Beispiel nicht nur die romanischen Teile im Westen des Reiches, sondern auch weite Teile des Oberrheins nach Avignon ausgerichtet. Herzog Leopold III. von Österreich († 1386), der bei der Schlacht von Sempach sein Leben ließ, avancierte zum mächtigen Beschützer Clemens’ VII. Für Avignon sprachen sich ferner Markgraf Bernhard I. von Baden sowie Graf Eberhard II. von Württemberg aus. Dezidierte Anhängerschaft Avignons im deutschen Südwesten gab es auch in den niederen Rängen – etwa beim Lorcher Benediktiner Nikolaus Vener und dessen Bruder Reinbold († 1408), dem Offizial der Stadt Straßburg. Erst später wird die gesamte Familie eine Kehrtwendung vornehmen und sich die römische Gesinnung anheften.
Die Gemengelage im Südwesten: Die vorderösterreichischen Städte Freiburg im Breisgau und Neuenburg gehörten noch 1409 zum avignonesischen Einflussbereich; Freiburg wurde sogar zeitweilig zum Stützpunkt der päpstlichen Legaten und zum Sitz der Verwaltung des Bischofs von Konstanz, der nach Avignon hin ausgerichtet war. Das Bistum Konstanz ist ein geradezu klassisches Beispiel der Zerrissenheit einzelner Landschaften: Die Klöster St. Gallen und St. Georgen gehörten der römischen Obödienz an; zumindest anfänglich bekannten sich die Städte Aarau, Baden, Schaffhausen, die Klöster St. Blasien, St. Ulrich, St. Urban und Gnadenthal sowie etliche andere zu Avignon. Im benachbarten Bistum Basel stritten sich eine Zeit lang zwei unterschiedlich ausgerichtete Prätendenten um die Vorherrschaft – mit umfassenden Verwerfungen bis in die Diözese.
Schwer zu sagen, inwiefern das Schisma die Zeitgenossen im Allgemeinen wirklich belastet oder gar aufgerieben hat. Es war ja keineswegs das erste Schisma der Kirchengeschichte. Im Gegenteil: Spaltungen, Abtrennungen und Aufteilungen waren immer schon ein Teil ihrer Erscheinung. Und längst waren auch Verdammungen und Verfluchungen, waren Interdikt und Exkommunikation gewöhnlich geworden, hatten die einst so gefürchteten Waffen durch übermäßigen Gebrauch viel von ihrem Schrecken verloren. Wenn ein Pfarrer vor Ort die Messe las, wenn die zentralen Stationen des Lebens von geistlichem Beistand begleitet blieben, mochte man das Schisma kaum merken, dann blieb es ein Spezialproblem für die oberen Ränge.
Anders sah es hingegen aus, wenn zusammengehörige Landschaften, wenn Bistümer und Städte als solche von der Spaltung betroffen waren, und sicherlich war es nicht nur blinder Formelkram, wenn ein Zeitgenosse klagte:
„Ein Reich kam über das andere, eine Landschaft gegen die zweite, der Klerus kämpfte gegen den Klerus, Doktoren gegen Doktoren, Eltern erhoben sich gegen die Söhne und Söhne gegen die Eltern.“
Die Jahre vergingen, die alten Päpste starben, neue wurden gewählt. Ja, das Schisma war „groß“ – aber hauptsächlich aufgrund seiner Dauer, seiner zeitlichen Ausdehnung, die nicht enden zu wollen schien. Es wirkte ausgehämmert wie auf Jahrhunderte. Eine Generation wuchs auf, ohne etwas anderes als den Zustand der Teilung gekannt zu haben. 1406/7 kam unerwartet Bewegung ins Spiel. In Frankreich, bislang Benedikt XIII. untertänig, forderten Synoden die alten Freiheiten der Kirche des Landes zurück und erklärten sich in der Schismafrage für neutral. Durch die Ermordung des Herzogs von Orléans († 1407), bisheriger Höhepunkt in einem Machtkampf zweier Familien um die Vorherrschaft im Land, verlor der avignonesische Papst zudem seinen großen Förderer. Benedikts Front bröckelte.