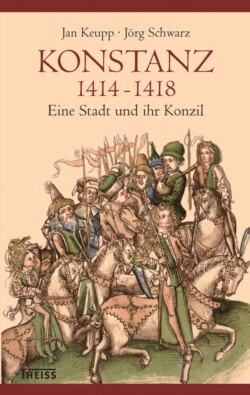Читать книгу Konstanz 1414-1418 - Jörg Schwarz - Страница 12
Aufgipfelung und Widerstand
ОглавлениеWer den Weg zum „Pisanum“, zum allgemeinen Konzil, das für den 25. März 1409 in Pisa einberufen wurde, schließlich beschritt, war freilich nicht Benedikt, auch nicht Gregor XII., es waren die Kardinäle. Insgesamt 13 von ihnen waren in diesem Sinne zusammengekommen. Getragen hatte sie dabei der Gedanke, dass in Zeiten der Not, der kirchlichen Krise das Berufungsrecht auf sie, die Kardinäle, übergehen konnte. Der Gedanke, kühn und abenteuerlich auf den ersten Blick, war keine Ausgeburt übertrieben selbstbewusster Purpurträger. Im Gegenteil: Er war alt, ganz alt. Im Grunde geht er zurück auf das Apostelkonzil, jene zwischen 44 und 49 nach Christus in Jerusalem zustande gekommene Zusammenkunft der Jerusalemer Urgemeinde mit Paulus von Tarsus und seinen Begleitern. Dieses korporative, also körperschaftliche, nicht nur auf die Spitze, das Haupt bezogene Prinzip hatte streng genommen in der Kirche immer seinen Platz gehabt, war jedoch durch die historischen Entwicklungen des hohen Mittelalters systematisch an den Rand gedrängt worden.
Eine Reihe unterschiedlichster Ansätze und Vorprägungen aufnehmend, hatte sich seit dem 11. Jahrhundert zunehmend ein „monarchisches Papsttum“ herausgebildet – in Gedanken, Worten und Taten. Bereits in dem berühmten, wenn auch in seinen genauen Absichten umrätselt bleibenden Dictatus papae Papst Gregors VII. (1073–1085) standen Sätze zu lesen wie: „Dass allein der römische Bischof mit Recht ‚allgemein‘ genannt werde“ oder „Dass allein der römische Bischof Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann“ oder „Dass die wichtigen Streitfragen in jeder Kirche an den römischen Bischof übertragen werden müssen“. Das aber war nur der Anfang, die Entwicklungen gingen weiter. „Der wahre Kaiser ist der Papst“ – so lautet beispielsweise ein Zitat aus dem 12. Jahrhundert, das sich in der sogenannten Summa Parisiensis, einem im Paris um 1160/1170 verfassten kirchenrechtlichen Werk, findet, und es gab zahlreiche Päpste, die danach zu handeln schienen – nach innen wie nach außen. Immer mehr schien sich der Papst wie ein absoluter Monarch zu gerieren, mit fast uneingeschränkten Machtansprüchen in kirchlichen wie in weltlichen Angelegenheiten.
„Ich bin über das Haus Gottes gesetzt, damit meine Stellung alles überrage. Mir ist gesagt vom Propheten: Ich will dich über Völker und Königreiche setzen. Von mir heißt es beim Apostel: ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Der Knecht, der über das ganze Haus gesetzt wird, ist der Stellvertreter Christi; er ist in die Mitte gestellt zwischen Gott und den Menschen, geringer als Gott, aber größer als der Mensch.“
So predigte Papst Innozenz III. (1198–1216) an seinem Weihetag dem römischen Volk, und diese Gedanken standen bei ihm, der gegen innerkirchliche Rebellen wie gegen widerspenstige europäische Herrscher von Rang ein hartes Regiment verfocht, keineswegs allein.
Die umfassendste Begründung päpstlicher Weltherrschaft lieferte Bonifaz VIII. (1294–1303) mit seiner Bulle Unam sanctam von 1302, geschrieben mitten in scharfen Auseinandersetzungen, die sich der Gaetani-Papst mit dem kaum minder selbstbewussten französischen König Philipp IV., dem Schönen (1285–1314), lieferte:
„Wir sind, vom Glauben getrieben, zu bekennen und daran festzuhalten gezwungen, dass es nur eine einzige heilige katholische und apostolische Kirche gibt. (…) Nun aber erklären wir, sagen wir, setzen wir fest und verkündigen wir: Es ist zum Heile für jegliches menschliche Wesen durchaus unerlässlich, dem römischen Papst unterworfen zu sein.“
Auch wenn die Bulle weniger originell ist, als man früher glauben wollte, sondern sich aus einer Reihe bereits andernorts verwendeter Gedanken zusammensetzt, stellt sie in ihrer Verschmelzung des Materials doch einen Höhepunkt dar. Einmalig war auch der Versuch des Papstes, das alles auch in praktische Politik umzusetzen.
Überragt und unterworfen, nimmt man alle diese Sätze ernst, wurden dadurch nicht nur Kirche und Welt als bloße Abstrakta, überragt und unterworfen wurden dadurch vor allem auch die Kardinäle, die seit dem 11. Jahrhundert ebenfalls immer selbstbewusster geworden waren. Als eine innerkirchliche Möglichkeit, mit den Mitteln des Rechts den monarchischen Anspruch des Papstes zu knacken, erwies sich dabei ein Satz aus einer in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von dem Bologneser Gelehrten Gratian († vor 1160) zusammengestellte Rechtssammlung, das Decretum Gratiani, wo der Satz zu lesen stand, dass der Papst von niemandem gerichtet werden dürfe – außer er falle vom Glauben ab. Sofern das aber geschehe, sei der Papst ein Häretiker, ein Ketzer. Und, so konnte man bei einem anderen Kirchenrechtler des 12. Jahrhunderts finden, selbst das Verharren im Schisma, in der widernatürlichen Teilung der Kirche, könne schon als Häresie, derer sich ein Papst schuldig machen könne, ausgelegt werden. Anderes aus diesen oder ähnlichen Arsenalen kam hinzu. So etwa der bekannte Satz Christi „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 18,20). Auf die Versammlungen, die Gemeinschaftlichkeit der Christen kam es also an, nicht auf die Führung durch einen Einzelnen. Oder vor allem auch der aus dem römischen Privatrecht stammende Satz, der auch andere, ähnlich gerichtete Entwicklungen – wie etwa die Entstehung des englischen Parlaments im 13. Jahrhundert – entscheidend beeinflusst hat: „Was alle angeht, muss auch durch alle verhandelt und gebilligt werden.“
Ein weiterer entscheidender Schritt, der noch vollzogen werden musste, um dem konziliaren Gedanken zum Durchbruch zu verhelfen, war die Idee, dass ein allgemeines Konzil die Gesamtkirche vertreten könne – „der Leiter der Kirche“ hingegen, der Papst, nur eine Art Minister, also Diener sei. 1379 schließlich hatten zwei prominente deutsche Theologen, Heinrich von Langenstein († 1397) und Konrad von Gelnhausen († 1390), den Satz formuliert, dass ein allgemeines, die Gesamtkirche vertretendes Konzil Richter über Kardinäle wie Päpste sein dürfe. Beide – Langenstein und Konrad von Gelnhausen – schrieben ihre Auffassungen in Paris nieder. Erst später, 1384, wurde Langenstein nach Wien zur Gründung der theologischen Fakultät für die dortige Universität berufen; Konrad von Gelnhausen hingegen wirkte mit am Aufbau der Universität Heidelberg (1386), wo seine Bücher den Grundstock der dortigen Universitätsbibliothek bildeten. Paris, wo die beiden herkamen, mit seiner berühmten, im 12./13. Jahrhundert erwachsenen Universität war einer der Knotenpunkte des Geistes seit dem hohen Mittelalter, ein Zentrum der Gelehrsamkeit, aber auch – nicht immer ein Widerspruch – der aufrührerischen Ideen. Kaum zu glauben, was hier alles möglich war: Prozesse der Rationalisierung, Durchbrüche des „Lichtes der Vernunft“, ja im 13. Jahrhundert wagte man es hier bereits, Gottes Existenz zu leugnen. Eine kühne Auffassung gewiss, doch immerhin ausgesprochen. Zwei Pariser Theologen – der Universitätskanzler Pierre d’Ailly († 1420) sowie sein Schüler Jean Gerson († 1429) – führten die Gedanken der beiden Deutschen, Heinrich von Langensteins und Konrads von Gelnhausen, weiter fort. In Italien tat der Kirchenrechtler Francesco Zabarella († 1417) ein Gleiches, ja durch ihn erfuhren sie eine bisher ungeahnte Schärfung und Zuspitzung. Zabarella meinte: Die Gesamtkirche, die nicht irren kann, bilde sich im Generalkonzil ab, diesem gehöre die „Vollgewalt“ sowohl über die Glieder der Kirche als auch über die weltlichen Autoritäten (plenitudo potestatis), eine Art Zauberformel, die den Machtanspruch des monarchischen Papsttums begründet hatte.