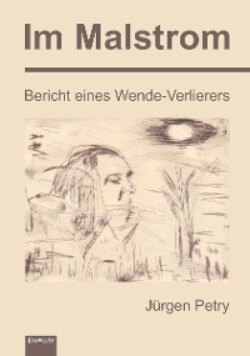Читать книгу Im Malstrom - Jürgen Petry - Страница 12
IV
ОглавлениеUnser Sohn Waldemar Henry, wie ich ihn jetzt zu seinem Ärger nannte, war aktiv, glücklich mit seiner neuen Freundin, der Ische Ilona, und seinem selbstbestimmten Namen. Besonders aber mit den rasanten Veränderungen im Land. Gleich als es möglich war, wurde er in den ersten provisorischen Betriebsrat seiner Firma gewählt. Es ging aufwärts, dachte er. Doch wer hoch steigt, kann tief fallen. Nach einigen Monaten der Euphorie fiel er dann auch. Zunächst wieder zurück auf die Füße. Betriebsratsmitglied hin oder her, er gehörte zu den ersten, die freigesetzt wurden. Das war sogar noch einigermaßen logisch, diesmal aus Sicht der Gutmenschen, denn in den provisorischen Betriebsrat hatten sich auch einige Mitglieder der alten Betriebsgewerkschaftsleitung eingeschlichen. Das ging natürlich gar nicht, befand der neue Besitzer, als der Betrieb ihm gehörte. Außerdem war der Betriebsrat, wie bereits gesagt, ein Provisorium, also nur auf Zeit eingesetzt. Frei gewählt durch die Arbeitnehmer war er nicht! Gewählt zwar, aber so wie in der DDR üblich durch Handzeichen. Das reichte für einen Betriebsrat, den man brauchte, um mit seiner Zustimmung den Betrieb verkaufen zu können, für mehr aber nicht. Also arbeitete man zunächst ohne Betriebsrat. Einige Zeit später, Waldemar Henry war bereits geflogen, hätte theoretisch ein neuer Betriebsrat gewählt werden können. Ganz korrekt, in geheimer Wahl mit richtiger Urne. Doch dazu kam es dann leider nicht mehr. Der neue Inhaber war gerade dabei, die Firma abzuwickeln und ein Betriebsrat hätte dabei nur gestört. Notwendig war er auch so nicht mehr unbedingt, denn die Mehrzahl seiner potentiellen Wähler sahen sich ihren früheren Betrieb bereits von draußen an. Doch ich greife vor. Gehen wir noch einmal zurück zu unseren Vorwende-Lebensumständen.
Meine Frau Jana und ich waren schon früh, dank eines Tauschgeschäfts mit einer Tante und mit Assistenz der Betriebsgewerkschaftsleitung, Mitglieder einer Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) geworden und als solche inzwischen stolze Besitzer einer Vier-Zimmer-Neubauwohnung. 78 Mark Miete kostete sie uns monatlich, warm, versteht sich. Später, als im vereinten Vaterland das Licht aus der Sonnenuntergangsrichtung immer längere Schatten nach Osten zu werfen begann, würde man solche Wohnungen in den Medien verächtlich „Platte“ nennen. Klar, offensiv verächtlich machen musste sein. Wie hätte man sonst die wachsende Ostalgie bekämpfen sollen? Die entstand ja nun einmal nur, weil die undankbaren Ossis im Beitrittsgebiet manches anders vorgesetzt bekamen als von ihnen einst erwartet. Geschieht uns recht. Hätten wir doch besser zugehört in den politischen Veranstaltungen. Aber was soll es, in der DDR gab es ja auch nur die Farben Schwarz und Weiß, wenn uns etwas berichtet wurde aus dem goldigen Westen da drüben. Wer hätte da wissen können, was wahr und was Propaganda ist? Wohin so etwas führt, wissen wir jetzt allerdings!
Ach, fast hätte ich es vergessen, eine Reihengarage besaßen wir auch, ein echtes Privileg damals. Und darin stand ein achtzehn Jahre alter, weißer 353er Wartburg mit rotem Dach. Er war ein indirektes Geschenk meines Vaters Waldemar. Indirekt, weil er uns nicht das Auto und auch nicht das Geld dafür schenkte, sondern uns eine seiner parallel laufenden Bestellungen auf diesen Wagen abtrat. Als Gegenleistung verlangte er von uns nur, dass wir seinem ersten Enkel, falls wir einen solchen je zustande bringen würden, den vom Aussterben bedrohten Vornamen Waldemar geben. Dafür wollte er uns sogar das Geld, das wir wahrscheinlich allein für einen solchen Wagen auch nie zusammenbekommen hätten, mit einem günstigen Zinssatz von sechs Prozent vorschießen. Das war der bereits mehrfach angedeutete Deal. Jana wehrte sich zunächst heftig dagegen, doch als alle unsere Bekannten und Freunde ein Auto fuhren, siegte er schließlich, der Gruppendruck. Wir nahmen den angebotenen Kredit meines Vaters und auch die Anmeldung. Als es dann soweit war, ich glaube drei Jahre nach Waldemar Henrys Geburt, kauften wir ihn uns, den herbeigesehnten Wartburg, und zahlten den Kredit und die Zinsen in kleinen Raten fast bis zur Wende an meinen Vater ab. Unser Erstgeborener bekam den Namen Waldemar. Wort ist Wort, sagte ich der schmollenden Jana, bis sie sich fügte, aber mit der Faust in der Tasche.
Die uns versprochene Autobestellung, das droht in Vergessenheit zu geraten, stellte in der DDR schon einen Wert an sich dar. Sie war deshalb eine reale Gegenleistung bei dem Deal. Mein Vater hätte den Bestelltermin auch gut und gerne an andere verkaufen können. An Käufern mangelte es nicht, damals. Als Waldemar Henry mit seinem Wunsch zur Namensänderung vorstellig wurde, schämten wir uns zwar, seinerzeit darauf eingegangen zu sein. Doch dem Namensänderungswunsch konnten wir wegen der Treue zum Deal nicht zustimmen. Die setzte er, wie bereits berichtet, schließlich mit Hilfe der Sachbearbeiterin Schön beim Amt für Personenstandswesen Bitterfeld ohne unseren Segen durch.
Die Bestelllaufzeit für einen Wartburg betrug in jener Zeit ungefähr 16 Jahre. So lange im Voraus hatten wir uns nicht binden wollen, als es uns möglich gewesen wäre, eine Autobestellung aufzugeben. Und auf die Idee, es zu tun und damit später vielleicht zu handeln, kamen wir nicht. Richtiger, Jana und ich lehnten solche halbkriminellen Praktiken ab. Außerdem war da noch die Wohnung mit allem, was dazugehört, schließlich der im Anmarsch befindliche Nachwuchs. Dass Bestelldaten für ein Auto auf dem freien Markt gehandelt wurden im „real existierenden Sozialismus“ der DDR, ist Außenstehenden schwer zu erklären. Aber heute verstehen die einfachen Leute ja in der Regel auch nicht, wie man Steuern in Größenordnungen straflos hinterziehen kann. Für damalige Geschäftemacher war das normal, für heutige eben vieles andere. Und die Gegenleistung, dass unser Sohn den Namen seines Großvaters tragen sollte, kostete uns ja nichts und direkt ehrenrührig war der Deal auch nicht. Er belastete lediglich lange Zeit später das Verhältnis zwischen unserem Sohn und mir.
Mein Vater Waldemar allerdings kannte sich aus mit Geschäften hart am Rande der Legalität. Selbst hatte er manchmal sechs Autobestellungen gleichzeitig laufen, auf unterschiedliche Namen. Damit reduzierten sich rein rechnerisch die Bestelllaufzeiten für ihn oder für den, an den er den nahen Liefertermin verkaufte, von 16 auf unter drei Jahre. Kein schlechtes Geschäft, wenn man nicht die Autos kaufte, die Bestellungen dagegen an finanzkräftige Interessenten abtrat. Der Gewinn konnte ungefähr den Gegenwert eines Autos betragen. Je nach Skrupellosigkeit des Verkäufers und Bonität des Abnehmers. Das Problem bestand lediglich darin, Anmelder zu finden, die das Geschäftsmodell nicht selbst kannten. Mein Vater löste das mit Hilfe unserer Familie. Zwei Bestellungen liefen immer auf seinen Namen und den meiner Mutter, je zwei auf Janas Eltern, die, glaube ich, davon zunächst nichts ahnten. Danach sogar je eine auf uns, meine Frau Jana, mich und Waldemar Henry. Eine davon überließ uns schließlich Vater Waldemar, kostenlos, fügte er hinzu.
Na, Schwamm darüber. „Wer tüchtig ist, bekommt in jeder Gesellschaft seine Chance“, sagte mein Vater mit ironischem Nicken in meine Richtung. „Heute hat man leider dieses tolle Geschäftsmodell durch die Marktwirtschaft und die moralische Kurzlebigkeit der Westautos ruiniert“, bedauerte er nach der Wende. „Was waren das für tolle Zeiten, als man einen zehn Jahre gelaufenen Wartburg oder Trabant noch über dem ursprünglichen Neuwert verkaufen konnte“, schwärmte er. „Schade, aber alles hat seine Zeit. Dafür kann man heute leichter Steuern hinterziehen, Rentner betrügen, Firmen schleifen und den Gewinn einstreichen. Was war dagegen schon das Verkloppen eines Liefertermins?“, fügte er nicht ohne Stolz hinzu, wenn ihm wieder einmal ein Deal gelungen war. „Schade, schade nur, dass die Wende nicht zwanzig Jahre früher gekommen ist“, sagte er bedauernd, „ich jedenfalls wäre heute Millionär!“