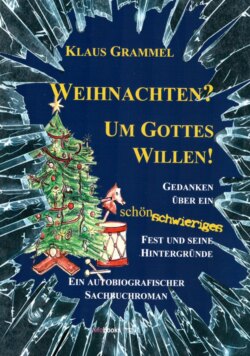Читать книгу Weihnachten? Um Gottes Willen! - Klaus Grammel - Страница 15
Wer ist dieser Mann für mich?
ОглавлениеDiese Frage hatte mir auch das junge Ehepaar gestellt. Um meine Gedanken zu straffen, hatte ich auf ein paar Seiten meine Sicht aufgeschrieben und sie den beiden zugeschickt, damit sie sich schon damit vertraut machen konnten.
Ihr habt mich gefragt, wer dieser Mann aus Galiläa für mich ist? Ich will euch meine Antwort geben. Sie ist nicht fertig, weil ich mit diesem Jesus nicht fertig bin. Dennoch ist sie die Summe dessen, was ich im Hinblick auf ihn gelernt und erkannt habe.
Seit 63 v. Chr. herrschten die Römer über die Juden. Diese taten sich schwer, die römische Oberhoheit anzuerkennen. Immer wieder hatte es Aufstände und Unruhen gegeben. Da waren die Römer schnell bei der Hand, kurzen Prozess zu machen, wenn es galt, mögliche Unruhen rechtzeitig im Keim zu ersticken. Das richtete sich in erster Linie gegen die jüdischen Freiheitskämpfer, die Zeloten (Eiferer), mit derem radikalen Flügel, die Sikarier (Dolchmänner). Sie alle waren natürlich für die Römer bloße Terroristen.
Gefährlich, wenn auch nicht in so direkter Weise wie die der jüdischen Freiheitskämpfer, waren für Rom auch die radikalen Reformbewegungen, wie die des Johannes, den man den Täufer nannte. Er rief zur radikalen Umkehr auf. „Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt.“ Es ist fünf vor zwölf. Was nottut, das ist eine persönlich entschiedene, glaubwürdige Einsicht in die Ursache des herrschenden Übels und eine Änderung des praktischen Verhaltens, auch des politischen. Zu seinem Markenzeichen wurde als Zeichen der Erneuerung das Untertauchen im Jordan.
Die Wirkung des Johannes war groß. Sein Landesherr, der Herodessohn Herodes Antipas, König über Galiläa und Peräa, römisch erzogen und vom Judentum innerlich so weit weg wie schon sein Vater, ließ ihn, bevor womöglich ein Aufruhr entstehen könnte, gefangen nehmen und ohne Gerichtsverhandlung umbringen.
Auch die Bewegung des jüdischen Rabbis Jesus aus Nazareth, die aus der Johannesbewegung hervorgegangen war und ebenso wenig wie diese eine direkte politische Zielsetzung hatte, musste der politischen Obrigkeit als gefährlich erscheinen.
Spätestens mit dem gewaltsamen Tod des Täufers stand für Jesus aus Galiläa die Frage an, ob er nach Hause gehen sollte, zurück in sein „bürgerliches“ Leben, oder ob er nicht weiter machen müsste.
Er machte weiter und blieb somit der Sicht auf die Dinge treu, für die Johannes ihm die Augen geöffnet hatte.
Der Weg führt ins Verderben. „Kehrt um, und glaubt daran, dass Gott es mit uns gut meint!“
Dieser Satz des Täufers begegnet uns auch im Munde Jesu als Programm seines Redens und Tuns. Jesus hatte sich von seinem vormaligen Meister im Jordan untertauchen lassen. Dazu stand er. Wie er allerdings weitermachte, das war sehr anders als Johannes es getan hatte.
Er zog sich nicht in die Steinwüste am Jordan zurück, sodass die Menschen zu ihm kommen mussten. Er ging zu ihnen und lebte unter ihnen und mit ihnen, dort, wo sie waren: bei den Fischern am Ufer des Sees Genezareth, bei den Zöllnern an ihren Zollstationen, bei den Bettlern im Schatten der Synagogen, bei den einfachen Menschen in den Straßen und am Stadttor.
Er kleidete sich wie sie, nicht so alternativ wie der Aussteiger Johannes der Täufer, der einen rauen Mantel aus Kamelfell trug. Er tauchte auch niemanden unter als Zeichen der Neubesinnung. Er lebte überhaupt nicht als asketischer Aussteiger. Er sammelte Menschen um sich und lehrte sie zu teilen. So wenig es war, was da zusammenkam – in der Gemeinschaft ist einer nie allein, und das zählt mehr als ein voller Magen. Wenn man teilt, kommt man nicht zu kurz.
Öfters lud Jesus sich mit seinen Freundinnen und Freunden auch einfach bei denen ein, die genug Geld hatten. An Jesu Tisch war jeder willkommen. Nur, die „Anständigen“ wollten nicht kommen. Mit den Schmuddelkindern zusammen essen, diesem Gesocks aus Kollaborateuren, Prostituierten, gottlosen Tagelöhnern, Bettlern, die man alle in den heiligen Tempel in Jerusalem nicht hineinlassen würde, nein, das kam nicht infrage.
Jesus sprach seinen Kritikern das Recht ab, darüber Bescheid zu wissen, wen Gott akzeptiert und wen nicht. Alle Gruppen neben ihm definierten das Volk Gottes so, dass sie bestimmte Leute ausschlossen. Sie richteten, als würden sie an Gottes Stelle stehen. Wenn man das macht, dann meint man, wenn man Gott sagt, in erster und auch noch in letzter Linie: Ordnung, Moral. Man gesteht sich das Recht zu, ständig über andere, auch über sich selbst, zu urteilen.
Meint man aber mit dem Wort „Gott“ ein Leben in Anerkennung, in Würde, in gegenseitigem Respekt, in sozialer Zuwendung, in gerechten Verhältnissen, ein Leben mit gegenseitiger Hilfe und in Solidarität, mit einem Wort: Legt man Gott als Liebe aus, dann ist es vorbei mit dem Richten über andere.
So wurde Jesu Tischgemeinschaft zu seinem Markenzeichen, auch noch in der Diffamierung durch seine Gegner, die versuchten, ihn als „Fresser und Säufer“ unmöglich zu machen.
Das „Gottesreich“ – das war sein zentraler Begriff, mit dem er ein Leben meinte, in dem sich Menschen gegenseitig als Menschen annehmen, und in dem Verhältnisse herrschen, die dem Leben dienen.
Dieses Gottesreich kommt nicht von Außen, plötzlich durch eine endzeitliche Retterfigur dem Menschensohn oder dem von Gott geschickten Messias. Es beginnt schon da, wo Menschen von Gottes Nähe einfach Gebrauch machen. Und das geschieht, wo man sich nicht mehr gegenseitig sein Recht auf Leben abspricht, sondern sich hilft, sein Leben zu finden.
Wenn dann das apokalyptische Ereignis eintritt und der zukünftige Menschensohn erscheint, an den man damals glaubte und an den auch Jesus als Kind seiner Zeit geglaubt hatte, dann werde der himmlische Gesandte ihm, Jesus, Recht geben; er würde ihn bestätigen.
Ich denke, dass Jesus die Sache so gesehen hat.
Johannes,
der kann es,
der Täufer.
Doch Jesus, der Säufer
und Fresser
kann´s besser.
Jesus leistete sich eine enorme Freiheit der Tradition gegenüber. Auf der einen Seite, konnte er die Tora verschärfen: Nicht erst, wer tötet, wird dem Gericht verfallen, sondern schon jeder, der zu seinem Bruder „du Hohlkopf, du Idiot“ sagt. Auf der anderen Seite konnte er die strenge Beachtung des Sabbats voll unterlaufen. „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat.“
Jesus lebte aus einer enormen inneren Freiheit heraus und machte von ihr manchmal absichtlich auch einen provokativen Gebrauch. Sein Maßstab war: Tue, was dem Leben dient.
Als Jesus dann am Kreuz gestorben war, standen seine Anhänger in ähnlicher Weise wie Jesus nach dem Tod des Täufers, vor der Frage, ob die Erfahrungen mit diesem Wanderrabbi nur eine interessante Episode war oder ob ihr Meister nicht so unendlich Recht hatte mit dem, was er glaubte, sagte und tat, dass sie ihm Recht geben müssen; auch jetzt, gerade jetzt, wo man sein Vermächtnis auslöschen wollte durch die Kreuzigung. Sie machten weiter, in ihrer Weise, indem sie ihn den Messias nannten, was Jesus nach meiner Meinung im Hinblick auf sich selbst nicht getan hat. Jesus ist der Messias! Dieser Satz bedeutete für sie: Unsere Feinde haben sich geirrt, wenn sie dachten, sie könnten Jesus mundtot machen für immer. Und das heißt inhaltlich: Sie könnten Gott als Liebe aus der Welt hinaus kreuzigen.
„Das könnte den Herren der Welt ja so passen …“ , dass es mit Jesus und seiner Sache, der Sache Gottes, zu Ende sei; so hat der Schweizer Theologe und Dichter Kurt Marti es mal formuliert.
Man hat Jesus niedergeschlagen, aber wie ein Boxer, der bei Neun wieder da ist, so ist auch er nicht am Boden liegen geblieben, sondern wieder aufgestanden. Das meint man, wenn man von Auferstehung spricht. Der Begriff ist völlig überhöht und dogmatisch verfärbt. „Auferstehen“ – das steht nirgendwo in den Texten. „Aufstehen“ steht da, kein religiöses Sonderwort, sondern ein ganz alltägliches Wort, nicht zu unterscheiden von dem banalen Aufstehen, wenn sich einer erhebt. Ein Bildwort dafür, dass es nicht gelang und nie gelingen kann, gewaltsam das zu töten, was wahr ist.
Viel mehr weiß ich von diesem Jesus nicht zu erzählen, weil die Quellen nicht viel mehr hergeben. Außer noch dieses:
Dass er sprachgewaltig von seinem Gottesreich, dem gelingenden Leben, erzählt hat, in hinreißenden Bildworten und Vergleichen, Gleichnissen, Parabeln und Beispielgeschichten.
Und dass er Mut dazu gemacht hat, wenn er vom Samen sprach, der aufgehen kann, vom Sauerteig, der eine Schüssel voller Mehl durchdringt, von einem kleinen Senfkorn, das zu einem großen Gewächs heranwächst.
Und dass er Menschen die Augen öffnen konnte mit wunderbar griffigen übertriebenen Worten wie „Was siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten, nicht aber den Balken in deinem eigenen.“
Und dass er sich der Menschen annahm und heilte, nicht als ein Wundermann von Außen, sondern indem er Menschen ermutigte, sich selbst anzunehmen.
„Willst du gesund werden?“, fragte er einen Kranken.
Wenn der gesagt hätte „Ja, natürlich!“, aber in Wahrheit seine Rolle als bemitleidenswertes Opfer lieber hatte als ein Leben in eigener Verantwortung, dann wäre auch Jesus chancenlos gewesen.
Jesus muss seiner Familie sehr peinlich gewesen sein. Jedenfalls haben sie ihn für „verrückt“ erklärt. Sie wollten ihn in den gesitteten Schoß der Familie zurückholen. Die Szene wird in der Bibel geschildert. Jesus sitzt im Kreis seiner Jüngerinnen und Jünger. Man sagte ihm, dass seine Mutter und Geschwister draußen stünden.
Da fragte er nur: „Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder?“ Und er schaute in die bunte Runde seiner Anhänger und sagte. „Hört zu, die hier – das sind meine Mutter und meine Brüder! Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.“
Wann und wie er gezeugt worden ist und geboren wurde, und wo, was, wann und bei welcher Gelegenheit er gesagt oder getan hat, wie sein Leben verlief, geschweige denn, wie seine seelische Entwicklung ablief, ja nicht einmal, wann er genau gestorben ist – das alles weiß ich nicht. Und ich behaupte in vollem Ernst, dass die, die meinen, das zu wissen, den Mund zu voll nehmen.