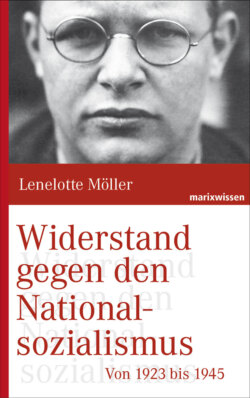Читать книгу Widerstand gegen den Nationalsozialismus - Lenelotte Möller - Страница 10
Оглавление1. Einleitung: Formen von Widerstand
Begriffsbestimmung
Der Begriff des Widerstands gegen den Nationalsozialismus ist nicht leicht zu fassen. Menschen, die die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze der NS-Ideologie nicht einhielten, die sich gegen Hitler, seine Partei oder die Verbrechen des Regimes stellten, taten dies unter sehr verschiedenen Bedingungen, auf unterschiedliche Weise, aus verschiedenen Gründen und mit unterschiedlichen Folgen:
Sie kamen aus höchst unterschiedlichen sozialen Schichten, waren Adlige, Bürger, Bauern oder Arbeiter, Offiziere oder Soldaten, und hatten höchst unterschiedliche Weltanschauungen, waren Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Liberale und Demokraten, Katholiken, Protestanten, Juden, Pazifisten und Patrioten und konnten in einer Person auch mehreren der hier bezeichneten Gruppen angehören. Ihre Kritik am Nationalsozialismus bezog sich entweder auf die Partei und ihre Herrschaft als Ganzes, oder sie lehnten einzelne Verbrechen besonders ab wie die Abschaffung von Demokratie und Grundrechten, den Staatsterror, den Antisemitismus, die Tötung Behinderter, die Kriegsvorbereitungen bzw. den Krieg oder nur die katastrophale Kriegsführung, Übergriffversuche auf Institutionen, denen sie angehörten, oder die Rivalität um den Einfluss auf die Bevölkerung und ihre Lebensbereiche im Vordergrund; manche verteidigten ihre Existenz und die ihrer Schicksalsgenossen, andere nur ihre eigenen Interessen, ja manche gerieten sogar durch eine einmalige, vielleicht sogar zufällige Situation in Gegensatz zum nationalsozialistischen Regime und setzten dann erst den ohne ihr bewusstes Wollen begonnenen Widerstand konsequent fort. Danach hing die Frage, ob jemand Widerstand leistete oder sich den Gegebenheiten anpasste, sehr von der Fähigkeit ab, unter den gegebenen Zwängen die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen.1
Zum Teil in Abhängigkeit davon waren auch die Ziele all der Maßnahmen, die sich gegen den Nationalsozialismus richteten, höchst unterschiedlich: Während es den einen darum ging, die eigene Unabhängigkeit und Freiheit oder die einer Institution zu bewahren, ihr eigenes überfallenes oder verratenes, jedenfalls unterdrücktes Volk zu befreien, setzten sich andere für die Rettung mehrerer oder auch nur einzelner Menschen ein, wieder andere für die Beseitigung Hitlers und des Regimes mit oder ohne Überlegungen für eine anschließende Ordnung Deutschlands, manche schließlich setzten um den Preis des eigenen Lebens nationalsozialistischem Zwang und Terror eine Grenze, indem sie ein anderes retteten.
Auch hinsichtlich des Zeitpunktes unterschieden sich die Aktionen gegen die NS-Herrschaft: Während die einen die Partei und ihre führenden Figuren schon früh durchschauten und gegen sie argumentierten und agitierten, vollzogen manche ursprüngliche Sympathisanten nationalsozialistischer Ideen den schweren Schritt, Fehler einzugestehen, Irrwege zu verlassen, Entschuldigungen nicht mehr vorzuschieben, die man lange hatte gelten lassen, erst spät – aber doch vor 1945 und bisweilen mit allen Konsequenzen. Es gab schließlich die Menschen, die gleichzeitig von der NS-Herrschaft profitierten, während sie an anderer Stelle jeweils ihre Möglichkeiten nutzen, Leben zu retten und Verbrechen zu verhindern oder zu mildern.
Die Taten des Widerstands waren offen, wie z. B. Protestaktionen, Predigten oder publizistische Werke zur Aufklärung im In- und Ausland, offen und gleichzeitig anonym wie Flugblätter, sie geschahen heimlich, wie etwa Sabotageakte, die Rettung von Verfolgten durch Verstecken oder Fluchthilfe, sie reichten von Kurierdiensten zwischen Stellen des Widerstands bis zu Attentaten und Umsturzversuchen. Viele Maßnahmen wurden lange geplant und gründlich organisiert, einige wenige ergaben sich spontan.
Das Risiko für die Träger des Widerstands reichte von persönlichen Nachteilen über den Verlust von Heimat, Freiheit und Gesundheit bis hin zur Lebensgefahr. Widerstand fand weder – wie es die Alliierten lange behaupteten – nur im Exil, noch – wie manche in Deutschland Verbliebenen glauben machen wollten – nur in Deutschland statt.
Schließlich unterschieden sich Akte des Widerstands in ihrer Wirkung. Während es den Kirchen gelang, in einzelnen Bereichen ihre Selbstbestimmung zu wahren und sogar zum Teil die sogenannten Euthanasie-Programme aufzuhalten, während Verfolgte in Deutschland und den besetzten Gebieten manchmal bis Kriegsende und damit endgültig vor dem Zugriff der Nationalsozialisten gerettet werden konnten, erzielten z. B. viele Aufklärungsmaßnahmen in Büchern oder Flugblättern keine messbare Wirkung.
Die Grenze zwischen der Nichterfüllung nationalsozialistischer Erwartungen und echtem Widerstand ist vor dieser unübersichtlichen Lage schwer zu bestimmen. Ian Kershaw gelangt nach einer gründlichen Untersuchung verschiedener Forschungsansätze der letzten Jahrzehnte zu folgenden Kriterien für Widerstand im engeren Sinn: »aktive Beteiligung an organisierten Bemühungen […], die […] auf die Unterminierung des Regimes oder auf Vorkehrungen für den Zeitpunkt seines Zusammenbruchs zielen.«2
Nicht zum Widerstand gehören demnach reine Abwehrversuche gegen nationalsozialistische Vereinnahmung: der Rückzug ins Private, der Versuch, Situationen der Mitwirkung oder des Mitmachens auszuweichen oder z. B. heimlich ausländische Radiosender zu hören, Ungehorsam aus wirtschaftlichen Erwägungen und dergleichen.
Mitwirkung – Anpassung – Widerstand
Widerstand kann nicht ohne den Blick auf Mitwirkung und Anpassung verstanden werden, weshalb diese Verhaltensweisen auch im vorliegenden Buch immer wieder im Kontrast betrachtet werden. Während einige Personen schon 1933 und vorher über Hitler und seine Partei aufklärten und sich andere während der Herrschaft der Nationalsozialisten auf verschiedene Weise dem Regime und seinen Taten widersetzten, gab es eine zu große Zahl von Menschen in Deutschland, die bis – und zum Teil noch lange nach – 1945 nicht bereit war, die Verbrechen der Gewaltherrschaft und des Kriegs in ganz Europa einzugestehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Dies ging bisweilen so weit, dass die Überlebenden und Hinterbliebenen des Widerstands noch lange Zeit von vielen wie in der NS-Zeit selbst als Verräter betrachtet und behandelt wurden.
Im Inland und während des Kriegs auch in den besetzten Staaten hatten die von den Nationalsozialisten geleiteten Behörden freiwillige Unterstützer in der Bevölkerung. Weder die Bespitzelung von Deutschen, noch die – in den europäischen Staaten unterschiedlich durchgreifende – Verhaftung, Deportation und Ermordung von Juden und anderen Verfolgten wären ohne die jeweils einheimischen Denunzianten in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen, in dem sie stattfanden.
Grund für die Teilnahme an Verbrechen war bei den Tätern zuerst und vor allem der Wunsch, diese Verbrechen zu begehen, sowie die Ablegung aller Hemmungen, die in der menschlichen Fähigkeit des Mitgefühls liegen oder sonst in den letzten 2500 Jahren in der europäischen Geistesgeschichte entwickelt wurden.
Die Gründe für Passivität oder gar Unterstützung des Systems mögen neben persönlichen Vorteilen, das Einverständnis mit allen oder einigen Zielen des Nationalsozialismus gewesen sein, in Deutschland mag hier und da die Scheu hinzugekommen sein, während eines äußeren Kriegs gegen die eigene staatliche Obrigkeit zu kämpfen. Falsch verstandene Loyalität und bisweilen auch Angst um die eigene Person oder um Angehörige spielten eine Rolle, denn auch wenn das Risiko der möglichen Strafen nicht so groß war, wie oft gefühlt und behauptet, wenn es auch individuell sehr verschieden war – berechenbar war es gewiss nicht.
Widerstandsbegriff im vorliegenden Buch
Das vorliegende Buch trägt den Begriff »Widerstand« im Titel und soll eine Überblicksdarstellung sein. Es fasst zwar, gemäß der bereits gegebenen Abgrenzung, nicht jede Handlung als Widerstand auf, die die Forderungen und Erwartungen der Nationalsozialisten nicht erfüllte, geht aber über das Wortverständnis Kershaws hinaus:
Erstens zeitlich: Außer denen, die sich der NS-Regierung widersetzt haben, werden zunächst Gruppen und Personen vorgestellt, die sich schon vor Hitlers Amtsantritt als Reichskanzler, vor der Sicherung der Macht und der sogenannten Gleichschaltung der NSDAP entgegengestellt haben, ihrer Etablierung entgegenwirken wollten, und z. B. von Matthias Strickler daher eher als Opposition bezeichnet werden.3
Zweitens räumlich: Obgleich nicht ausdrücklich erwähnt, scheint sich Kershaws Definition doch im Wesentlichen auf den Widerstand von Deutschen zu beziehen. Im vorliegenden Buch werden aber auch Beispiele von Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht in den Blick genommen, ebenso die Versuche deutscher Exilanten, das Regime zu behindern oder sich für die Zeit nach dem Zusammenbruch vorzubereiten.
Drittens hinsichtlich der Zielsetzung der handelnden Personen: Als Widerstand werden neben Maßnahmen zur Schwächung oder Beseitigung des NS-Regimes, zu denen z. B. Versuche der Volksaufklärung und -aufrüttelung gehören, auch solche aufgefasst, die auf die Verhinderung oder Eindämmung von NS-Verbrechen zielten, auch wenn sie nicht geeignet waren, die Herrschaft Hitlers insgesamt zu gefährden, dafür aber mit hohem persönlichen Einsatz und Risiko verbunden waren. In diesem Sinne wird die Rettung fremder Menschenleben oder die Kriegsdienstverweigerung um den Preis des eigenen Lebens durchaus als Akt des Widerstands aufgefasst.
Die wichtigsten Personen und Personenzusammenschlüsse des Widerstands gegen Hitler sollen hier vorgestellt werden, denn die Entscheidung für Anpassung oder Widerstand oder das, was dazwischen lag, war immer persönlich. Deswegen stehen die Personen des Widerstands mit ihren Hintergründen im Mittelpunkt. Soweit sie, direkt oder indirekt, Textzeugnisse ihrer Tätigkeit hinterlassen haben, sind Ausschnitte davon in dieses Buch aufgenommen worden. Selbstverständlich ist eine vollständige Darstellung nicht möglich, da nicht alle genannt, geschweige denn ausführlich besprochen werden können; das gilt insbesondere für regionale Gruppen in Deutschland, für den Kampf in den im Zweiten Weltkrieg besetzten Staaten und für die zahllosen Exilanten, die an ihren Zufluchtsorten, etwa als Journalisten oder Schriftsteller, versuchten, Aufklärung nach Deutschland zu bringen und die NS-Herrschaft zu schwächen.
Nach chronologischen und geographischen Gesichtspunkten geordnet werden Beispiele des Widerstands vorgestellt, wobei der Schwerpunkt im Unterschied zu vielen Gesamtbetrachtungen nicht auf dem militärischen Widerstand und dem 20. Juli 1944 liegt, sondern einer – wie schon der Buchtitel anzeigt – auf den Fällen, in denen Menschen schon sehr früh vor Hitler und seiner Partei gewarnt und sich gegen deren Herrschaft gestellt haben. Nicht alle wollten speziell die Weimarer Verfassung retten oder waren Anhänger der Demokratie, wie sie das Grundgesetz festlegt, aber der Wunsch nach Rechtsstaatlichkeit, besonders nach Geltung von Grundrechten war ein durchaus maßgeblicher Beweggrund.
Trotz Unterschiedlichkeit der Ausgangslage werden auch an fünf Beispielen die Kämpfe von Widerstandsgruppen in fünf besetzten Staaten gegen die deutsche Besatzungsmacht – und bisweilen auch untereinander – einbezogen. Schließlich werden die sich wandelnden Bewertungen des Widerstands, die zeitlich und abhängig von politischem System und vom Standort starken Veränderungen unterworfen waren, behandelt. Ausführliche Literaturangaben bei den betreffenden Abschnitten sollen die weitere Beschäftigung mit einzelnen Personen oder Gruppen erleichtern.
1Harald Welzer: Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand. Frankfurt 22013, S. 225.
2Ian Kershaw: Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick. Reinbek bei Hamburg 42006, S. 313.
3Matthias Strickler: Der Mensch im Widerstand. In: ders. (Hrsg.): Portraits zur Geschichte des deutschen Widerstands. [Historische Studien der Universität Würzburg, Bd. VI], Würzburg 2005, S. 9–24, hier S. 15.