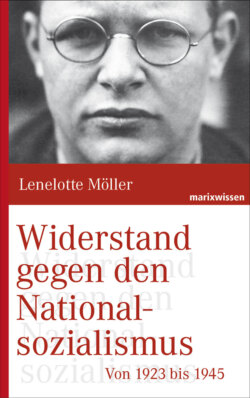Читать книгу Widerstand gegen den Nationalsozialismus - Lenelotte Möller - Страница 11
2. Gegner Hitlers und der NSDAP bis 1933 Die Entstehung der NSDAP und erste Tätigkeit
ОглавлениеAls eine von vielen Splitterparteien der frühen Weimarer Republik wurde am 5. Januar 1919 die Deutsche Arbeiterpartei (DAP) in München gegründet; ihr Programm war völkisch-antisemitisch, aber auch von sozialistischem Gedankengut geprägt. Einer ihrer Initiatoren, der Schlosser Anton Dexler, gewann im darauffolgenden Spätsommer eine Reihe neuer Mitglieder, darunter der vor seiner Ausmusterung stehende Adolf Hitler, der für die kleine Partei zunächst ebenso nützlich wurde wie sie letztendlich für ihn, denn während er als geschickter Redner für sie Stimmen gewann, bot sie ihm ein Forum für seine Agitation und Profilierung. Im Münchner Hofbräuhaus wurde sie bei ihrer ersten Großveranstaltung am 24. Februar 1920 in »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)« umbenannt und ihr 25-Punkte-Programm feierlich vorgetragen. Inzwischen war Hitler für die Partei unentbehrlich und entsprechend einflussreich geworden. Er war bereits Werbeobmann, hatte eine Gruppe von Bewunderern und Unterstützern um sich, darunter Ernst Röhm und Rudolf Hess, und stieg am 29. Juli 1921 als Nachfolger Drexlers zum (zweiten und letzten) Parteivorsitzenden mit gleichsam unumschränkten Befugnissen auf. Die Anhänger der Partei wurden mehr von der Entschiedenheit und Aggressivität des Hauptredners beeindruckt als durch die Aussagen, die sich nicht wesentlich von denen anderer völkischer Gruppen unterschieden und bezogen sich vor allem auf die arische Rasse, auf die Schuld der sogenannten Novemberverbrecher an der Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Ablehnung der Demokratie. Immer mehr gelang es Hitler, die Partei auf seine Person einzuschwören. Im August 1921 wurde die Sturmabteilung (SA) gegründet, die in ihren Uniformen und mit dem dynamisch wirkenden Symbol des Hakenkreuzes jene Ordnung symbolisierte, die man in München während der Räteherrschaft so sehr vermisst hatte. Schon 1920 war die Parteizeitung »Völkischer Beobachter« erstmals herausgegeben worden. Im Februar 1923 konnte sie als Tageszeitung erscheinen. Noch im selben Jahr wurde sie von der Parteizeitung »Der Stürmer« ergänzt, deren Herausgeber Julius Streicher im Oktober 1922 mitsamt den etwa 2000 Mitgliedern der Deutsch-Sozialistischen Partei zur NSDAP übergetreten war.
Betätigungsfeld der Partei war zunächst ihr Gründungsort München und die bayerische Umgebung. In München hielt sie am 27./28. Januar 1923 – inzwischen auf 20 000 Mitglieder angewachsen – ihren ersten Reichsparteitag ab. Am Ende desselben Jahres, das durch die Hyperinflation und den Vermögensverlust von Millionen Menschen gekennzeichnet war, hielten die Nationalsozialisten, die nicht auf dem durch die Verfassung vorgesehenen Weg, sondern durch Putsch die Macht erlangen wollten und Benito Mussolinis »Marsch auf Rom« von 1922 bewunderten, den Augenblick für einen Putsch für gekommen. Am 9. November begannen sie daher einen »Marsch auf Berlin«, der allerdings schon an der Feldherrnhalle in München im Kugelhagel der Polizei endete. Die 16 erschossenen Demonstranten wurden später als »Märtyrer der Bewegung« verklärt und zum Bestandteil nationalsozialistischen Totenkults. Der Prozess gegen die Putschisten, darunter auch der Weltkriegsgeneral und eigentliche »Sieger von Tannenberg« Ernst Ludendorff und der spätere Innenminister Wilhelm Frick, begann am 26. Februar 1924. Ludendorff wurde im Urteil vom 1. April freigesprochen, Hitler zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt und auf die Festung Landsberg überstellt. Die NSDAP wurde im ganzen Reich verboten. In der Haft arbeitete Hitler an seinem Buch »Mein Kampf«, in dem er seine Lebensgeschichte politisch verklärte und seine Ziele und Absichten darlegte. Am 20. Dezember vorzeitig aus der Haft entlassen, fand er seine Partei aufgelöst vor, indem führende Figuren in andere Bewegungen eingetreten waren. Er gründete die NSDAP am 26. Februar 1925 neu und gewann sogleich seine alte Machtstellung wieder, bald ließ er sich »Führer« nennen, 1926 wurde der sogenannte Hitlergruß eingeführt. Die Partei, deren Verbot im Februar 1925 aufgehoben worden war, nahm nun an Wahlen teil und weitete sich auf das ganze Reichsgebiet aus. Das neue bürgerliche Auftreten des Parteichefs hinderte die SA nicht an der Inszenierung von Straßenschlachten und der Ermordung politischer Gegner. Sie wuchs bis 1930 auf 100 000 Mitglieder.
Literatur: Hans-Ulrich Thamer: Verführung und Gewalt. Deutschland 1933–1945. [Siedler Deutsche Geschichte, Reihe: Die Deutschen und ihre Nation, (Bd. V)], Berlin 1994; Ursula Büttner: Weimar – Die überforderte Republik. 1918–1833. Stuttgart 2008