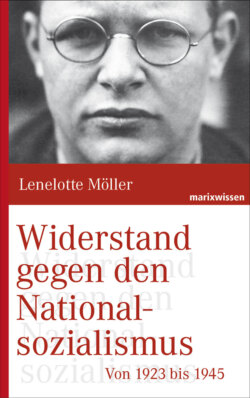Читать книгу Widerstand gegen den Nationalsozialismus - Lenelotte Möller - Страница 13
Franz Schweyer
ОглавлениеZu den frühen Kritikern der NSDAP gehörte der BVP-Politiker und bayerische Innenminister Franz Schweyer. Er wurde 1868 in Osterzell (Schwaben) geboren, studierte Rechtswissenschaften und war anschließend im bayerischen Verwaltungsdienst tätig. Er war Mitglied der BVP, machte aber als Verwaltungsfachmann Karriere, nicht als Parteimitglied. 1921 wurde er bayerischer Innenminister und sorgte 1923 für die Niederschlagung des Hitler-Putsches. Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung verfasste er ein Buch über »Politische Geheimverbände«, unter denen er Gemeinschaften verstand, die »irgend eine für ihre Beurteilung entscheidend ins Gewicht fallende Einrichtung oder Eigenschaft der zuständigen Staatsbehörde oder der Öffentlichkeit tatsächlich planmäßig vorenthält«.5 Darin beschreibt Schweyer 27 größere und kleinere Vereinigungen gesellschaftlicher, politischer und krimineller Art aus Europa und Amerika mit dem Schwerpunkt auf Deutschland. Hinter den Freimaurern nehmen darin die Nationalsozialisten6 und die Bolschewisten den größten Raum ein. Er beklagt die Brutalität der Nationalsozialisten gegenüber Andersdenkenden, besonders Juden, Sozialdemokraten und Marxisten, wirft Hitler Charakterschwäche, Größenwahn und Hemmungslosigkeit vor, Demokratie- und Staatsfeindlichkeit, und besonders – daher die Aufnahme in das Buch – Unehrlichkeit. Schweyer beschreibt die Auseinandersetzungen Hitlers mit der bayerischen Staatsregierung. Er zeigt den Strategiewandel der Partei von den Umsturzplänen hin zur scheinbaren Integration in die Verfassung auf, thematisiert die Lüge vom Sozialismus im Parteinamen, kritisiert die Föderalismusfeindlichkeit der NSDAP und wendet sich selbst gegen jede Diktatur von rechts oder links. Die Nationalsozialisten seien Feinde des Katholizismus und des Christentums im Allgemeinen. Sie verstünden darunter nichts anderes als Antisemitismus und wollten es durch eine germanische Religion ersetzen und wie die Faschisten die Nation zum Gott erheben. Über die jüngste Entwicklung seit Hitlers Haftentlassung aus Landsberg schreibt Schweyer:
Von besonderem Interesse sind die Bestimmungen über die Sturmabteilungen (S.A.). Hierüber ist verfügt: »Die Neubildung der S.A. erfolgt nach den Grundlagen, die bis zum Februar 1923 maßgebend waren. Ihre Organisation hat dem Vereinsgesetze zu entsprechen. Bewaffnete Gruppen und Verbände sind von der Aufnahme ausgeschlossen. Die Abteilung, die gegen die Anordnung der Leitung öffentliche Umzüge veranstaltet oder sich an solchen beteiligt, wird sofort aufgelöst. Die Führer werden aus der S.A. und der Partei ausgeschlossen.« Hiernach behält sich die Leitung der Partei vor, ihrerseits über das Tragen von Waffen und die Veranstaltung von Umzügen das Geeignete zu bestimmen. Bewaffnung und Veranstaltung sollten hiernach nicht ausgeschlossen, sondern nur der Verfügung der Leitung vorbehalten sein. Die Vorschriften erwecken den Anschein einer den Anforderungen des Staates Rechnung tragenden Regelung; bei näherem Zusehen enthalten sie in versteckter Weise die Aufrechthaltung der ganzen früheren Organisation, vor allem auch der Sturmabteilungen und sonstiger Einrichtungen der Partei. Alle diese Einrichtungen werden nur noch strammer als bisher der zentralen Leitung, dem persönlichen Befehl Hitlers, unterstellt. Nach dem ersten Auftreten in öffentlichen Versammlungen scheint Hitler, der mit Bewährungsfrist entlassene Führer der Bewegung, die frühere Sprache und die frühere Agitationsmethode wieder aufnehmen und in der gleichen anmaßenden Weise wie früher den bestehenden Regierungen und Parteien den Fehdehandschuh hinwerfen zu wollen.
Schweyer, Geheimverbände, S. 118f.
Schweyers Warnungen verhallten bei vielen Wählern und schließlich bei den Verantwortlichen in Berlin ungehört. Nach der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten wurde Schweyer in das Konzentrationslager Dachau verbracht, aber zuerst noch einmal freigelassen. Er starb an den Folgen eines im Gefängnis in München-Stadelheim 1935 erlittenen Schlaganfalls, wo er ohne Prozess eingesperrt war.
Quellen und Literatur: Franz Schweyer: Politische Geheimverbände. Blicke in die Vergangenheit und Gegenwart des Geheimbundwesens. Freiburg 1925; Peter-Claus Hartmann: Franz Schweyer. In: Strickler, Matthias (Hrsg.): Portraits zur Geschichte des Deutschen Widerstandes. [Historische Studien der Universität Würzburg VI], Würzburg 2005, S. 41–55